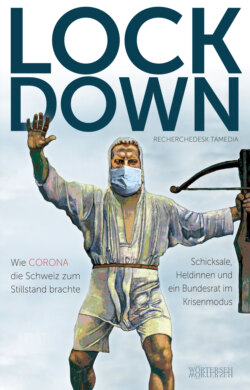Читать книгу LOCKDOWN - Recherchedesk Tamedia - Страница 7
PROLOG
ОглавлениеIn der Nacht auf Dienstag, den 7. April 2020, verliert Anne-Lise Cornu* im Kantonsspital Freiburg ihren Kampf gegen das Coronavirus. Genau wie ihr Mann Henri-Paul* zwölf Tage zuvor. 50 Jahre lang war das Paar verheiratet, das sich einst in einem Café kennen gelernt hatte, sie als Serviertochter, Henri-Paul als Gast. Die beiden haben über Jahre gemeinsam Pétanque gespielt. Und sie haben – am Fuss des historischen Städtchens Romont – eine Tochter und zwei Söhne grossgezogen.
Für sie und für ihre drei Enkeltöchter wollte die 69-jährige Anne-Lise weiterleben. Nach Hause zurückkehren, wo sie so gern Kreuzworträtsel löste und Bücher las.
Doch gleichzeitig war die Rentnerin und Hausfrau müde, so unfassbar müde. Und sie brauchte derart viel Sauerstoff, dass für Ärztinnen und Pflegefachleute kein Zweifel bestand: Anne-Lise Cornu wird es nicht schaffen.
Um sein Leben kämpft, in derselben Nacht, im selben Spital, auch ihr jüngerer Sohn Didier*. Der 46-Jährige ist ebenfalls an Covid-19 erkrankt. Anfangs traten bei ihm nur leichte Symptome auf, erhöhte Temperatur, Magenprobleme, fehlender Appetit – ausgerechnet bei ihm, der schon als kleiner Junge Koch werden wollte und es heute auch ist. Nun, am Dienstag vor Ostern, wird er ins künstliche Koma versetzt. Er muss über einen Schlauch beatmet werden. Ob Didier Cornu die Karwoche überleben wird, weiss niemand.
In den zwölf Tagen zwischen dem Tod seines Vaters und dem Tod seiner Mutter sterben in der Schweiz weitere 619 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das Land ist seit drei Wochen lahmgelegt. Im Lockdown.
Die täglichen schlimmen Nachrichten bedrücken die Bevölkerung, die angehalten ist, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Niemand kann sagen, was noch kommt. Ob das Virus überhaupt in den Griff zu bekommen ist. Oder ob italienische Verhältnisse drohen, mit Ärzten, die Patienten sterben lassen müssen, weil es nicht mehr genügend Beatmungsgeräte gibt. Mit Kolonnen von Kühllastern, die die Leichen abtransportieren.
Am Abend nach der Nacht, in der Anne-Lise Cornu stirbt, merkt Alain Berset*, dass ihm das Virus selber gefährlich werden könnte. Als Gesundheitsminister steht der Bundesrat im Mittelpunkt der Coronakrise. Gemeinsam mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat er am 16. März den Lockdown verkündet, hat der Bevölkerung die Schliessungen der Schulen und Geschäfte, den Stillstand des Landes immer wieder erklärt und als alternativlos verteidigt. Nun erfährt er, dass er selbst infiziert sein könnte.
Eine Mitarbeiterin, mit der Berset im selben Sitzungszimmer war, ist positiv getestet worden. Berset schottet sich sofort ab. Der Coronatest wird am nächsten Morgen, am 8. April um 6 Uhr früh, durchgeführt. Das Militär bringt die Probe umgehend ins Labor Spiez.
Es sind dunkle Tage für die Schweiz. Eben erst ist der Bevölkerung schmerzlich bewusst geworden, dass ihr Land trotz seinem Reichtum und seinem sehr guten Gesundheitssystem keineswegs gut auf die Seuche vorbereitet ist. Schlimmer noch: Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und der Toten sind höher als in den meisten anderen Nationen.
Wie konnte das passieren? Wie viele wird es noch treffen? Wie kommt die Schweiz da wieder raus? Die bangen Fragen stellen sich am Anfang der Karwoche viele. Auf den folgenden Seiten werden wir darauf Antworten geben.
Wir, das sind vierzehn Investigativjournalistinnen und -journalisten vom erweiterten Recherchedesk des Verlagshauses Tamedia. Wir begleiteten besonders exponierte Menschen aus der ganzen Schweiz durch ein halbes Jahr Coronakrise – mit dem Ziel, ihr Erleben, ihre Handlungen, ihre Gedanken und Gefühle in den schweren Monaten für die Nachwelt festzuhalten.
Die Tochter und die beiden Söhne des Ehepaars Anne-Lise und Henri-Paul Cornu erzählen uns, was das Virus in ihrer Familie angerichtet hat. Bundesrat Alain Berset gewährt uns Einblick in sein Krisenmanagement und in seine persönliche Betroffenheit. Zu unseren Schlüsselpersonen zählen zudem Menschen wie die Leiterin der Intensivpflege in einem Tessiner Spital. Maria Pia Pollizzi* nahm den ersten Schweizer Covid-19-Patienten auf und begleitete fortan viele auf ihrem Weg zur Genesung – oder beim Sterben. Die Zeugnisse unserer Schlüsselpersonen haben wir mit den Ergebnissen weiterer intensiver Recherchen verwoben.
Dazu gehörte die Auswertung amtlicher Dokumente, die wir uns mit dem Öffentlichkeitsgesetz beschaffen konnten. Dank über 50 Protokollen vertraulicher Sitzungen wird klar, wie die verschiedenen Taskforces und Krisenstäbe des Bundes agierten.
Zudem haben wir mit über 50 weiteren Personen geredet, unter ihnen Politikerinnen, Epidemiologen, Klinikleiter, Parlamentarier und Ärztinnen. Insgesamt führten wir über 200 Stunden Recherchegespräche.
So entstand eine Chronik jenes halben Jahres, in dem die Schweiz in ihrer bislang schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steckte. Erzählt wird sie von Menschen, die persönlich schwer getroffen wurden. Und von Menschen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Medizin, die das Virus bekämpfen. Von Menschen wie Ricarda Luzio*, einer Spitalapothekerin aus Luzern.
AB MITTE JANUAR irritiert Ricarda Luzio etwas.
Sie fährt auch im Winter täglich mit dem Velo zur Arbeit. Dies ist zu Beginn des Jahres 2020 weniger beschwerlich als in anderen Jahren, denn der Schnee fehlt im Unterland gänzlich, und die Sonne scheint in der Zentralschweiz so häufig wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Ricarda Luzio ist Chefapothekerin in der Hirslanden-Klinik St. Anna in Luzern.
Auf dem Weg von ihrer Wohnung in der Luzerner Neustadt an ihren Arbeitsort überquert die 43-Jährige die stark befahrene Seebrücke, die für gewöhnlich voller Touristen ist. Die Sicht auf den See und die Stadt ist von hier aus bezaubernd.
Ihre Irritation: Hat es weniger chinesische Touristen in der Stadt? Oder täuscht der Eindruck?
In der Pause erzählt eine Mitarbeiterin der Chefapothekerin, der Schwanenplatz, sonst übervoll mit Reisecars, sei leer. Sie reden über dieses »neuartige Coronavirus« in China, über das die Medien schreiben. Alle sind sich einig: Das ist nichts im Vergleich zu einer saisonalen Grippe, denn daran sterben in der Schweiz pro Jahr mehrere Hundert Menschen. Die Diskussion nimmt rasch ein Ende.
Ricarda Luzio debattiert auch zu Hause über das noch unbekannte Virus. Ihr Mann arbeitet als Leitender Arzt am Kantonsspital Luzern, wo bald ein ganzes Stockwerk für Coronapatienten leer geräumt wird. Beide erachten den Erreger in diesen Januartagen als vergleichsweise harmlos, die Angst davor übertrieben. »Das ging, glaube ich, zu Beginn vielen so«, sagt Luzio. »Sogar wir vom Fach haben das Virus unterschätzt.« Wenn ihre Kollegen auf sie zukommen, beschwichtigt sie, wenn Pharmaassistentinnen nachfragen, winkt sie ab. Das Virus ist weit weg – in dieser Riesenstadt namens Wuhan, die im Westen kaum jemand kennt.
AM 16. JANUAR fliegt eine 30-köpfige Touristengruppe aus ebendiesem Wuhan nach Rom. Neun Tage wird sie in Europa verbringen, erst ist die Gruppe in Italien, später in Frankreich und dazwischen zwei Tage in der Schweiz, einen grossen Teil im Kanton Luzern. Schon auf dem Hinflug fühlt sich eine 53-jährige Reiseteilnehmerin kränklich. Sie hustet.
Als die Gruppe mit ihr am 19. Januar in einem gecharterten Bus die italienisch-schweizerische Grenze passiert, kennt Europa noch keine Gesundheitskontrollen, keine Reisebeschränkungen und erst recht keine unüberwindbaren Barrieren. Der Kontinent fühlt sich zu diesem Zeitpunkt sicher vor dem Virus.
Die Reisegruppe aus Wuhan erwartet eine sonnige Schweiz und ein gedrängtes Programm. Die 53-Jährige, die bereits auf dem Hinflug hustete, trägt keine Schutzmaske. In Luzern verlassen die chinesischen Touristen den Bus, steigen in einen Panoramazug. Die »Golden Pass Line« bringt sie über den tief verschneiten Brünig nach Interlaken. Die Fahrt dauert knapp zwei Stunden.
Die Gruppe aus Wuhan übernachtet vom 19. auf den 20. Januar in einem Hotel in Sursee, das ausschliesslich Reisegruppen beherbergt, die schnell nach Luzern oder ins Berner Oberland wollen und dann weiterziehen. In unserem Fall weiter nach Paris.
In der französischen Hauptstadt fühlt sich die kränkelnde Touristin noch immer nicht wohl. Inzwischen hat sie offenbar ihre Tochter angesteckt. Bei der 29-Jährigen zeigen sich am ersten Tag in Paris Symptome, wie sie typisch scheinen für den wenig bekannten Erreger. Die Gruppe besucht die klassischen Touristenattraktionen und fliegt am 24. Januar zurück nach China.
Von den 30 Reisenden erkranken schliesslich fünf in einer ähnlichen Art. Drei davon werden getestet, allerdings erst nach ihrer Rückkehr, als Wuhan bereits unter Quarantäne steht. Alle drei sind Sars-CoV-2-positiv.
* Die Schlüsselpersonen dieses Buches sind, wenn sie das erste Mal erscheinen, mit einem Stern gekennzeichnet und werden ab Seite 323 vorgestellt.