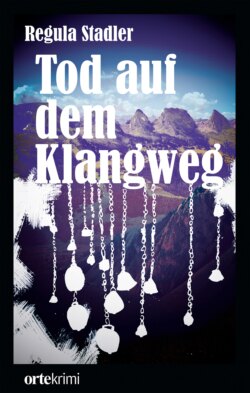Читать книгу Tod auf dem Klangweg - Regula Stadler - Страница 7
Оглавление1
«Das ist mein letztes Wort! Wenn du tatsächlich vorhast, deine einzige Tochter wegen mir zu enterben, dann weiss ich nicht, ob ich noch mit dir zusammen sein kann. Zum tausendsten Mal: Ich will dein Geld nicht!» Karin erhob sich vehement vom alten roten Sofa, stapfte mit hörbaren Schritten in die Küche und schloss nicht eben sanft die Tür hinter sich.
Marie blieb der Mund offen stehen. Sie schluckte leer. Was sollte das? Karin, ihre ruhige, sanftmütige und zurückhaltende Karin! So hatte sie in ihrer ganzen knapp vierjährigen Beziehung noch nie mit ihr gesprochen! Und dabei meinte Marie es nur gut mit ihr. Abgesehen davon wollte sie Eva gar nicht enterben. Sie hatte ihre Tochter auf den Pflichtteil gesetzt, und jetzt wollte sie mit ihrer Freundin einen Partnerschaftsvertrag abschliessen, damit diese einst den grösseren Teil ihres Vermögens erben würde.
Karin war mit ihren siebenundsechzig Jahren um einiges fitter und gesünder als sie mit ihrem angeborenen Herzfehler und ihrem Übergewicht. Logisch, dass sie sich ab und zu Gedanken über das Sterben machte und ihre Liebste gut versorgt wissen wollte.
Das Schnarren der Kaffeemaschine riss sie aus ihren düsteren Gedanken. Sie beschloss kurzerhand, bereits heute – und zwar allein – ins Toggenburg zu fahren. Nach einem knappen «Tschüss, ich fahr dann mal ins Toggi», und ohne eine Antwort abzuwarten, griff Marie nach ihrer Tasche, verliess die lauschige, grosszügige Altbauwohnung an der Idastrasse und machte sich auf den Weg zum Auto, das sie auf ihrem Abstellplatz an der Gertrudstrasse parkiert hatte. Die idyllisch von Pflanzen umrankte Maisonettewohnung hatten sie und ihr Mann Kurt vor 25 Jahren gekauft, als man in Zürich Wohnungen und Häuser noch bezahlen konnte.
Ihre Tochter lebte seit dem plötzlichen Tod ihres Vaters vor sechs Jahren in New York und war nur selten bei ihrer Mutter in der Schweiz zu Besuch. Sie war für Marie zeitlebens irgendwie ein Fremdkörper, sie hatte nie ein Kind gewollt. Als sie damals unverhofft schwanger wurde, hatte sich ihr Mann derart gefreut, dass Marie beinahe ein schlechtes Gewissen bekam, weil ihr vor dem Zeitpunkt grauste, an dem das Kind da sein würde. Sie und Kurt waren beide Goldschmiede gewesen und hatten zusammen in ihrer eigenen Schmuck-Boutique gearbeitet. Nachdem Eva da war, kümmerte sich Kurt von Anfang an mehr um das Kind, und Marie war mehr im Geschäft tätig.
Für Eva war der Tod ihres Vaters ein furchtbarer Schock gewesen, sie war Hals über Kopf nach New York ausgewandert. Jetzt würde sie mit ihrem Freund Brian nach Zürich kommen, und Marie wollte die seltene Gelegenheit nutzen, um ihre Finanzen zu regeln und ihre Tochter vor vollendete Tatsachen zu stellen. Eva und Brian würden am Abend in Zürich ankommen und morgen oder übermorgen auch im Ferienhaus in Ennetbühl auftauchen.
Die Auseinandersetzung mit ihrer Freundin liess Marie keine Ruhe. Dass Karin ihr drohte, die Beziehung abzubrechen, falls sie weiterhin darauf bestand, ihre Tochter in Bezug auf ihr Erbe zu benachteiligen, hatte sie total überrascht. Aber gerade wegen ihrer Geradlinigkeit und Uneigennützigkeit liebte sie Karin so sehr.
Marie war dermassen mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar nicht merkte, wie prachtvoll der Tag war und wie strahlend in Sonne getaucht die Landschaft an ihr vorbeizog. Der Zürichsee leuchtete blau und einladend, wiewohl es zum Baden jetzt Mitte September vermutlich zu kalt war.
Gegen halb vier Uhr kam sie in ihrem Ferienhaus in Ennetbühl an, nachdem sie im Coop in Nesslau das Nötigste eingekauft hatte. Sie machte sich als Erstes einen Kaffee und wollte sich gerade in den Garten setzen, als sie Ueli, ihren Nachbarn, von der Weide kommen sah. Sie wartete, bis er in der Nähe des Gartens erschien und rief: «Hoi, Ueli, hast du Zeit und Lust auf einen Kaffee?» Der lachte und meinte: «Lust schon und Zeit … na ja, gern, aber nur kurz.»
Im Gegensatz zu ihrem früheren Nachbarn mochte Marie den Biobauern Ueli Strässle sehr. Er war nicht nur gebildet und kulturell interessiert, sondern auch ein toleranter, grosszügiger und fröhlicher Mensch, kurz, ein interessanter Gesprächspartner, was hier oben nicht gerade selbstverständlich war. Schade, dass er keine Frau hat, dachte sie. Er war gross und kräftig, mit einem gut geschnittenen, intelligenten Gesicht und Augen, die meist humorvoll und entspannt in die Welt schauten. Vor vier Jahren, als er den Hof übernommen hatte, war eine Frau bei ihm, die aber nach wenigen Monaten wieder nach Bern zurückkehrte.
«Na, wie läuft’s auf dem Hof? Die Schafe gesund?»
«Ja, Gott sei Dank, das ist überstanden!»
Vor Kurzem litten Uelis Mutterschafe und auch die Lämmer an der Schafräude, einer hochansteckenden Milbenkrankheit, und Ueli musste alle Tiere, unter tatkräftiger Mithilfe des Tierarztes, in einem extra errichteten Bad mit speziellen Medikamenten baden.
«Mir persönlich geht’s auch nicht schlecht, bis auf meinen Rücken, der meldet sich, wenn ich’s übertreibe. Und wie du weisst, vermisse ich eine Frau hier oben. Du hast doch eine Tochter. Die sucht nicht zufällig einen Mann und will bauern im Toggenburg?» Ueli lachte und nahm einen Schluck vom Kaffee, den Marie ihm hingestellt hatte.
«Stell dir vor, die kommt tatsächlich morgen, aber leider mit ihrem Freund, diesem Brian, einem arbeitslosen Musiker, soviel ich weiss. Nicht unbedingt der Schwiegersohn, den ich mir vorgestellt habe. Überhaupt, ein Amerikaner …», rümpfte Marie die Nase.
«Marie, ich wusste gar nicht, dass du solche Vorurteile hast! Gib dem armen Kerl doch erst mal eine Chance. Deine Tochter lebt in New York; es ist also kein Wunder, dass sie mit einem Amerikaner liiert ist.»
«Wenn ich mich richtig erinnere, ist er gar kein gebürtiger Amerikaner. Er ist als Kind mit seinen Eltern von der Schweiz in die USA ausgewandert; jedenfalls versteht und spricht er Schweizerdeutsch. Es ist einfach so, dass er mir nicht sonderlich sympathisch ist.» Versonnen griff Marie nach ihrer Kaffeetasse.
«Wo bleibt denn Karin? Ich bin es mir gar nicht gewohnt, dass du allein hier bist?»
Marie erzählte ihm nach kurzem Zögern von ihrer Auseinandersetzung. «Die eingetragene Partnerschaft hat, abgesehen vom Erbrecht, weitere Vorteile. Falls zum Beispiel eine von uns einen Unfall hat, wird die andere informiert. So, wie es jetzt ist, sind wir rechtlich gesehen Fremde! Wir werden alt, es ist höchste Zeit, dass wir unsere Beziehung vertraglich absichern», ereiferte sie sich.
«Da hast du Recht. Andererseits finde ich auch, dass Eva deine Haupterbin bleiben sollte. Ihr müsst eine für alle stimmige Lösung finden.»
Typisch Ueli, dachte Marie, ganz Diplomat, will es immer allen recht machen. Aber letztlich geht es doch darum, was ich persönlich will. Wem ich mein Geld hinterlassen will. Diese Gedanken liessen sie auch nicht los, nachdem Ueli gegangen war und sie sich eine Kleinigkeit zum Abendessen richtete. Sie hörte noch einige Arien aus einer ihrer geliebten Wagner-Opern und ging früh zu Bett.
Eva Riefener war todmüde, als sie und Brian Daves gegen halb zehn Uhr abends endlich in Maries Wohnung in Zürich ankamen. Dass die Mutter nicht da war, um sie zu empfangen – immerhin hatten sie sich fast zwei Jahre nicht gesehen – verbesserte ihre Laune nicht. Sie hatte beinahe kein Geld mehr. Das Taxi vom HB nach Wiedikon hatte sie mit ihren letzten Euros bezahlt, Schweizer Franken musste sie erst noch wechseln; sie musste unbedingt von ihrer Mutter Geld leihen. Karin empfing die beiden gastfreundlich und warmherzig, doch Eva blieb kühl und unnahbar. Sie hatte von Anfang an beschlossen, die Geliebte ihrer Mutter nicht zu mögen. Sie wusste, dass diese von Maries Geld lebte, und obwohl sie sich selbst, im Gegensatz zu Brian, wenig aus Geld machte, fand sie, dass Maries Geld ihr zustand und nicht Karin. Da sie als freischaffende Grafikerin in New York von der Hand in den Mund lebte, konnte sie einen gelegentlichen finanziellen Zustupf gut brauchen, und Brian hatte sie wiederholt gedrängt, mit ihrer Mutter über einen Erbvorbezug oder eine regelmässige finanzielle Unterstützung zu sprechen. Eva ahnte, dass das schwierig werden könnte.
Karin tischte den beiden ein spätes Abendessen auf, wofür Eva ihr dankbar war. «Ich muss euch morgen unbedingt etwas mitteilen, bevor ihr ins Toggenburg zu Marie fahrt.» Karin hatte sich endlich durchgerungen. Sie musste mit Eva sprechen und ihr von Maries Absichten erzählen.
«Ja, jetzt wisst ihr es. Ich habe deiner Mutter klipp und klar gesagt, dass ich damit nicht einverstanden bin und ihr Geld nicht annehmen werde. Mit der eingetragenen Partnerschaft bin ich einverstanden, aber falls ich Marie einst beerben sollte, gehört das Geld dir. Ich bekomme eine kleine Rente – habe schliesslich jahrelang als Teilzeit-Lehrperson in der Schule unterrichtet – und viel zum Leben brauche ich nicht.» Karin hatte ausgesprochen, was ihr auf dem Herzen lag und lehnte sich im Stuhl zurück. Eine grosse Ruhe breitete sich in ihr aus, gleichzeitig spürte sie eine Anspannung, die sie sich nicht erklären konnte.
«Warum hast du denn Teilzeit gearbeitet? Du hast doch keine Kinder, soviel ich weiss?» Eva war jetzt doch neugierig geworden.
«Nein, ich habe schon immer gewusst, dass mich Frauen mehr interessieren als Männer. Deshalb konnte ich leider keine Familie gründen. Aber ich hatte eine Schwester mit Down-Syndrom, die bei mir lebte. Sie ist erst vor wenigen Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, sie wurde einundsechzig Jahre alt. Es war nicht immer einfach mit ihr.» Karin zuckte mit den Schultern und lächelte entschuldigend.
Eva betrachtete sie mit widerwilligem Interesse. Eigentlich war ihr die zierliche, noch immer gutaussehende Frau mit den silbergrauen Locken nicht unsympathisch. Sie war auf wohltuende Weise anders als ihre Mutter. Gross, schwer, laut, rechthaberisch, dominant, so war ihre Mutter, seit sich Eva erinnern konnte. Was die beiden Frauen wohl aneinander anzog?
Brian hingegen hatte nur Ohren für Karins Verzichterklärung auf die Erbschaft. «Kannst du uns das schriftlich geben, dass du auf Maries Geld verzichtest?», wollte er wissen.
Eva warf ihm einen empörten Blick zu.
«Ich denke, das hat Zeit, bis ich bestimmt weiss, ob und wieviel ich von Marie erbe. Wenn ich sie denn überhaupt je beerbe, schliesslich sind wir beide ungefähr gleich alt.»
Da das Wetter immer noch traumhaft war, wollten Eva und Brian noch vor dem Mittag ins Toggenburg fahren. Karin hatte im Sinn, später nachzukommen, damit Mutter und Tochter Gelegenheit hätten, ungestört miteinander zu sprechen.
Der grösste Störfaktor ist allerdings mit von der Partie, dachte sie, und betrachtete den leicht aufbrausenden, miesepetrigen Brian unauffällig. Schade, dass er Schweizerdeutsch spricht und versteht. Dass Eva dieser Typ gefällt! Na ja, mit seinen dunklen langen Haaren und seiner ein bisschen zu grossen Nase sieht er nicht schlecht aus; zudem ist er Musiker und spielt Schlagzeug in einer Jazzband in New York. Geld verdient er praktisch keines, kein Wunder, dass sich Eva an ihre vermögende Mutter wendet. Nachdem Karin Eva Geld für das Nötigste geliehen hatte, machten sich die beiden auf den Weg zum Hauptbahnhof und fuhren via Rapperswil ins Toggenburg.
Am nächsten Morgen schlief Marie für ihre Verhältnisse ungewohnt lange. Erst gegen zehn stand sie auf, um sich einen Kaffee zu machen. Sie setzte sich gerade an den Frühstückstisch, als die Hausglocke läutete. Sie rang kurz mit sich und entschied dann, zur Tür zu gehen. Vielleicht war es Ueli. Doch draussen stand Beate Richle, eine Nachbarin. Die zirka vierzigjährige Beate war eine äusserst unberechenbare Person. Sie neigte zu unerwarteten Wutanfällen, die die Menschen, die gerade mit ihr zu tun hatten, erschreckten und irritierten. Handkehrum war sie freundlich und anständig und schien den Streit, den sie wegen einer Nichtigkeit am Tag zuvor vom Zaun gebrochen hatte, vergessen zu haben. Marie vermutete, dass sie psychisch krank war, anders konnte sie sich ihr Verhalten nicht erklären.
«Ich muss schon sagen, Marie. Gestern über Mittag hast du wieder laut gelacht in deinem Garten. Ich konnte meinen Mittagsschlaf nicht halten. Ich habe dir schon oft gesagt, dass ich meinen Schlaf brauche. Du nimmst gar keine Rücksicht und schäkerst mit Ueli herum. Schäm dich, eine Frau in deinem Alter. Und ich meinte, du stehst auf …»
«Ich weiss nicht, was du willst, Beate! Und in diesem Ton musst du nicht mit mir sprechen!», gab Marie zurück und schloss die Tür vor ihrer Nase zu. Ihre gute Laune hatte sich in Luft aufgelöst, die von Beates ausgeatmetem Gift verseucht zu sein schien. Meistens fühlte sie sich unbeschwert und mit sich im Reinen hier oben, aber immer wieder gab es Nachbarn, die ihr das friedliche, sorgenfreie Leben nicht zu gönnen schienen. Zuerst war es Albin gewesen, dieser chronisch schlecht gelaunte, komische Kauz. Und seit einiger Zeit war es Beate, die sie mit ihrem übergriffigen Verhalten störte. Marie wusste, dass Beate sie nicht ausstehen konnte und krankhaft eifersüchtig auf sie war. Eine Weile trödelte sie unschlüssig und grollend im Haus herum, abwechslungsweise die Szene mit Beate und die gestrige Auseinandersetzung mit Karin im Hinterkopf. Schliesslich beschloss sie, nach Unterwasser und von dort mit der Standseilbahn auf den Iltios zu fahren.
Das Wetter war herrlich an diesem Septembertag. Als Marie um drei Uhr an der Talstation ankam, musste sie feststellen, dass sie nicht die einzige war, die um diese Zeit auf den Iltios wollte. Geduldig stellte sie sich in die Warteschlange vor dem Ticketschalter.
Oben angekommen, wanderte sie auf dem Klangweg Richtung Sellamatt. Dort setzte sie sich in der Beiz an die Sonne und bestellte ein Glas Weisswein. Aus einem Glas wurden mehrere, und eine Dreiviertelstunde später machte sie sich gemächlich, mit sich, der Welt, der Nachbarin und auch mit Karin versöhnt, auf den Rückweg. Müde vom Wein, setzte sie sich kurz auf eine Bank an die Sonne und döste im Nu ein. Als sie erwachte, war die Sonne weg; es war bereits fünf nach halb sechs Uhr. Marie erschrak, sie hatte fast zwanzig Minuten geschlafen.
Die letzte Bahn war um 17.30 Uhr gefahren. Nun musste sie wohl oder übel zu Fuss nach Unterwasser hinunter! Kein Mensch war mehr unterwegs. Zügig, aber immer noch leicht beschwipst, wanderte sie Richtung Iltiosbahn. Wie schon auf dem Hinweg konnte sie der Glockenbühne, dem Posten 6 des Klangwegs, nicht widerstehen. Sie musste die vielen an Ketten hängenden Glocken einfach in Bewegung setzen. Das Geläute beruhigte sie und nahm ihr das ein wenig unangenehme Gefühl, das sie verspürte, seitdem ihr klar geworden war, dass ihr eine für ihre Verhältnisse längere und anstrengende Wanderung bevorstand. Sie gab einer im hinteren Teil des Glockenfeldes hängenden Glocke einen kräftigen Schubs. Als sie sich umdrehen wollte, nahm sie einen grossen Schatten wahr, der sich auf sie zu bewegte. Sie hatte keine Zeit mehr, Angst zu empfinden: Ein harter Schlag, und alles war schwarz.
Er war einen Moment erschrocken und verwirrt darüber, was geschehen war. Vor allem überraschte es ihn, wie einfach es gewesen war, die Frau zu töten. Er hatte kräftig mit der grössten Glocke ausgeholt und sie gegen Maries Schläfe prallen lassen. Und sie war tatsächlich tot. Ihre offenen dunkelbraunen Augen blickten ihn erstaunt an, weder Angst noch Schmerz verzerrten ihre Gesichtszüge.
Rasch blickte er sich um. Kein Mensch war zu sehen. Er packte die grosse, schwere Frau unter den Armen und schleppte sie über den Weg Richtung Abhang. Hinter einem grösseren Gebüsch am leicht abschüssigen Hang liess er sie liegen und ging rasch weiter. Er war so euphorisch und aufgedreht, dass er ausnahmsweise keinerlei Schmerzen verspürte. Noch bevor er die Station der Iltiosbahn erreichte, schlug er sich links in die Büsche und marschierte ins Tal hinunter Richtung Unterwasser.