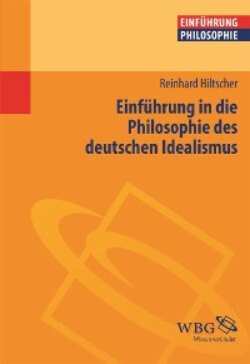Читать книгу Einführung in die Philosophie des deutschen Idealismus - Reinhard Hiltscher - Страница 7
|9|Einleitung
ОглавлениеDie philosophiegeschichtliche Epoche von Kant bis Hegel wird oftmals als „Klassische Deutsche Philosophie“ bezeichnet. Dieses Etikett beinhaltet nicht sonderlich viel an Information zu dieser Phase der Philosophiegeschichte. Der Terminus „Deutscher Idealismus“, mit welchem besagter ‚Zeitabschnitt‘ zumeist beglückt wird, sagt eigentlich fast noch weniger Präzises aus. Umgangssprachlich hindert uns nichts daran, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Zettmannsdorf schlicht aus dem Grunde für einen „Idealisten“ zu halten, weil seine herausragenden Löschanstrengungen nicht mit einer Bezahlung verbunden sind, sondern ausschließlich durch das Gefühl einer sozialen Mitverantwortung für das Gemeinwohl der Dorfgemeinschaft motiviert sind. Auch macht der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft Kemal und Holm keineswegs zu Vertretern des Deutschen Idealismus, auch dann nicht, wenn beide – wie üblich – im Dorfgasthaus bei Fernsehübertragungen die Deutsche Fußballnationalmannschaft bei deren Spielen heftig und ebenfalls ohne den Erhalt eines Entgelts anfeuern. Weder die Nationalität, weder ein besonders wohlmeinendes Sozialengagement innerhalb deutscher Lande noch die ausgesprochen seltene Kombination beider Aspekte können einen zu einem „Deutschen Idealisten“ im philosophischen Sinne machen. Es dürfte sich deshalb vor dem Hintergrund dieser Problemlage als eine gelingende Hypothese erweisen, den Begriff des Deutschen Idealismus anhand der von seinen Vertretern behandelten Problemen und Problemlösungsstrategien aus zu bestimmen.
Die Geschichte der Philosophie in Deutschland in der Zeit von Kant bis Hegel (wobei Kant eigentlich noch nicht zu den Vertretern des Deutschen Idealismus zu zählen ist) hat zwei signifikante Hauptthemen. Das erste Thema ist das der Freiheit. Kants Versuch, eine echte autonome Selbstbestimmung des Willens darlegen zu können, die sich diese Autonomie auch angesichts einer kausalmechanischen Natur bewahren kann, wird Basis und Bezugspunkt der philosophischen Entwicklung ausgehend von Fichtes Wissenschaftslehre und Sittenlehre über Schellings Freiheitsschrift bis hin zu Hegels absolutem Idealismus, der die eigentliche und ursprüngliche Freiheit in der Idee verortet. Dieses erste Hauptthema beschäftigt uns in der vorliegenden Monographie jedoch nicht.
Das zweite gemeinsame Hauptthema der Epoche liegt in der Entfaltung des Gedankens der Letztbegründung unseres Wissens. Kant legt erstmals dar, dass Wissen nur dann notwendigerweise empirisch gültig oder ungültig (= geltungsdifferent) sein kann, wenn es sich aus den Prinzipien seiner eigenen Form heraus letztbegründet. Dabei ist für Kant der Gedanke einer Letztbegründung der Geltung unseres Wissens stets mit der Konzeption einer Konstitution der Gegenstände unseres Wissens durch dieses Wissen selbst verbunden. So in etwa sollte Kants Auffassung verstanden werden, die Gegenstände hätten sich nach der Erkenntnis, nicht aber die Erkenntnis nach |10|den Gegenständen zu richten. Oder anders gesagt: Geltungskonstitution des Wissens ist Gegenstandskonstitution durch das Wissen.
Dabei ergibt sich aber das Problem, dass die Konstitution der Gegenstände des Wissens ausschließlich den gemeinsamen gegenständlichen Charakter aller Gegenstände betreffen kann, nicht jedoch deren je besonderen gegenständlichen Charakter. Besondere Gegenständlichkeit ist für eine Konstitution durch das Denken und Wissen unverfügbar. Fichte hat dieses Problem begriffen. Deshalb legt er im ersten Grundsatz ein inbegriffliches Gefüge von Prinzipien des Wissens vor, das noch nicht auf die gegenstandsgebundene endliche Erkenntnisform des Menschen präzisiert ist. Doch muss auch er in den nachfolgenden zwei weiteren Grundsätzen der Wissenschaftslehre der vermeintlich unausweichlichen Gegenstandsgebundenheit unserer Erkenntnis seinen Tribut zollen. Die systematische Konstellation, die er im zweiten und dritten Grundsatz annimmt, zwingt ihn wenig später zur Einführung der berühmt-berüchtigten „Intellektuellen Anschauung“. Diese bezeichnet philosophisch eine sehr umstrittene Eigenschaft unseres Wissens, deren Realmöglichkeit sich nur schwer dartun lässt.
Schellings Frühphilosophie zieht hieraus einen gewichtigen Schluss. Der Letztbegründungsgedanke scheitere aus seiner Sicht nur dann nicht an der besonderen Gegenständlichkeit, wenn die selben rationalen Prinzipien, die den Prozess der Natur steuerten, zugleich Prinzipien unseres Wissens seien. Mit dieser Einsicht führt Schelling Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie als gleichwertige und gleichursprüngliche philosophische Grundlagenwissenschaften der Letztbegründungsreflexion ein. Allerdings führt diese Operation, wie Karen Gloy und insbesondere Christian Iber ausführen, zu einer Ontologisierung des Letztbegründungsgedankens. Denn nun haben wir es mit einem Absoluten zu tun, das zugleich einer ansichseienden Natur wie dem erkennenden Subjekt zugrundeliegt. Der hohe spekulative Grad dieser Philosophie mag die Phantasie von Literaten, Künstlern, Naturschützern und Schöngeistern beflügeln, ein methodisch sauberer Gültigkeitsbeweis für die Fundamente der Schelling’schen Frühphilosophie lässt sich jedoch kaum erbringen.
Hegels Genialität lässt ihn den ‚Gordischen Knoten des systematischen Problems‘ durchschlagen. Er sagt sich: Wenn jede Letztbegründungsreflexion auf die Geltung unseres Wissens daran scheitern muss, dass sie sich zugleich als eine Konstitutionsreflexion der Gegenstandsbezogenheit unseres Wissens durchführen muss, dann ist eine echte Geltungsreflexion unseres Wissens nur dann möglich, wenn sie sich von der Gegenstandskonstitution entkoppeln kann. In der Tat legt Hegel in der Wissenschaft der Logik eine Theorie vor, in der das Wissen seine Geltungskategorien ohne Bezug auf ihm fremde Gegenständlichkeit selbst erzeugt. Negativität wird hier von Hegel als ursprüngliche Bestimmungsfunktion des Denkens entfaltet, weil sie die ursprünglich sinnerzeugende Selbstbezüglichkeit des Denkens darstellt. Doch dekretiert Hegel nicht schlicht jene Unabhängigkeitserklärung der Geltungsselbstkonstitution des Wissens von der Gegenstandskonstitution des Wissens. In der Phänomenologie des Geistes legt er eine propädeutische Wissenschaft vor, die den Nachweis erbringt, dass jeder Begriff, den das Wissen von einem ihm externen Gegenstand bildet, nicht geeignet ist, die Geltungsselbstkonstitution des Wissens zu erklären und zu begründen. Diese |11|skeptische Destruktionsgeschichte der vermeintlichen Unausweichlichkeit der Annahme einer gegenständlichen Fremdgebundenheit des Wissens ist uno actu die Einleitung in die autochthonen Geltungsselbstreflexion des Wissens in der Wissenschaft der Logik.
Dass der Gedanke einer letzten Begründung der Geltungsfähigkeit des Wissens in unserer Zeit in Verruf geraten ist, verdankt sich u.a. Hans Albert. Das berüchtigte „Münchhausentrilemma“ (siehe S. 59 dieser Arbeit) scheint die Vergeblichkeit jedes Letztbegründungsversuches zu belegen. Doch verstehen „Idealismus“ und „Transzendentalphilosophie“ Letztbegründung nicht im Sinne von inhaltlichem Wissen. Gerold Prauss ((35), bes. S. 81–101) etwa spricht mit ‚Blick auf Kant‘ von einer letzten Begründung der Wahrheitsdifferenz (bzw. Geltungsdifferenz) des empirischen Urteils. Die Transzendentale Logik lege Prinzipien des Wissens dar, kraft derer unsere Urteile einen empirischen Gegenstandsbezug aufwiesen und deshalb überhaupt erst kontingenterweise empirisch wahr oder falsch sein könnten. Transzendentalphilosophie strebe keine ‚nur wahre‘ inhaltliche Letztbegründung des Wissens an, sondern eben – so Prauss – eine Letztbegründung der Wahrheitsdifferenz. 1985 hat Wolfgang Kuhlmann (Reflexive Letztbegründung. Freiburg/München) Albert vorgehalten (z.B. S. 64), die Konstruktion des Münchhausentrilemmas setze eine Sicht voraus, nach der es für „Begründungsbedürftiges“ stets nur „externe Gründe“ geben könne. Nach einer solchen Sicht wäre evidenterweise Letztbegründung ausgeschlossen. Alberts verborgenes Missverständnis liegt darin, wenn wir Kuhlmanns ‚Albertkritik‘ auf die hier zu verhandelnde Thematik ‚idealistischer Gnoseologie‘ anwenden, die Prinzipien des Wissens als Sätze bzw. Urteile aufzufassen. Da jeder Satz des Wissens, sofern er Wissen sein soll, begründet werden muss, könnte ein „letzter Satz“, von dem alle weiteren Sätze abzuleiten wären, nicht viel mehr als eine willkürliche Erschleichung sein. Doch sind die Prinzipien der Geltung für die Transzendentalphilosophie und die ‚idealistische Gnoseologie‘ gerade keine Sätze, sondern stellen die funktionale Eigenbestimmtheit des Wissens selbst dar. So hatte insbesondere Ernst Cassirer in „Substanzbegriff und Funktionsbegriff: Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik“ (siehe Auswahlbibliographie) eindringlich und zutreffend den engen Zusammenhang zwischen eigenbestimmter funktionaler Invarianz der Prinzipien der Erkenntnis und deren Apriorität dargelegt. Diesen Zusammenhang von ‚Invarianz‘ und ‚Apriorität‘ erachten wir für einen Schlüssel zum Verständnis der ‚idealistischen Gnoseologien‘ und übernehmen bei den nachfolgenden Darstellungen der Philosophie Kants, Fichtes, Schellings und Hegels diese grundsätzliche ‚funktionale Perspektive‘ Cassirers.