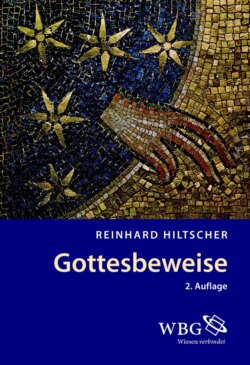Читать книгу Gottesbeweise - Reinhard Hiltscher - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.1 Anselm
Оглавление1.1.1.1 Anselms Weg zum „unum argumentum“
Mit Anselm von Canterbury1 beginnt die Geschichte des sogenannten ontologischen Gottesbeweises2 – und mit dem Beginn dieser Geschichte hebt auch der Vorwurf gegenüber Anselms an, dieser habe einen philosophischen Taschenspielertrick in die Welt gesetzt. Geben wir zu Beginn dieses Kapitels das „unum argumentum“ zunächst ganz bewusst in der „trivialen Fassung“ wieder, mit und in der es berühmt bzw. berüchtigt geworden ist.
Proslogion II:
1 Der Tor vernimmt die Glaubensformel, der gemäß Gott als „etwas geglaubt wird, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“.
2 Obgleich der Tor Gott leugnet, versteht er diese Formel. Somit ist „etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“ in seinem Verstande qua Verstehen.
3 Der Tor muss deshalb zugeben, dass wenigstens in seinem Verstande „etwas ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“.
4 Wenn aber dieses „etwas …“ im Verstande sei, könne gedacht werden, dass es zusätzlich auch in Wirklichkeit existierte.
5 Etwas, das sowohl im Verstande als auch in Realität existiert, ist größer als etwas, das nur im Verstande existiert.
6 Existierte somit das „etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“ nur im Verstande, wäre es nicht das „etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“.
7 Der Tor widerspricht sich somit in seinem Leugnen Gottes selbst. Die vorliegende Beweisfigur wäre also eine „reductio ad absurdum“.
Proslogion III:
1 Von wahrer höchstvollkommener Existenz lässt sich nicht denken, dass sie nicht statthat.
2 Es lässt sich denken, dass es etwas gibt, das als nichtseiend nicht gedacht werden kann.
3 Seinsform (2) ist größer als diejenige Seinsform, deren Nicht-Sein gedacht werden kann.
4 Könnte also „dasjenige, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“, als nichtseiend gedacht werden, so wäre es nicht „dasjenige, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“.
5 Abermals widerspräche sich der Tor bei der Gottesleugnung. (reductio ad absurdum)
Die zeitgenössischen Darstellungen von Anselms Argument im „angelsächsischen Raum“ gehen zumeist über Proslogion II und III nicht hinaus.
Wir fügen hier zur Ergänzung noch Proslogion XV an. Das Argument lautet hier:
1 Gott ist „dasjenige über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“.
2 Es ist ein Wesen vorstellbar, das sogar „größer ist, als gedacht werden kann“.
3 Wenn Gott nur „dasjenige wäre, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“ und nicht auch „dasjenige, das größer ist, als gedacht werden kann“, wäre er – paradox gesprochen – nicht „das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“.
Meine Argumentskizze erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit – schon gar nicht auf sonderliche Präzision. Sie soll zunächst nur das übliche Verständnis Anselms darlegen. Dass Anselms Argument nicht so einfach sein kann, wie gerade ausgeführt, kann allein schon durch den Hinweis darauf klar werden, dass Anselms „unum argumentum“ in ein Gesamt vieler systematisch zusammenhängender Schriften eingebettet ist – und eben nicht nur aus den beiden Kapitelchen des Proslogions heraus verstanden werden kann. Die „angelsächsischen Interpreten“ ziehen leider nur in seltenen Fällen das Gesamtwerk Anselms für ihre Beurteilung heran.3 In Wahrheit ist Anselms Argument ein Argument mit großem gnoseologischen Einschlag. Es ist in seinem Fundament kein (modal)logisches Argument, sondern ein gnoseologisch-intentionalitätstheoretisches. Nur dann – so meine These, wenn man die gnoseologische Attitüde in Anselms Argument berücksichtigt, verliert dieses die Anrüchigkeit eines Taschenspielertricks. Der gnoseologische Einschlag von Anselms Argument zeigt sich zunächst darin, dass Gott in die Reflexion auf die Form unseres Wissens einbezogen gedacht wird – und zwar (und das ist der „Clou“) als begründendes Formmoment des Wissens. Dies heißt nichts anderes, als dass zu Beginn (!) von Anselms Argumentation im Proslogion Gott keineswegs schon ontologisch verhandelt wird. Der Ausgangspunkt des Proslogions ist mitnichten schon ein ontologischer Diskurs, sondern vielmehr ein implizit gnoseologischer, wie ein Blick in das frühere Monologion zeigt. Im Monologion wird die mens humana in der Tradition des Augustinus als „imago dei“ verstanden, allerdings in einem sehr starken normativen Sinne. Nur solche Vollzüge des Wissens, die sich (gemäß dem Ursprungs-Sollen) als „imago dei“ strukturieren, können überhaupt gültig bzw. geltungsdifferent sein. So parallelisiert Anselm etwa im Monologion Gottvater der memoria, Gottsohn der intelligentia und den Heiligen Geist dem amor.4 Diese im Umkreis des Augustinismus durchaus nicht gänzlich unbekannten Lehrstücke5 erhalten aber durch Anselm eine spezifische geltungslogische Nuancierung:
Der menschliche Geist ist nämlich für Anselm nicht etwa eine „verdinglichte imago“, die immer schon vorläge, sondern der menschliche Geist soll (und muss) seine Abbildungsfunktion immer erst vollziehen. Das Abbilden ist gesollt und von begründender Relevanz für die Geltungsverfasstheit endlicher Rationalität. Die imago konstituiert die Geltungsstruktur des menschlichen Geistes, insofern nach Kap. 67 des Monologions der menschliche Geist sich des höchsten Gutes erinnern soll (memoria – Gottvater), dieses erkennen soll (intelligentia – Gottsohn) und dieses in seinen Vollzügen grundsätzlich als Geltungsgrund anerkennen soll (amor – Heiliger Geist). Letztlich geht es bei dieser Erörterung Anselms darum, den menschlichen Geist innerhalb der Zeit als einen fassen zu können – und dies, obgleich die konkreten „actiones rationales“ des Menschen stets in der Zeit aufgesplittert sind. Die Möglichkeit der Einheit der endlichen ratio sieht Anselm primär in der (gesollten) Reflexivität6 des menschlichen Geistes fundiert. In der Reflexion wendet sich das Denken von seinen Weltreferenzen ab und referiert auf sich selbst. Damit hebt es die angesprochene Zersplitterung in die einzelnen Weltreferenzen der intentio recta auf (memoria – Gottvater). Es versucht seinen letzten Geltungsgrund als einen zu erkennen und damit zugleich seine eigene Einheit auszuweisen (intelligentia – Gottsohn) und es affirmiert und anerkennt seine ihm Einheit gebende Reflexivität aus keinem anderen Grund als dem, dass sie gesollt ist (amor – Heiliger Geist). Das heißt präzise: Nur dann, wenn der menschliche Geist sich selbst als eine Struktur zu denken vermag, die über eine genuine eigene Bestimmtheit verfügt, die sich nicht dem jeweils wechselnden kontingenten Weltinhalt verdankt, den das Denken je und je „zersplittert“ temporal intendiert, weist er sich auch als eine solche eine ursprüngliche Eigenbestimmtheit7 aus. Anselm hat nämlich begriffen, dass es eine eigene Bestimmtheit der endlichen Rationalität geben muss, die nicht in die einzelnen zeitlichen Vollzüge zersplittert werden darf. Nur wenn es die endliche ratio selbst neben ihren einzelnen zersplitterten temporalen Vollzügen gibt, kann deren invariante Eigenbestimmtheit Prinzipienfunktion für diese einzelnen temporalen Wissensvollzüge übernehmen. Die Reflexivität der endlichen ratio ist konstitutiv für die begründungsfähige Invarianz der endlichen mens. Zugleich ist jedoch diese Reflexivität daran gebunden, Abbild (imago) zu sein – sie kann nur begründend als endlicher Grund fungieren, wenn und indem sie Abbild eines absoluten Grundes ist, über den sie unter keinem denkbaren Aspekt verfügen kann. Auf dieser Bühne8 mit deren spezifischen Kulisse spielt sich auch jene berühmt-berüchtigte Szene ab, in welcher der Tor darauf insistiert, dass „dasjenige, über das Größeres hinaus nicht gedacht werden könne“ nur im Verstande sei und nicht auch in Wirklichkeit. Der Tor erweist sich also als Tor aufgrund der offensichtlichen inneren Widersprüchlichkeit seiner Aussage. Diese oftmals als „reductio ad absurdum“ bezeichnete Argumentation hat viele Anfeindungen und vor allem den Vorwurf, ein „Taschenspielertrick“ zu sein, über sich ergehen lassen müssen. Diese Anfeindungen beruhen meines Erachtens auf einem Missverständnis. Anselm verfolgt in seinem Argument eine uralte, von Aristoteles inaugurierte Methode des Ausweises letzter logischer Prinzipien. Er wendet die Methode der Elenktik an. Sein Argument im Proslogion hat weniger die korrekte Form einer logischen „reductio“, sondern operiert viel eher mit der aristotelischen „Methode“ der Elenktik, wie sie sich in der „Metaphysik“ findet. Der Stagirite lehrt ja bekanntlich in der Metaphysik9, dass derjenige, der den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch bestreiten wolle, diesen schon zum Zwecke einer logisch-konsistenten Bestreitung voraussetzen müsse. Die Elenktik ist jedoch nur bei Formprinzipien der Denkens als Ausweismethode zulässig – bezogen auf externe Gegenstände des Denkens kann sie allenfalls per nefas Anwendung finden. Genau diesen Fehler scheint nun aber Anselms Argument zu begehen. Dieser Vorwurf einer ungerechtfertigten Anwendung der Elenktik an Anselm begreift jedoch nicht, dass die elenktische Methode von Anselm „sachgerecht“ ausschließlich auf die Formdimension des Wissens angewandt wird, nämlich auf die mens humana in ihrer Bestimmheit als „imago dei“. Die elenktische Methode, die Anselm anwendet, bezieht sich also keineswegs auf den absoluten Grund (= Gott) selbst, sondern eben nur auf den endlichen Grund, d. h. die „imago“. Nur wenn ein Wissen gemäß der „imago“ geformt ist, kann es geltungsdifferent sein. Denn die logischen und semantischen Prinzipien, die unser Wissen als geltungsvalent konstituieren, sind in den Augen Anselms nur dann letztgültige Formprinzipien, wenn sie ein Abbild des dreieinigen Gottes sind. Die Bestreitung der Formansprüche dieser „imago“ durch das Denken würde deshalb in den Augen Anselms genau den aristotelischen Selbstwiderspruch erzeugen. Denn die „imago“ ist die Gültigkeit garantierende Form des endlichen Denkens. Dieser Argumentationsteil ist damit anderseits aber keinesfalls als solcher bereits der Ausweis, dass Gott ist. Erst in einem letzten Schritt zeigt Anselm auf, dass die mens humana in ihrer Verfasstheit als „imago dei“ zwar notwendiger aber nicht hinreichender Grund des Wissens ist. Der letzte Argumentationsschritt zeigt auf, dass die mens humana genau dies ist, was sie ist – nämlich ein endlicher Grund qua Abbild des absoluten Grundes. Die mens humana ist aber mitnichten (auch nicht in ihrer Formbestimmtheit als „imago“) dieser absolute Grund selbst. Erst der Nachweis, dass die mens humana nur dann qua „imago“ als endlicher Formgrund fungieren kann, wenn sie Abbild des absoluten Seins ist, ist zugleich der Ausweis, dass Gott ist. Dieser letzte Überschritt nun aber verdankt sich unter keinen Umständen mehr irgendeiner Elenktik oder irgendeiner „reductio“, sondern er ist in dem fundiert, was Anselm „fides“ nennt. Das recht verstandene Argument Anselms involviert Gott (und sei es auch nur zunächst) in die Begründungsreflexion des Wissens – ist also in seinem Kern gnoseologisch. Wenn wir das ganze Beweiskonzept Anselms in einer technischen Sprache charakterisieren wollen, so ist zu sagen, dass in Anselms Argument ein elenktischer und ein regressiver Bestandteil kombiniert sind. Die Bedeutung des elenktischen Teils haben wir schon in etwa dargelegt. Insofern die Prinzipien der erkennenden Subjektivität durchaus eine Eigenbestimmtheit qua „imago dei“ aufweisen, können sie ausgewiesen werden, indem man dem sie bestreitenden Tor nachweist, dass er diese für sein „Bestreitenkönnen“ schon voraussetzt. Der regressive Teil besteht nun in einer Art „Schluss“ auf die beste Erklärung qua Schluss auf die einzig mögliche Erklärung.10 Wenn man etwa im Sand – um ein einfaches Beispiel zu bemühen – geometrische Gebilde eingezeichnet entdeckt, so besteht die vernünftigste Annahme in der Meinung, rationale Wesen – wahrscheinlich Menschen – hätten diese Gebilde in den Sand gezeichnet. Die Erklärung der Urheberschaft durch Menschen ist jedenfalls vernünftiger als etwa die Erklärung der Urheberschaft durch Außerirdische. Dieser „Wahrscheinlichkeitsschluss“ kann aber niemals mit Sicherheit ausschließen, dass diese Gebilde nur durch einen grandiosen Zufall von den Naturgewalten unabsichtlich erzeugt wurden. Um von einem gegebenen begründungsbedürftigen X sicher auf dessen Grund zurückschließen zu dürfen, müssten mindestens folgende vier Bedingungen statthaben:
„(1) Der aufgestellte Grund muss nachweislich die Möglichkeit des Begründeten hinreichend erklären.
(2) Der aufgestellte Grund muss in einem nachweislich logisch korrekten Verfahren ermittelt worden sein.
(3) Es muss bewiesen sein, dass das Begründete wirklich begründungsbedürftig ist – also notwendig noch eines externen Grundes zu seiner Möglichkeit bedarf.
(4) Es muss möglich sein, auszuschließen, dass es noch einen weiteren denkbaren Grund geben könnte, der das Prinzipiat in seiner Möglichkeit ebenfalls vollständig erklären könnte.“11
Aus Gründen, die wir in diesem Rahmen nicht darlegen müssen, kann es niemals eine begründungstechnische Situation geben, in der alle vier Bedingungen erfüllt sind. Somit ist der regressive Rückschluss stets ein Wahrscheinlichkeitsschluss, der Graden rationaler Bewertung offensteht. Das Begründungsbedürftige ist im Falle von Anselms Argument die geltungsrelevante Intentionalität der menschlichen Erkenntnis. Da Anselm der endlichen ratio nicht zugestehen will, selbst letzter Grund ihrer selbst zu sein, muss er den letzten Grund als einen ontologischen denken. Denn Anselm ist noch nicht in der Lage (wie Jahrhunderte später Kant) logische Prinzipien zugleich als gegenstandskonstitutierende Prinzipien zu denken. Wir befinden uns in der Epoche des Mittelalters. Anselm hätte damit folgende Disjunktion als vollständig für die „theoretische Geltung“ anerkannt. Entweder ist ein Prinzip ein logisch-semantisches Prinzip – oder es ist ein ontologisches Prinzip. Tertium non datur. Semantisch-logische Prinzipien können elenktisch ausgewiesen werde, ontologische mit regressiver Methodik. Da nun die „imago“ (qua logisch-semantisches Formprinzip) kein letzter Grund sein kann, muss dieser letzte, auch die „imago“ ermöglichende Grund, ein ontologischer sein. Für ontologische Gründe muss der „regressive Diskurs“ gewählt werden. Diese regressive Methodik kann jedoch niemals dieselbe formale Überzeugungskraft gewinnen wie die elenktische. Sie erzeugt „nur“ die rational beste Annahme. Damit ist aber auch gesagt, dass die fides nicht eine Art Glaubensgewissheit oder „modernere“ existenzialistische Gewissheit sein kann, sondern dass es sich bei dieser um ein ausschließlich rationales Verfahren handelt. Beachten wir diese beiden Aspekte der „Elenktik“ und der „Regressivität“, so können wir Anselms Argument als ein Kompositum beider Aspekte begreifen. Elenktisch ist das Argument, denn es beharrt darauf, dass die eigenbestimmten Prinzipien der endlichen ratio nur durch Selbstwiderspruch im Wissen bestritten werden können. Regressiv ist das Argument, da die Bestimmtheit der letzten Formverfasstheiten des Wissens nur als Abbildfunktionen des als absolut auszuweisenden ontologischen Grundes verstanden werden können. Vertiefen wir dies mit einem Blick ins Monologion. Um die dortigen Ausführungen Anselms adäquat würdigen zu können, ist es wichtig, zunächst zu begreifen, dass für Anselm die Urform des Urteil(en)s das Werturteil12 darstellt. Kienzler hat darauf verwiesen, dass nach Anselm jede actio rationalis – auch das auf Wahrheit zielende Urteil – ein „Werten“ sei.13 Im Monologion schreibt Anselm in diesem Zusammenhang folgende Zeilen:
„Es ist ganz gewiß und allen, die aufmerken wollen, einleuchtend, daß welche Dinge immer als etwas ausgesagt werden, daß sie zueinander mehr oder weniger oder gleich ausgesagt werden, durch etwas ausgesagt werden, daß nicht ein anderes, sondern als dasselbe in den verschiedenen Dingen verstanden wird. […] Da es also sicher ist, daß alle guten Dinge, wenn sie miteinander verglichen werden, entweder gleich oder ungleich gut sind, ist es notwendig, daß alle durch etwas gut sind, das als dasselbe in den verschiedenen guten Dingen verstanden wird, […]“. (M 41 / 43)
Ein Werturteil ist nun aber stets und notwendig auf einen Maßstab seines Wertens bezogen. Anselms Grundform geltungsvalenter Rationalität ist das „iudicare“. Alles Gültige erreicht seine Gültigkeitsbetroffenheit durch Entsprechung zu einem Sollen. Im 5. Kapitel von „De veritate“ unterscheidet Anselm zunächst zwischen der „actio naturalis“ und der „actio rationalis“. Das Subjekt einer „actio naturalis“ kann nicht gegen das Sollen verstoßen, ohne seinen ontologischen Status zu verlieren – also ohne aufzuhören, z. B. „Feuer zu sein“. Eine actio rationalis hingegen unterliegt einem gedoppelten Sinn von „Sollen“. In De veritate erläutert Anselm dies anhand der wahren Aussage.14 Eine wahre Aussage hat zunächst einem ersten, ursprünglichen Sollen zu genügen. Entspricht sie diesem Sollen nicht, so ist sie keine wahrheitsrelevante Aussage.15 Anselms Pointe besteht hier darin, dass dieses Entsprechen gegenüber dem Sollen die Aussage derart konstituiert, dass sie hierdurch überhaupt erst inhaltlich wahr oder falsch sein kann. Jedoch stellt dieses Ursprungs-Sollen keineswegs sicher, dass die Aussage auch inhaltlich wahr ist. Ein zweites Sollen verlangt nun von der Aussage darüber hinaus, sie solle inhaltlich wahr sein. Der Verstoß gegen dieses Sollen macht die Aussage jedoch aber keineswegs sinnlos bzw. zu einem bloßen „Nichts“. Anselm hat damit mit den Mitteln seiner mittelalterlichen Terminologie den Unterschied von inhaltlicher Wahrheit (oder auch Falschheit) und Geltungsvalenz der Aussage erkannt. Dass Anselm mit dieser Sicht systematisch relativ aktuell ist, mag der Hinweis auf eine bedeutend gewordene Kantmonographie von Gerold Prauss (Erscheinung bei Kant. Ein Problem der „Kritik der reinen Vernunft“, Berlin 1971, bes. 81 – 101; 198 – 253) illustrieren. Prauss zeigt in dieser Arbeit, dass Kant nicht etwa nur die Möglichkeit wahrer Erkenntnisurteile begründen wollte, sondern eben auch die Möglichkeit des (im Grunde viel schwerer erklärbaren) falschen Erkenntnisurteils aufzeigen wollte. Es ging Kant – so Prauss – um die apriorischen Prinzipien der Wahrheits-Differenz, nicht aber um die Prinzipien faktisch wahrer, inhalticher Erkenntnis.
Für Anselm ist es philosophisch die plausibelste Lösung, diesen Wertmaßstab im „Summum Bonum“ zu finden. Der Clou der Anselm’schen Operation jedoch, der die Ontotheologie Anselms von ähnlich klingenden Theoremen Augustins unterscheidet, liegt nun darin, dass das Summum Bonum als Konstitutionsprinzip der kognitiven Relation gefasst wird. Jedes Gute ist sowohl durch eine interne Werthaftigkeit als auch durch eine externe Werthaftigkeit ausgezeichnet. Ein schnelles, edles Pferd ist sowohl in sich ein Gut (= interne Werthaftigkeit) als auch ein Gut für denjenigen, der das schnelle Pferd benutzen will (= externe Werthaftigkeit). Während die interne Werthaftigkeit dem Bereich der Objekte, der Welt, zuzuordnen ist, muss die externe Werthaftigkeit auf das (be)urteilende Subjekt bezogen werden. Sofern aber nun das „Summum Bonum“ letztes Abschlussprinzip sowohl der internen Werthaftigkeit als auch der externen Werthaftigkeit sein soll – und insofern beide Typen der Werthaftigkeit jeweils „Objekt“ und „Subjekt“ konstituieren –, stellt das Summum Bonum zugleich auch das letzte Prinzip, das Abschlussprinzip der kognitiven Relation dar. Eine solche Interpretation, die die Beziehung von interner und externer Werhaftigkeit des „Gutes“ als Basis für die Konstitution der kognitiven Relation auslegt, hat insbesondere Kienzler16 vorzuschlagen. Er hat (a. a. O., 86 f.) „energisch“ deutlich gemacht, dass das Summum Bonum identisches Prinzip des einen Bewertungsreiches sei. Wenn nämlich das Urteilen ein Werten darstellt, dann ist Gegenständlichkeit dadurch ausgezeichnet, dass sie ein eines Reich von „werthaften bewertbaren Objektiven“ darstellt. Subjektivität hingegen lässt sich als jene eine einheitliche Region kennzeichnen, die origo aller konkreter endlicher Seinsbewertungen ist. Neuzeitlich gesprochen: Sowohl die „Einheit der Subjektivität“ als auch die Einheit der Gegenständlichkeit/Welt wird durch das Summum Bonum konstituiert. Was Anselms Überlegungen prinzipientheoretisch interessant macht, ist das Vorausahnen „transzendentaler Prinzipien“ im Sinne der neuzeitlichen Transzendentalphilosophie. In der Transzendentalphilosophie Kants werden die invarianten Bestimmtheiten des Erkennens als diejenigen Prinzipien gefasst, die auch den Gegenstand (bzw. gegenständlichen Sinn) konstituieren. Das menschliche Erkennen setzt nach Kant seine Bedingungen, die es dem Gegenstand stellt, in Anschauung und Denken selbst durch. Eine solche Lösung liegt natürlich „denktechnisch“ noch weit von den Möglichkeiten Anselms entfernt. Für Anselm besteht nur die schon angesprochene Disjunktion zwischen Prinzipien der Eigenbestimmtheit des Denkens im Sinne von logisch/semantischen Prinzipien einerseits und ontologischen Prinzipien andererseits. Da nun Anselm aber die für seine Epoche höchst progressive Einsicht gewonnen hat, dass die Prinzipien des Denkens irgendetwas mit der Gegenstandskonstitution zu tun haben könnten, steht er vor einem systematischen Problem: Einen solchen Gedanken nämlich vermag er nur dann konsequent zu denken, wenn man logische und ontologische Prinzipien in einen Zusammenhang bringen könnte. Es müsste die systematische Möglichkeit bestehen, logische und ontologische Prinzipien in einem letzten Grund „konvergieren“ zu lassen, ohne dass dabei beide Prinzipientypen ihren genuinen Begründungsplatz einbüßten. Genau dieses Grundkonzept prägt Anselms Ontognoseotheologie. Die gesamte Argumentationskette beruht nämlich darauf, zuerst in einem elenktischen Verfahren die logischen und semantischen Prinzipien des Denkens zu ermitteln. In diesem Begründungsgang bleibt das endliche Denken „absolut eigener Herr“ seiner Begründungen. Völlig zurecht verweist ja Kienzler17 darauf, dass in den ersten drei Kapiteln des Monologions die Forderung an das Summum Bonum, es müsse ein unum sein, ganz allein aus der endlichen Immanenz des Denkens selbst erfolge. Solange sich die Reflexion innerhalb dieser Denknotwendigkeit bewegt, befinden wir uns in der immanenten und autochthonen Formdimension des endlichen Denkens. Dieses verlangt aufgrund seiner ureigensten Formnotwendigkeit danach, dass das Summum Bonum ein unum sein müsse. Denn wenn das Denken als urteilendes Werten notwendig ein unum sein muss (und auch sein soll), muss der Bewertungsmaßstab, auf den hin es ein unum ist, selbst ein unum sein. Erst im vierten Kapitel „schleudert „(Kienzler) sich das Denken quasi aus seiner eigenen Begründungsautarkie heraus, indem Anselm aufzuzeigen vermeint, dass das Summum Bonum, nur als „Idee“ des endlichen Denkens betrachtet, keinesfalls ein unum sein könne.
„Denn wenn die Unterscheidung solcher Rangstufen so unendlich ist, daß da kein höherer Rang ist, über dem sich nicht ein anderer höherer fände, so wird die Vernunft dazu geführt, daß die Vielheit dieser Naturen durch kein Ende abgeschlossen wird. […] Es gibt also mit Notwendigkeit eine Natur, die einer oder mehreren so überlegen ist, daß es keine gibt, der sie untergeordnet wäre.“ (M 49)
Anselms Argument beruht darauf, dass das endliche Denken immer wieder in der Lage ist, zu jedem von ihm „gesetzten“ Seinsrang, noch einen höheren zu denken. Ein Abschluss ist dem Denken im Rahmen einer solchen endlichen „Vollkommenheitsiteration“ offenkundig nicht möglich. Deshalb muss das Summum Bonum, wenn es ein „unum“ soll sein können, als ein „ist“ gefasst werden – und eben nicht nur als so etwas wie eine „Idee“. Denn für eine Idee, die das endliche Subjekt selbst „erzeugt“ hätte, wäre ein funktionales stets mögliches „Weiter-steigern-Können“ der „Rangunterschiede“ ausreichend. Anselm lehnt nun aber ganz deutlich ein endlich-funktionales „Immer-erneut-steigern-Können“ als unvereinbar mit der Unizität des Summum Bonum ab. Würde es die Unizität des Summum Bonum nicht geben, wäre es in Anselms Augen auch unmöglich, das endliche Denken als ein unum zu fassen. Wenn also das Denken kraft seiner ihm eignenden Verfasstheit darauf beharren muss, ein unum zu sein – und wenn diese Forderung nur eingelöst werden kann, wenn ein dem Denken gegenüber unverfügbares unum qua „Summum Bonum“ statthat, so muss sich das endliche Denken „von sich abstoßen“ und sich in diesen von ihm unabhängigen absoluten Grund transzendieren (Kienzler). An dieser Stelle gilt es aber einem Missverständnis vorzubeugen. Die Frage nach dem „maius“, das Argumentationsgrund im Proslogion werden wird, sowie die Debatte der Vollkommenheitssteigerung im Monologion zielen nicht schlicht auf die Behauptung bloßer „Seinsstufen“.18 Vielmehr ist das „maius“ nach Anselm terminologisch fixiert als Glied einer Begründungsrelation.19 In Monologion 49 können wir lesen:
„Denn was immer durch ein anderes groß ist, ist geringer als das, wodurch es groß ist.“
Maius ist also die Relation von Grund und Begründetem, wobei der Grund „maius“ gegenüber dem von ihm Begründeten (= minus) ist. Das Maius des Denkens ist dessen Grund. Wenn das Denken dasjenige denkt, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, so denkt es seinen notwendigen und vollständigen Grund. Denken ist für Anselm nun aber in prominenter Weise als Fähigkeit gefasst, „Sein im Verstande“ von „Sein im Verstande und in Wirklichkeit“ unterscheiden zu können. Dieses Unterscheidenkönnen kennzeichnet die Intentionalität des Denkens. Anselms Theorie der Erkenntnis billigt also dem Denken selbst die Fähigkeit zu, zwischen „Sein im Verstande“ und „Sein im Verstande und in Wirklichkeit“ aufgrund eigener Kompetenz unterscheiden zu können.20 Wenn somit nach dem letzten Grund der Fähigkeit des Denkens, zwischen „Sein im Verstande“21 einerseits und „Sein im Verstande und in Wirklichkeit“ andererseits unterscheiden zu können, gefragt wird, so muss diese Frage auf einen Grund zielen, der diese Differenzierung letztermöglicht. Jener Grund aber, der die bezeichnete Unterscheidung ermöglicht, kann zunächst nur ein solcher sein, der einer derartigen (kontingenten) Unterscheidung von SiV und SiVW gerade nicht unterliegt. Denn kein Grund kann „gleichsinnig“ derjenigen Alternative unterliegen, die er allererst eröffnet. Somit müsste der Grund der kontingenten Unterscheidung von SiV und SiVW ein Grund sein, der entweder alternativlos (notwendig) ausschließlich ein SiV oder alternativlos (notwendig) ein SiVW darstellt. Das SiVW kann nun offenkundig schon per definitionem kein alternativloses SiV darstellen. Also wäre zunächst die Frage dringlich, ob es ein alternativloses SiV geben kann, das Grund der Unterscheidung von SiV und SiVW sein könnte. Als Kandidat für ein alternativloses SiV kämen offenkundig das „Denken selbst“ oder aber bestimmte (einzelne) Gedanken des Denkens in Frage. Allerdings erweist sich diese Konzeption schon sehr schnell als wenig attraktiv. Einerseits hat ja Anselm – wie gesehen – strikt die Möglichkeit zurückgewiesen, eine „Idee“ (= irgendein Gedanke) des endlichen Denkens könne die Funktion des letzten Grundes übernehmen. Andererseits ist das „Denken selbst“ in seinen Vollzügen – insbesondere, wenn es sich reflexiv auf sich selbst wendet – seinerseits ein SiVW.22 Aus unserer Problemexposition ist jedoch eindeutig sofort ersichtlich, dass das Denken in seinem Status als (auch) SiVW keinesfalls ein geeigneter Kandidat für den letzten Abschlussgrund zu sein vermag. Denn es unterliegt ja sehr wohl der kontingenten Alternative beider Seinsarten. Die Seinsrealität der Prinzipien des Denkens (= SiVW) hängt von ihrem jeweiligen „Vollzogenwerden“ in den einzelnen Gedanken ab. Gedanken aber können vollzogen werden (= kontingentes SiVW), sie müssen es aber nicht (= kontingentes SiV). Damit unterliegt endliches Denken eo ipso der Disjunktion SiV und SiVW. Kann nun das extramentale Seiende als alternativloser Grund angesehen werden? Auch diese Mutmaßung ist schon sehr bald als falsch zu entlarven. Denn auch das Weltsein unterliegt ganz offenkundig der Alternative von SiV und SiVW. Weltsein muss nicht eo ipso gewusst werden, so dass ihm prinzipiell die Seinsform des SiV mangeln kann. Vor allem tritt jedoch jedes kontingente Weltsein zu einem Zeitpunkt t1 allererst ins Sein und tritt zu einem Zeitpunkt t1+n wieder aus diesem heraus. Sowohl vor t1 als auch nach t1+n ist jedes extramentale Sein bestenfalls ein SiV – und unterliegt somit evidenterweise der Alternative von SiV und SiVW. Ganz offenkundig also unterliegt das kontingente Weltsein der kontingenten Alternative von SiV und SiVW und ist deshalb nicht der gesuchte nichtkontingente (notwendige) alternativlose Grund. In diesem Zusammenhang hat Riesenhuber in einem exzellenten Aufsatz darauf hingewiesen, dass eine ontologische Entfaltung des letzten Grundes in Form des ens necessariums oder ens perfectissimums ebenfalls nicht den Erfordernissen des letzten Grundes gerecht würde. Er schreibt (a. a. O., 50):
„Das Argument zielt daher auf die Behauptung eines absolut Seienden, stützt sich dabei aber nicht auf den Begriff eines […] ens necessarium […] oder ens perfectissimum, […] sondern auf das Denken als solches. […] Wäre nämlich das Wesen des ‘aliquid’ als ‘notwendig existent’ bestimmt, so würde dem Denken ‘notwendige Existenz’ als objektive Denkbestimmung zu denken aufgegeben. Das Denken wäre damit von außen, nämlich durch einen im Denken als solchem nicht unmittelbar vorfindlichen, für das Denken beliebigen Begriffsinhalt bestimmt. […] Aus sich selbst müsste also das Denken diesen Begriff wie jeden anderen, der ihm innerhalb seines Intentionsfeldes als beliebiges Objekt gegeben wird, der Doppelmöglichkeit von […] Existenzbehauptung und […] möglicher Existenzverneinung unterwerfen. Daher bedürfte das Denken gegenüber einem solchen für es beliebigen Objekt eines von sich selbst verschiedenen Kriteriums, um über seine Wirklichkeit entscheiden zu können.“
Denn bezogen auf das „ens necessarium“ oder das „ens perfectissimum“ müsse das Denken immer noch prüfen, ob diese jeweils ein SiV oder ein SiVW aufwiesen. Als Intendierte der intentio recta unterlägen sie somit denkimmanent durchaus der kontingenten Alternative von SiV und SiVW. Nachdem das endliche Denken offenkundig in seiner Selbstergründung scheitert (scheitern muss), transzendiert es sich selbst aus seiner – notabene! – inneren Logik heraus in den absoluten Grund, über den es jedoch nicht verfügen kann. Der regressive Argumentationsteil beginnt. In diesem Argumentationsteil wird von Anselm versucht, die rational bestmögliche Annahme darüber zu erlangen, wie dieser alternativlose Grund verfasst sein müsse. Die Tatsache, dass alles Endliche der Alternative SiV und SiVW unterliegt, ist der Zeitbetroffenheit des Endlichen geschuldet. Die Zeitlichkeit ist der Grund dafür, dass einem endlichen Seienden überhaupt widerspruchsfrei SiV und SiVW prädiziert werden kann. Das Bild des Malers hat zunächst ein SiV in der Imaginationskraft des Künstlers. Nach seiner Herstellung kommt ihm das SiVW zu. Nach seiner eventuellen Zerstörung durch Feuer fällt es in das SiV zurück. Ohne Zeit müssten beide alternativen Seinsformen dem Bild in widersprüchlicher Weise zuerkannt werden. Im „Umkehrschluss“ heißt dies: Der alternativlose Grund der Seinsunterscheidung von SiV und SiVW kann folglich nur ein alternativloses nichtkontingentes (notwendiges) SiVW sein. Diese Eigenschaft kann ihm aber nur dann zukommen, wenn er keine Zeitnatur aufweist. Nur als Abbild jenes zeitlosen letzten Grundes können die Prinzipien der endlichen ratio deshalb eine formale Invarianz gegenüber allen „actiones rationales“ erreichen – und als bedingt notwendige, aber eben nicht als notwendige und hinreichende Gründe (= absolut notwendige Gründe) der Erkenntnis fungieren. Als Formen der endlichen ratio unterliegen sie – wie gesehen – im ontologischen Sinne doch der „Alternative“. Die Erkenntnisprinzipien der „imago“ sind identische und invariante Formbestimmungen in allen „actiones“. Diese Invarianz verdankt sich dem Umstand, dass sie Abbild des unveränderlichen, absoluten Grundes sind. Sie selbst aber können immer nur relational zu den zeitlichen Vollzügen der endlichen ratio im Sinne von SiVW invariant sein. In sich selbst sind sie nicht „ontologisch“ invariant, sondern treten immer nur kontingent ins „Sein“ bei Gelegenheit der „actiones rationales“. Prinzipen gibt es nicht ohne ihre Prinzipiate. Die Prinzipien der mens sind invariant nur in dem beschriebenen logisch-gnoseologischen, relationalen Sinne, dass sie stets dieselben Prinzipien bezogen auf alle geltungsbetroffenen zeitlichen Operationen der mens sind. Da sie allerdings nicht ohne ihr jeweiliges Fungieren an den konkreten Prinzipiaten (= den jeweiligen konkreten, temporalen actiones rationales) quasi ontologisch für sich subsistieren, sind auch sie als solche in einer ontologischen, nicht logisch-gnoseologischen Perspektive zeitlich zersplittert. Im absoluten Grund hingegen, dessen Abbild die endliche ratio in ihrer invarianten gnoseologischen Formbestimmtheit nur sein kann, müssen formale und ontologische Invarianz in unbedingter, absoluter Weise konvergieren.23 Das heißt, der absolute Grund ist im ontologischen Sinne die Unveränderlichkeit des „Seins selbst“. Der letzte Grund ist das ipsum esse, dessen Wesen zugleich das Sein ist. Noch haben wir in diesem regressiven Begründungsgang eine letzte Pointe nicht angesprochen. Diese besteht in der Notwendigkeit, das Absolute aus der endlichen Begründungsstruktur zu befreien. Hans Wagner und Werner Flach24 machen auf eine spezifische Struktur endlicher Begründungsverhältnisse aufmerksam. Zwar begründe der endliche Grund das von ihm Begründete einseitig. Andererseits stünden Grund und Begründetes in endlichen Begründungsverhältnissen in der Relation der wechselseitigen Bedingtheit zueinander. Ohne Begründetes gibt es keinen Grund – genauso, wie es ohne Grund kein Begründetes gibt. Der absolute Grund darf deshalb keinesfalls durch das von ihm Begründete bedingt sein – denn er würde dadurch seine Absolutheit einbüßen. Sehr wohl ist jedoch der endliche Grund qua „imago“ durch sein Begründetes bedingt. Denn ohne actiones rationales, die ihn jeweils auch „bedingen“, hat er keine Geltungsrelevanz. Aber – er ist eben nur „imago“. Dasjenige höchste Sein jedoch, das er abbildet, unterliegt nicht mehr endlichen Begründungsverhältnissen, sondern ist durch ontologische und gnoseologische Aseität gleichermaßen ausgezeichnet. Genau deshalb kann Anselm nun auch formulieren:
„Herr, Du bist also nicht nur, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, sondern, Du bist etwas Größeres, als gedacht werden kann.“ (P 110)
Die Erfassung dieses absoluten Grundes jedoch kann nur durch eine Art „negative Theologie“ erfolgen. Erst nach dieser Rekonstruktion scheint es möglich zu werden, die zentralen systematischen Passagen des Proslogions systematisch einzuordnen. Proslogion II beabsichtigt nachzuweisen, dass der höchste Gedanke des Denkens derjenige ist, mit dem dieses auf seinen notwendigen und zureichenden Grund referiert. Dieser Grund des Denkens ist Grund dafür, dass das Denken zwischen SiV und SiVW zu unterscheiden vermag. Mit Mitteln der Elenktik wird gezeigt, dass der Grund ein alternativloses (für das Denken notwendiges) invariantes SiVW sein muss, das nicht ohne Widerspruch weggedacht werden kann. Proslogion II zeigt also, dass der letzte Grund des Denkens relational zu dessen Vollzügen alternativlos invariant qua SiVW sein muss und deshalb auch nicht ohne Widerspruch „weggedacht“ werden kann. Proslogion III qualifiziert die Notwendigkeit und Alternativlosigkeit genauer. Ein Grund, der nur bei Gelegenheit der „actiones rationales“ alternativlos und invariant notwendig fungieren müsste, wäre immer noch ein letztlich kontingenter Grund, der im Sinne Anselms keine Abschlussbegründung unserer Intentionalität leisten könnte. Der letzte Grund muss absolut notwendig, zureichend und „in sich“25 invariant sein. Er muss ein absolut notwendiges SiVW darstellen. Dies heißt für Anselm nichts anderes, als dass der gnoseologisch notwendige Grund des Denkens, der in Proslogion II ausgewiesen wird, ein solcher gnoseologisch notwendiger Grund nur dann sein kann, wenn er eodem actu auch ontologisch notwendiger letzter Grund ist. Diese Verfasstheit des letzten Grundes, gleichermaßen letzter gnoseologischer und ontologischer Letztgrund sein zu müssen, meint Anselm noch elenktisch ausweisen zu können. Da aber unter endlichen Bedingungen kein absolut notwendiger und in sich selbst absolut invarianter Grund des Denkens ausweisbar ist, leitet Proslogion III zum regressiven Teil des Argumentes über. Im Proslogion selbst kulminiert dieser regressive Begründungsteil im XV Kapitel, in dem Anselm nachweist, dass ein absolut notwendiger, zureichender und invariant alternativloser Grund des Denkens „größer als gedacht werden kann“ sein muss – also nicht in die endliche Begründungsrelation von Grund und Begründetem eingebunden sein kann. Die von uns in Anselms Sinne aufgezeigte Konvergenzreflexion von unbedingten gnoseologischen und ontologischen Gründen findet sich allerdings erst in der Antwort an Gaunilo expressis verbis, die wir im nächsten Abschnitt diskutieren werden.
1.1.1.2 Gaunilos Anselmkritik
Anselms Argument26 fand in Gaunilo27 seinen ersten prominenten Kritiker. Ein erster Angriff wendet sich gegen Anselms vermeintlich nicht durchgeführte Unterscheidung zwischen der sinnbezeichnenden und sinnproduzierenden Funktion des Denkens (63 f.). Nur was wirklich semantisch verstehbarer Sinn sei, könne ein SiV darstellen. Mit der sinnbezeichnenden Funktion des Denkens könne sehr wohl Unsinn bezeichnet werden, der, weil er nicht verstanden werden könne, kein SiV erreiche. So kann man – um ein Beispiel zu geben – mit der sinnbezeichnenden Funktion ein solches „Ungebilde“ wie „Nachts ist es kälter als draußen“ bezeichnen. Aufgrund der offenkundigen Unsinnigkeit dieses Gebildes käme diesem keinerlei SiV zu. Nach Gaunilos Verständnis kann etwas letztlich nur dann ein SiV erreichen, wenn zuvor dessen extramentale Existenz begriffen wird. Eine solche Sicht der Dinge verunmöglichte aber Anselms Argument, das ja von einem exklusiven SiV auf dessen „Realexistenz“ schließen wolle.
Ein anderes inneres Problem von Anselms Argument bestehe in einer Art inneren Inkohärenz. Der insipiens solle doch dadurch vom „Ist“ Gottes überzeugt werden, indem gezeigt wird, dass er einen Widerspruch begehe, wenn er Gott nicht als realexistent denke. Gaunilo legt dies im Sinne von Thomas später eingeführten „per se notum“ aus. Aus dieser Sicht resultiert nun auch der Vorwurf an Anselm. Wenn man Gott als „per se notum“ fasse, so könne man ihn gar nicht anders denn als realexistent fassen. Wie könne aber dann der Tor überhaupt den Widerspruch begehen und Gott als nichtexistent denken? (65)
Aber auch das von Anselm reklamierte „Sinnverstehen“ sei nicht ohne Problembelastung. Denn es sei ja zumindest keineswegs eine selbstverständliche Annahme, dass man Sinnvolles eo ipso von Unsinnigem scheiden könne. Bei einem Satz wie „Nachts ist es kälter als draußen“ mag der Un-Sinn offenkundig sein. Doch es gibt andere Widersinnigkeiten, die nicht so schnell zu entlarven sind. So ist etwa die Annahme einer höchsten Geschwindigkeit nicht prima facie widersinnig. Erst bei der Analyse dieses Begriffes stelle sich der Widersinn heraus. (Hierbei ist zu beachten, dass die Entdeckung der „Nicht-Überbietbarkeit“ der Lichtgeschwindigkeit kein Argument sein kann. Denn ich kann mir ja durchaus eine höhere Geschwindigkeit als die Lichtgeschwindigkeit denken.) Anselms Voraussetzung, man könne stets sicher Sinn von Un-Sinn scheiden, erweist sich als angreifbar – und nur diese Voraussetzung andererseits ermöglicht das Konstrukt eines „SiV“.
In Konsequenz dieses Argumentes hält Gaunilo Anselm nun auch vor, die Zweckrelation mit der erkenntnisrelevanten Gegenstandsrelation zu verwechseln (65 f.). Gebe ich mir einen Zweck vor, den ich dann noch verwirklichen will, so ist die Differenzierung von erst SiV und dann SiVW nachvollziehbar. Denn in diesem Falle ist der bezweckte Gegenstand so etwas wie ein Produkt meiner Seele. Anders ist doch aber offenkundig die Lage, wenn mir etwas erst als Gegenstand zum Erkennen vorgelegt wird. Erst wenn ich den Sinn des vorgegebenen Seins erfasst habe, kann diesem noch sein SiV zuerkannt werden. Ein umgekehrtes Verhältnis wird von Gaunilo zurückgewiesen. Indem also Anselm zur Erläuterung seines Intentionalitätskonzeptes auf die Zweckrelation zurückgreife, erschleiche er sich listig die – letztlich nur scheinbare – Stimmigkeit seiner Konzeption.
Um seine Sicht der Relation von SiV und SiVW legitim vortragen zu können, müsse Anselm implizit schon voraussetzen, dass das „aliquid […]“ eine Wesenheit sei, unter die etwas falle. Denn man könne sich bei Berichten über Ereignisse, die man nicht selbst erlebt hat, durchaus die Dinge, die diese Ereignisse beinhalten, sinnvoll „zusammenreimen“. Wenn mir jemand z. B. etwas über eine mir unbekannte Person berichtete, könnte ich mir zumindest etwas sinnvoll dabei vorstellen, indem ich nach Kriterien meiner eigenen Imagination die Gattung Mensch quasi „spezifizierte“ (67 ff.). Denn ich kenne ja die Grundmerkmale der „realexistenten Gattung Mensch“. Einer Wesenheit und dem ihr korrespondierenden Gattungsbegriff kann ich aber dann und nur dann mittels eigenen Denkens sinnvolle Spezifikationen „ablocken“, die ein SiV ausdrücken, wenn nachweislich etwas Wirkliches unter diese Wesenheit fällt. Eine derartige Wesenheit kann aber das „aliquid …“ Anselms nicht zuletzt aufgrund dessen eigenen Maßgaben gar nicht sein. Denn es muss alternativlos singulär instanziiert sein. Gäbe es nämlich eine Wesenheit mit verschiedenen „Fällen von“, dann wäre diese nicht das höchste Sein, sondern teilte dieses Privileg mit anderen Entitäten. Werde aber von Anselm an dieser Singularität des höchsten Seins festgehalten – und Anselm muss daran festhalten, wenn seine Argumentation nicht inkonsistent werden soll –, dann fehlen Gattungs- und Speziesbegriff, dem gemäß man sich einen „einzelnen Fall von“ ausdenken könnte. Damit scheitere aber der legitime Anspruch des „aliquid“, ein SiV zu sein. Hier schlägt wieder Gaunilos Grundauffassung durch, dass nur solches ein SiV haben könnte, dessen Zusammenhang mit einer extramentalen Realität feststünde.
Dennoch ist Gaunilo einzuräumen bereit, dass auch pure Lautgebilde ohne jeden Sinn nur aufgrund ihres akustischen Vernehmens im Verstand sein könnten (71 ff.). Diese schlichte „Vernehmen“ sei aber nicht das privilegierte „Sein im Verstande“ von dem Anselm spreche. Das „Vernehmen“ und das SiV gleichzusetzen, sei ein Kategorienfehler. Wenn ein Gebilde ein echtes SiV sein solle, so müsse es in einer nachweisbaren Beziehung zu einer extramentalen Realität stehen. Dies geht wieder zusammen mit dem Vorwurf an Anselm, dieser unterscheide nicht zwischen der sinnbezeichnenden und sinnproduzierenden Fähigkeit des Denkens. Ein echtes SiV könne nur auf zwei Weisen konstatiert werden. Entweder beziehe sich das Denken auf eine ihm direkt gegebene extramentale Realität – oder das Denken spezifiziere produktiv die Begriffsgattung einer Wesenheit, von der feststehe, dass etwas unter sie falle. Keine dieser beiden Bedingungen erfüllt offenkundig das „aliquid“.
Es schließt sich nun jenes Argument an, mit dem Gaunilo in die Philosophiegeschichte eingehen wird. Es sagt: Wenn Anselms Argumentation bündig wäre, dann müsste auch Platons Atlantis qua vollkommene Insel realexistieren (75).
Mit dem nächsten Einwand Gaunilos wird besonders deutlich, dass er die logischgnoseologische Komponente von Anselms Argument nicht begriffen hat. Man könne nämlich – so Gaunilo – Anselms Argument nur dann bemühen, wenn ontologisch feststünde, dass das höchst Sein so seinsmächtig sei, dass sein Nichtsein gar nicht gedacht werden könne. Gaunilos Argumentation akzeptiert somit keineswegs Anselms innere Denknotwendigkeit, sondern strapaziert sofort die ontologische Karte. Damit bezieht sich Gaunilo genau betrachtet eher auf die neuzeitlichen Varianten des ontologischen Gottesbeweises.
Ein weiterer Einwand Gaunilos schließt sich an, der direkt gegen die „elenktischen Elemente“ von Anselms Argument gerichtet ist. Gaunilo schlägt (wenn man so will, etwas schlitzohrig) Anselm vor, nicht davon zu sprechen, dass Gottes Nichtsein nicht gedacht werden, sondern dass dieses Nichtsein nicht verstanden werden könne (79 f.). So verstehe etwa Gaunilo, wenn er sozusagen als „Ich“ fungiere, dass er existiere. Könnte er aufgrund dieses Verständnisses nicht denken, dass er nicht existiere, so wäre das Privileg des „aliquid“ nicht mehr gegeben. Es gäbe somit mindestens ein zweites ens, dessen Nichtsein nicht denkbar wäre. Könne er aber jedoch das Nichtsein seines „Ich“ denken, obschon dieses Nichtsein nicht verstanden werden könne, so könnte man analog sagen: Das Nichtsein des „aliquid“ sei zwar nicht verstehbar, gleichwohl aber denkbar. Beide Optionen jedenfalls müssten die Elenktizität von Anselms Argument aushebeln.
Ein Aspekt der Replik Anselms besteht zunächst darin, für das höchste Sein die „Zeitlosigkeit“ geltend zu machen (87 ff.). Es sei anfangs- und endlos. Genau deshalb sei sein „Nichtsein“ auch nicht denkbar. Aus dieser Konstellation ergibt sich nun die Notwendigkeit des höchsten Seins. Denn von etwas, das nicht zeit- und raumbetroffen sei, könne man nicht Anfang und Ende denken. Genau deshalb unterliege es nicht der Alternative von SiV und SiVW – und sei mithin notwendig. Dies geht nun einher mit Anselms These, dass kontingentem Sein (= mit Anfang und Ende sowie begrenzter räumlicher Struktur) stets Raum- und Zeitteile mangelten. Etwas, das an einem bestimmten Ort ist, kann nicht gleichzeitig an einem anderen Ort sein. Etwas, das ins Sein tritt, war vorher nicht existent. Etwas, das aus dem Sein tritt, ist nach diesem Austritt nicht mehr existent. Eben wegen dieses „Teilemangels“ könne man ja gerade das Nichtsein kontingenter zeitlich-räumlicher Dinge widerspruchsfrei denken. Das Gegenteil sei der Fall beim höchsten Sein, das keinen bestimmten Ort im Raum und keinen Anfang und kein Ende in der Zeit habe. Da das höchste Sein somit nicht teilbar sei, sei sein Nichtsein nicht denkbar. Anselm beharrt nunmehr ganz konsequent auf seinem „Verstehensbegriff“ (93 f.). Man kann den Unterschied des anselmianischen Verstehensbegriffs zu dem Gaunilos so fixieren: Für Anselm ist eine Sinnstruktur sinnvoll – und mithin durch das SiV „begabt“ –, wenn sie nicht eo ipso vollständig sinnlos ist. Für Gaunilo hingegen ist eine „Vorstellung“ nur dann sinnvoll und damit ein SiV, wenn sie nachweislich sinnvoll ist, was offenkundig nur durch den erwiesenen Zusammenhang mit einer extramentalen Realität zu belegen ist. Hinter Anselms „Verstehensbegriff“ steckt die Vermutung, dass Unsinn aus Teil-Elementen gebildet sein muss, die selbst sinnvoll sind. Auch das Urteil „Nachts ist es kälter als draußen“ verfügt über sinnvolle Elemente. Die gesamte „Unsinnigkeit“ des Satzes erhielte wegen der Verwechselung der semantischen Kategorien natürlich kein SiV – aber, sehr wohl die separaten Elemente „nachts“, „draußen“ und „kälter“. Bei dem eben angeführten Satz ist der Unsinn der Gesamtverbindung offenkundig. Bei der höchsten denkbaren Geschwindigkeit muss dies nicht eo ipso so sein. Zunächst hat diese Sinnstruktur als ganze ein SiV. Erkennt man aber, dass diese Struktur Unsinn artikuliert, so bleibt nur für die Teilelemente „Geschwindigkeit“ und „höchste“ ein SiV zurück. Bei jenem umstrittenen „aliquid“ ergibt sich aber dessen Analyse – so Anselm –, dass es nur dann ein Sinn ist, dem SiV zusteht, wenn es zugleich ein SiVW darstellt. Mit grimmigem Spott weist Anselm nun auch das Argument von der vollkommenen Insel zurück (95 f.). Es sei eine totale Verwechselung der metaphysischen Ebenen, ein endliches Ding wie eine Insel, das anfangs- und endbetroffen sei, mit dem höchste Sein, das keine Teile und keinen Anfang und kein Ende aufwiese, vergleichen zu wollen.
Ebenso besteht Anselm auf der Formel „Denken“ und lehnt die vorgeschlagene Modifizierung in „Verstehen“ ab (97 ff.). Denn der eine Beweisteil von Anselms Argument lässt sich eben „technisch“ als elenktisch verstehen, wie wir bereits gesehen haben. Um diese Beweisform anwenden zu können, muss man aber mit einem logischen Selbstwiderspruch des Denkens argumentieren.
Des weiteren hält Anselm Gaunilo eine Verkennung seiner Argumentationsformel vor. Gaunilo ersetze wie selbstverständlich Anselms Formel „aliquid quo maius cogitari nequit“ durch die Formel „maius omnibus“. Damit interpretiere Gaunilo das „unum argumentum“ ausschließlich ontologisch. Denn die Formel „maius omnibus“ bezieht sich auf ein denkexternes Sein, von dem einerseits schon feststeht, dass es real existiert und von dem andererseits zugleich behauptet wird, es sei das größte alles Realseienden. Es ist aber keineswegs auszuschließen, dass man zu einem vorfindlichen höchsten realen Sein etwas noch Höheres wenigstens denken könne. Diesen (in den Augen Anselms) verfehlten Ausgang von einem Faktischen, das prinzipiell nur denkextern intendiert werden kann (und an dessen reale Faktizität die Intentionalität auch gebunden bleibt), impliziert aber die Formel „maius omnibus“. Nur dann jedoch, wenn von dem „aliquid quo maius cogitari nequit“ aus feststehe, dass ihm auch eine extramentale Realität zukommen müsse, sei der Schluss zulässig, es sei auch zugleich das „maius omnibus“. Anselm beharrt also auf seinem Ausgang bei einer innerlogischen Notwendigkeit der ratio und lehnt die bloße schlichte Annahme eines ontologisch notwendigen Seins als Letztbasis seines Argumentes ab. Es gilt für Anselm deshalb folgende asymmetrische Struktur: Das „aliquid quo maius cogitari nequit“ ist zugleich das „maius omnibus“. Umgekehrt kann man keineswegs schließen, das „maius omnibus“ sei zugleich das „aliquid quo maius cogitari nequit“ (103 ff.).
1.1.1.3 Die Anselmkritik Thomas von Aquins
Die Kritik des Aquinaten28 an Anselm verschärft letztendlich nur Vorwürfe an Anselm, die sich bereits bei Gaunilo in nuce finden lassen. Thomas29 hält Anselm nämlich vor, in absurder Weise von einem nur wortexplikativen „per se notum“ auf Gottes Realexistenz zu schließen. Ein (wortexplikatives) „per se notum“ ist nichts anderes als die Satzartikulation eines konstitutiven Teilmerkmales eines bestimmten Begriffes. Da dieses Teilmerkmal im Begriff konstitutiv enthalten ist, muss derjenige, der den Begriff benutzt, notwendig auch dem Begriff dieses Merkmal in einem „analytischen Satz“ zuerkennen. Da nun Anselm in den Begriff Gottes das Sein als Merkmal „hineingedacht“ (besser gesagt, hineingemogelt) habe, könne er nicht legitim, d. h. ohne Kategorienfehler, daraus auf die Realexistenz Gottes schließen. Nur immanente Denkbestimmungen können ohne „Legitimitätsnachweis“ miteinander verglichen werden – und nur Seinsbestimmungen können ohne „Legitimitätsnachweis“ miteinander verglichen werden. Seinsbestimmungen und Denkbestimmungen jedoch können allenfalls dann miteinander verglichen werden, wenn für diesen Vergleich ein Möglichkeitsnachweis erbracht würde. Einen solchen lege Anselm aber nicht vor – und ein solcher sei auch gar nicht möglich.30 Als Beispiele für wortexplikative „per se nota“ führt Thomas an (33): „Menschen sind Menschen.“ Oder: „Menschen sind Lebewesen.“ Auf solchen „per se nota“, die im Prädikatsbegriff nur Merkmale des Subjektsbegriffes erneut aufführten, basierten die sichersten Urteile. Doch könne man aus einer schlichten Begriffsexplikation natürlich allenfalls per nefas schließen, dass das Urteil auch einen dieser Begriffsexplikation korrespondierenden realen Sachverhalt artikuliere. Man kann sich dies etwa an „Pegasus“, dem Dichterpferd klarmachen. Im Begriff des Pegasus liegt als Teilmerkmal notwendig „begriffslogisch“ enthalten, dass ich dem „Dichterpferd“ begrifflich Flügel zu attestieren habe. Aber bislang sind unseren Biologen nach meinem Kenntnisstand keine geflügelten Pferde in realitate begegnet. Aus einem Begriff und dessen Merkmalen, die man selbst gebildet hat, ohne weitere Gründe zu schließen, es gäbe diesem Begriff und seinen Merkmalen korrespondierende Dinge und Eigenschaften in der realen Welt, ist offenkundig unsinnig. Doch ist zu beachten, dass das von Thomas so bezeichnete „per se notum“ nicht völlig einerlei mit der Bedeutung ist, die Kant später den sogenannten „analytischen Urteilen“ attestieren wird, auch wenn es hier deutliche Anklänge gibt. Thomas unterscheidet nämlich zwischen einem semantischen und einem ontologischen „per se notum“. Beide Grundtypen von „per se notum“ können in Korrelation stehen, müssen dies aber nicht.
1 So kann sich ein semantisches „per se notum“ auf ein ihm korrespondierendes ontologisches „per se notum“ beziehen. Der Satz „Das Ganze ist größer als seine Teile“ ist hierfür ein Beispiel. Denn sowohl die Wortbedeutung von „Das Ganze“ als auch die realontologische „wesenhafte“ Verfasstheit von „Ganzheiten“ machen diesen Satz notwendig.
2 Nun ist es für den Aquinaten durchaus auch möglich, dass sich ein semantisches„per se notum“ auf kein (bekanntes ontologisches) reales Korrelat bezieht. Wir haben gerade mit Blick auf das Dichterpferd Pegasus ein solches Beispiel erörtert.
3 Eine weitere denkbare Möglichkeit läge darin, dass etwas im ontologischen Sinne seinem Wesen nach ein „per se notum“ sei, ohne dass wir davon wüssten. Gemeint ist also der Fall, dass sich keine Wortbedeutung mit dem Status eines semantischen „per se notum“ auf ein ontologisches „per se notum“ bezöge. Ein Beispiel hierfür ist natürlich aufgrund der Natur der Sache schwer zu finden. Man könnte sich aber etwa geistig behinderte Menschen vorstellen, die den semantischen Sinn von „ganz“ bzw. „das Ganze“ nicht verstünden. Für diese wäre der Satz „Das Ganze ist größer als seine Teile“ kein „wortexplikatives per se notum“, obgleich der Sachverhalt ontologisch immer noch ein solches „per se notum“ darstellte.
4 Schließlich gibt es den vierten Korrelationstyp, der haargenau unser Verhältnis zu Gott spiegelt. Gottes Existenz ist im ontologischen Sinne ein „per se notum“, denn seine Essenz ist seine Existenz. Dies können wir jedoch nicht im Sinne einer distinkten Erkenntnis begreifen, da wir Gott nicht schauen und wir deshalb keinerlei Zugang zu seiner Essenz haben. Gleichwohl können wir mit einer Wortbedeutung auf Gott referieren, in der Gottes Existenz enthalten ist, so dass Gottes Existenz ein semantisches „per se notum“ darstellt. Da diese semantische Wortbedeutung (= semantisches per se notum) aber nicht aus der Einsicht in Gottes Wesen entstammt (so wie bei dem Ganze/Teile-Urteil), so hat dieses wortexplikative per se notum keinerlei wesensbezogene ontologische Relevanz. Das semantische „per se notum“ von Gottes Wortbedeutung hat als solches betrachtet keine Erkenntnisrelevanz, obgleich es auf eine Essenz referiert, deren Existenz im ontologischen Sinne ebenfalls ein per se notum darstellt. Könnten wir Gott schauen, dann allerdings müssten und könnten wir erkennen, dass und wie seine Essenz sein „Ist“ einschließt. In diesem Zusammenhang gibt Thomas noch zu bedenken, dass man sich noch nicht einmal völlig über die Wortbedeutung des Terminus „Gott“ gänzlich einig sei (35). Anselm durchschaue in seinem Argument somit nicht, dass die Existenz Gottes, die in seiner Formel eindeutig ein semantisches „per se notum“ darstelle, nur dann durch diese Formel auch im ontologischen Sinne ausgewiesen werden könne, wenn man deren Korrelation zur Essenz Gottes einsehen könne. Dies jedoch bliebe den Menschen prinzipiell verwehrt.