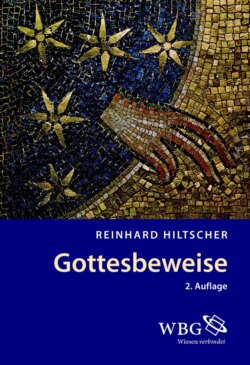Читать книгу Gottesbeweise - Reinhard Hiltscher - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.2 Descartes
Оглавление1.1.2.1 Der kausale Gottesbeweis
Mit Descartes31 beginnt die spezifisch neuzeitliche Ausprägung des „ontologischen Gottesbeweises“.32 Um diese cartesisch-neuzeitliche Ausprägung des ontologischen Gottesbeweises verstehen zu können, muss man sich zunächst klarmachen, dass Descartes einen anderen Begriff von Wissen in Anspruch nimmt, als dies Anselm tut. Während für Anselm in jeder „actio rationalis“ eine Sphäre kontingenter Geltungsdifferenz von einer Sphäre prinzipiierender Geltungsbestimmtheit zu unterscheiden ist, ist für Descartes Wissen synonym mit inhaltlich wahrem Wissen. Nach Anselm gibt es eine Bestimmtheit jeder actio rationalis – mithin auch des Erkenntnisvollzuges –, die vor der Unterscheidung von faktisch gültig und faktisch ungültig liegt, die jedoch begründende Prinzipienfunktion für das faktische „gültig oder ungültig“ ausübt. Etwas kann nur dann noch wahr oder auch falsch sein, wenn es die Prinzipienform der actio rationalis der Aussage erfüllt.33 Bezogen auf das Wissen bedeutet dies also, dass es nach Anselm eine Eigenbestimmtheit des Wissens gibt, die vor der faktischen Differenz wahr – falsch liegt. Für Descartes hingegen ist Wissen nur als inhaltlich wahres Wissen zu verstehen. Ganz ähnlich wie heutige Gnoseologien würde er den Terminus des „falschen Wissens“ als „hölzernes Eisen“ zurückgewiesen haben. Während damit Anselms Gott eine Begründungsfunktion für die Geltungsbestimmtheit qua Prinzipienbestimmtheit des Wissens übernehmen musste, geht es in den Gottesbeweisen des Cartesius um die Begründung inhaltlich wahren Wissens. Descartes’ Begriff des Wissens steht am Anfang einer Wissensauffassung der Neuzeit, welche die Absolutheit unseres Wissens entweder bestreitet und Wissen prinzipiell für kontingent erachtet – oder aber die Absolutheit unseres Wissens in dessen Inhalten zu finden glaubt. Erstere Position hat ihren Ursprung im britischen Empirismus – letztere Position ist besonders im Rationalismus verkörpert. Dass diese Alternative unvollständig ist, können wir noch bei Anselm studieren. Wissen hat bei ihm eine Strukturierung völliger innerer Absolutheit – diese steht im Zusammenhang mit der einen von ihm angeführten „Rechtheit“ des Wissens. Ein Wissen, das seinem Ursprungssollen nicht genügt, ist ebensowenig Wissen, wie Feuer Feuer ist, wenn es nicht dem Sollen seiner actio naturalis genügt. Das Wissen ist also durch innere Prinzipien ausgezeichnet, die ihm völlig absolut sind. Ist es dieser Absolutheit des Sollens gemäß, ist es allererst Wissen und kann dann noch wahr oder falsch sein. Erst das zweite, von Anselm bezüglich des Wissens angeführte Sollen (= die zweite Rechtheit), bezieht sich auf den Inhalt des Wissens und kann kontingenterweise verfehlt werden. Anselm hat noch gewusst, dass man die Absolutheit des Wissens nicht dort suchen kann, wo sie gar nicht hingehört: im Inhalt des Wissens, der stets kontingent bleiben muss. Anselm war sich noch klar darüber, dass es eine Eigenbestimmtheit des Wissens selbst geben muss, die nicht im jeweils intendierten Inhalt des Wissens aufgeht. Die Frage muss gestellt werden, was zu dieser neuzeitlichen Modifikation des Wissensbegriffes geführt hat. Es gibt hierfür viele Gründe. In diesem Kontext wollen wir nur einen dieser Gründe anführen und mit Blick auf Anselm erläutern. Anselm analysiert Wissen nach dem Schema des traditionellen ontologischen Wesensbegriffs. Das Sollen der actio naturalis des Feuers ist das Wesen des Feuers, sofern es diesem Sollen entspricht. Das Ursprungs-Sollen der actio rationalis des Wissens ist das Wesen des Wissens, sofern es diesem Ursprungssollen entspricht. Anselm „verontologisiert“ das Wissen zwar nicht wirklich, aber er analysiert es mit einem Vokabular, das der antiken platonisch-aristotelischen Terminologie geschuldet ist. Genau dieses Vokabular wird aber den Denkern der Neuzeit zum systematischen Problem. Kann man nicht mehr eine Konvergenztheorie von Begriffspyramide und ontologischem genus/specis-Aufbau strapazieren, dann kommt der Verdacht auf, eine gnoseologische Theorie, die Wissen mit dieser alten Terminologie analysiere, sei obsolet geworden. Dass die alte anselmianische gnoseologische Theorie in vielerlei Hinsicht der neuzeitlichen cartesischen überlegen ist, wird durch deren überholt erscheinendes Vokabular verdeckt. Descartes glaubt längst nicht mehr an die strikte Korrelation von Begriffsreich und Seinsordnung. Der Begriff – die Idee – ist nicht mehr ontologisch kontaminiert, wie dies z. B. in der Logik des Aristoteles der Fall war. Andererseits muss eine „psychologische“ Theorie begrifflicher Strukturen zurückgewiesen werden. Genau diese Aversion Descartes’ einer psychologischen Grundlegung des Begriffsreichs gegenüber unterscheidet seine „Ideenlehre“ von der des angelsächsischen Empirismus. Diese Konstellation führt zur Einführung des Terminus „idea vera“. Eine „idea vera“ ist durch eine spezifische Relation ihrer internen Elemente geprägt. Die gedankliche Aufhebung der Verknüpfung dieser Elemente führte in einem Urteil zu einem logischen Widerspruch. Dies wäre z. B. der Fall, wenn wir in einem Urteil abstritten, dass in einem Dreieck die Winkelsumme 180° beträgt. Von solchen rationalen Formstrukturen behauptet Descartes nun, dass diese eine vom konkreten Subjekt unabhängige Geltungsbestimmtheit und „ideale Existenz“ aufwiesen. In der fünften Meditation heißt es über die „ideae verae: „Und wenngleich ich sie [= ideae verae, Vf.] gewissermaßen willkürlich denke, so erfinde ich sie dennoch nicht, vielmehr haben sie ihre wahren und unveränderlichen Naturen. Wenn ich mir z. B. ein Dreieck […] vorstelle, so mag vielleicht eine solche Figur nirgend in der Welt […] existieren, dennoch hat sie […] eine bestimmte Natur oder Wesenheit […], die weder von mir ausgedacht ist, noch von meinem Denken abhängt […] Es ist nämlich offenbar alles, was wahr ist, auch etwas; und ich habe bereits ausführlich bewiesen, daß alles das wahr ist, was ich klar und deutlich erkenne“ (Descartes (1.), 117)
Descartes behauptet somit dreierlei: Jeder wahren Idee (idea vera) korrespondiert ein Etwas, das nicht in seinem Gedachtwerden aufgeht. Dabei besteht der Clou darin, dass diejenigen Kriterien, die eine Idee wahr machen zugleich die Kriterien darstellen, die deren korrespondierendes Etwas allererst konstituieren. Als Kriterium für eine solchen „Wahrmacher“ ergibt sich die schon angesprochene Nichtanzweifelbarkeit des Übergangs von einer Bestimmung zur anderen. Der Übergang von „Dreieck“ zu 180° ist ein solcher. Dies bedeutet, dass die Verknüpfung von Dreieck und 180° auch unabhängig von deren Gedachtwerden in der „idea vera“ existiert. Da Descartes die Absolutheit unseres Wissens fälschlicherweise in dessen Inhalten sucht, hat er überhaupt keine andere Wahl, als mit Gott bzw. Gottesbeweisen zu argumentieren und diese für die Wahrheit bürgen zu lassen. Absolut wahres Wissen mit Blick auf dessen Inhalte kann es nur bezüglich idealer Gegenstandsstrukturen geben, keinesfalls aber bezüglich empirischer Gegenständlichkeit. (Wir sehen hier davon ab, dass heutigentags selbst die Gewissheit des Wissens von solchen Idealgegenständen mit sehr guten Gründen bestritten werden würde.) Die Relevanz dieser Idealstrukturen für die empirische Welt kann man nur unter zwei Voraussetzungen annehmen, die den selben Grund haben. Es müsste erstens der notwendige Übergang von einer solchen idealen Struktur zur realen Wirklichkeit in den internen Strukturen dieser idealen Struktur selbst inkludiert sein – und es müsste zweites einen letzten Grund geben, der die gnoseologische Konvergenz von idealer Gegenständlichkeit und realer Gegenständlichkeit in notwendiger Weise abschließend fundierte. Für beide (eng zusammenhängende) Begründungsaufgaben benötigt das cartesische Wissenskonzept Gott. Ganz offenkundig können bestenfalls Idealgegenstände, wie sie etwa in der Mathematik untersucht werden, das Kriterium der Unbezweifelbarkeit erfüllen. Bezogen auf Weltgegenstände empirischer Art ist prima facie ein solches Kriterium in sinnvoller Weise nicht brauchbar. Somit geht Descartes auf die Suche nach einer idea vera, die in sich den Übergang zur empirischen Wirklichkeit garantiert. Damit ergibt sich aber die Frage, in welcher Weise eine solche Formalexistenz zu realen Weltgegenständen in Beziehung stehe.34 Mit einem so gearteten systematischen Ansatz kann Wissen nur als inhaltlich wahres Wissen gefasst werden. Ganz offensichtlich kann es aber keinen realen Weltgegenstand geben, über den nur unbezweifelbar wahre Urteile gefällt werden könnten. Dieser Vorzug eignet nur den beschriebenen Formalstrukturen. Wie können diese aber ihre Weltrelevanz ausweisen? Kann es nach diesen rigiden Kriterien der „Gegenstandskonstitution“ im eigentliche Sinne „reale Weltgegenstände“ geben? Genau besehen kommt Gott bzw. den Gottesbeweisen nun die Funktion zu, die Gültigkeit unseres positiven Weltwissens zu garantieren. In den Meditationen finden sich zwei Gottesbeweise, der sogenannte kausale einerseits und der ontologische andererseits. Die Strategie des kausalen Gottesbeweises besteht darin, eine Vorstellung ausfindig zu machen, die zugleich eine adäquate extramentale Bestimmung ist – und somit den Übergang von der intramentalen zur extramentalen Wirklichkeit ermöglichen kann. Ganz „technisch“ gesprochen, geht es um eine „idea vera“, in deren Struktur notwendig „impliziert“ ist, dass sie zugleich Bestimmung einer extramentalen Realität ist. Descartes lehrt nun, dass Vorstellungen einen je unterschiedlichen Grad von objektiver Realität aufweisen könnten. Vorstellungen etwa, die Akzidenzien repräsentierten, wiesen eine geringere objektive Realität auf als solche, welche die Substanz repräsentierten. Um dies wenigstens annähernd plausibel machen zu können, legt Descartes das Erkenntnis- und Repräsentationsverhältnis als (eine Art) Kausalverhältnis aus. Es gelte, dass die Ursache einer Wirkung mindestens genauso viel „objektive Realität“ (= Vollkommenheit) aufweisen müsse wie die ihr korrelierte Wirkung. Ganz egal, wie man hier kausal verstehen mag – „derb“ oder „metaphysisch verfeinert“ –, Descartes Operation kommt einer gnoseologischen Barbarei gleich. Lassen wir dies aber beiseite: Ausgangspunkt des kausalen Gottesbeweises wird die „These“ von der „Vorhandenheit“ der Idee des Vollkommenen in unserer „mens“. Weder könne die Ursache dieser Vorstellung aus uns selbst stammen, noch von äußeren Entitäten gewöhnlicher Art erwirkt sein. Zunächst sei es ja offensichtlich, dass alle von äußeren Gegenständen bewirkten sinnlichen Vorstellungen verworren seien. Gemäß der Grunddoktrin des „Rationalisten“ Descartes sind alle der Sinnlichkeit korrelierten Vorstellungen äußerer Gegenstände von solcher „Verworrenheit“ betroffen. Die Sinne stiften keine gültigen Vorstellungen von objektiven Gegenstandsstrukturen. Damit können die externen Gründe der sinnlichen Vorstellungen nicht in entferntester Weise als „Erzeugungs-Kandidaten“ jener höchsten Vollkommenheit gedacht werden. Nur die formale (= logisch-mathematische) Strukturierung bzw. Strukturiertheit der Elemente sinnlicher Vorstellungen stünde nicht unter dem Verdacht der Verworrenheit. Descartes nennt Bestimmungen wie „Substanz“, „Dauer“ etc. Aber – und das sei nun entscheidend – all diese reinen Strukturbestimmungen ließen sich problemlos aus den operativen Funktionen der endlichen ratio ableiten. Die Idee der höchsten Vollkommenheit dagegen könne sich unter keinen Umständen aus den Operationsweisen der endlichen mens ableiten. Die einzige „endliche Erklärungsart“ bestünde in der Annahme, dass die mens humana die Idee höchster Vollkommenheit aus einer willkürlichen Aggregation aller Realitäten bilde, wobei jede einzelne Realität im höchstmöglichen Grade gedacht werde. Diese Erklärung weist Descartes brüsk zurück. Es gelte gerade das umgekehrte Verhältnis. Alle endlichen Realitäten seien nur als Restriktionen jener wahren Idee höchster Vollkommenheit überhaupt distinkt bestimmbar. Somit bleibe nur die Erklärung übrig, ein höchstvollkommenes Wesen selbst als Urheber der Vorstellung höchster Vollkommenheit anzunehmen. Dieses Argument findet nun Ergänzung durch weitere Einlassungen Descartes’. Er erörtert die Frage, ob „ich“ existieren könnte, wenn es kein höchstvollkommenes Wesen in Realexistenz gebe. Ein absoluter Grund meines Daseins müsse nämlich nicht nur ein solcher sein, der mich ins Dasein setzte, sondern insbesondere auch ein solcher, der mich im Dasein erhielte. Aufgrund dessen schieden meine Eltern als letzte Gründe für meine Existenz aus, denn diese hätten „mich“ zwar gezeugt, erhielten „mich“ aber keineswegs in einem ontologischen Sinne im Dasein. Man könne sich dies auch so klarmachen: Wenn es richtig ist, dass die Ursache mindestens genauso viel objektive Realität aufweisen müsse wie die Wirkung, dann müsse eine Ursache, die mich erschaffen hätte, wenigstens auch eine res cogitans sein. Wäre sie nicht das ens perfectissimum selbst, müsste sie ihrerseits genau wie ich über die Idee höchster Vollkommenheit verfügen. Auch bei dieser mich ins Dasein setzenden res cogitans tauchte damit die Frage auf, woher deren Idee höchster Vollkommenheit stamme – was diese in ihr erzeugt habe. Der gekünstelt und konstruiert wirkende Regress ist laut Descartes jedenfalls nur dann zu vermeiden, wenn man annimmt, dass das ens perfectissimum wirklich existiert und die Idee höchster Vollkommenheit in mir erwirkt habe.
1.1.2.2 Der ontologische Gottesbeweis im engeren Sinne
Hat der kausale Gottesbeweis die Funktion, den Übergang der „idea vera“ zur realen Welt verständlich machen zu können, so kommt dem ontologischen Gottesbeweis35 die Aufgabe zu, den letzten Grund als nicht in das wechselseitige Bedingungsverhältnis von Grund und Begründetem involviert aufzuweisen. Denn wir wissen schon von den Reflexionen des heiligen Anselm her, dass das Absolute eine Seite aufweisen muss, die nicht in die wechselseitige Bedingtheit von Grund und Begründetem involviert sein darf.36 Deshalb lehrt Descartes, dass Gottes Existenz schon aufgrund der „idea vera“ seiner Wesenheit ontologisch notwendig sei. Die Notwendigkeit der göttlichen Existenz verdanke sich nicht der Konstellation einer endlichen Begründungsrelation. Anders gesagt: Weil allein von der göttlichen Wesenheit her feststeht (ohne Zuhilfenahme anderer Gründe), dass Gott notwendig realexistiert und weil deshalb auch notwendigerweise die „idea vera“ Gottes zugleich als realexistente Entität gelten muss, wahre Gott seine Absolutheit. Damit nimmt Descartes eine höchst signifikante Umdeutung der Ansätze des heiligen Anselm vor. Denn für Anselm ist das zunächst der Elenktik zuzuordnende „unum argumentum“ (das Descartes’ ontologischem Gottesbeweis entspricht) gerade dadurch ausgezeichnet, dass es mit der „imago dei“ operiert. Als endlicher Formgrund ist die „imago“ Prinzip gültiger, je konkreter Urteilswertungen und damit sehr wohl in die endliche Begründungsrelation involviert. Ansonsten könnte die „Formaltechnik“ Elenktik ja auch nicht legitim angewandt werden. Es geht bei Anselm beim „ontologischen Gottesbeweis“ keineswegs sofort um eine Wesenheit, die kraft dieser Wesensverfasstheit existieren müsse. Genauso „verdreht“ stellt sich auch das andere Ursprungselement der Argumentation Anselms bei Descartes dar. Die „imago“ als endlicher Grund ist für Anselm ein solcher nur deshalb, weil er (sie) Abbild des Absoluten sei. Dieses Absolute selbst kann aber für Anselm nicht als in die endliche Begründungsrelation „verstrickt“ gedacht werden. Es kann nur mit den Mitteln der „fides“ zugänglich gemacht werden. Diese regressive Begründungsstruktur qua fides soll bei Anselm die Absolutheit des letzten Grundes wahren. Bei Descartes ist das Analogon von Anselms fides nun aber der kausale Gottesbeweis, der Gott in die endliche Begründungsrelation gerade hineinzieht. Da der kausale Gottesbeweis von einer Begründungsrelation ausgeht, bei der dasjenige Glied, was begründet werden soll, sich als Repräsentationsgehalt in der endlichen mens vorfindet, ist das Absolute durchaus Glied einer endlichen Grund/Begründetes-Relation. Der kausale Gottesbeweis verortet das vollkommenste Wesen innerhalb der endlichen Begründungsrelation. Descartes verkehrt somit die Funktion der „anselmianischen Ursprungselemente“ nahezu in ihr Gegenteil.
Der ontologische Gottesbeweis der fünften Meditation sieht nun so aus37: Im Begriff des vollkommensten Wesen (= ens perfectissimum) wird die Idee eines Wesens gedacht, das alle Vollkommenheiten vollständig und in ihrem höchsten Grade besitzt. Nun kann einerseits keine einzelne Vollkommenheit aus dem All aller Vollkommenheiten einfach herausgebrochen werden, ohne den Begriff der „omnitudo realitatis“ qua „ens perfectissimum“ aufzuheben. Somit scheint der Übergang von jeweils einer Vollkommenheitsbestimmung zu allen anderen notwendig zu sein. Damit erfüllt sich das Kriterium der „idea vera“ scheinbar. Die omnitudo realitatis ist eine solche „idea vera“, da ihre Bestimmungen nicht auflösbar sind.38 Auch die Existenz ist für Descartes eine der Vollkommenheiten, die in der „omnitudo“ vereint gedacht werden, so dass der Übergang von den anderen Vollkommenheiten zu dieser Einzelvollkommenheit unbezweifelbar notwendig erfolgen muss. Diese Existenz innerhalb der „omnitudo“ kann aber keineswegs nur als „gedachte“ (mögliche) Existenz gefasst werden. Denn es gilt weiterhin, dass Gott alle Vollkommenheiten in ihrem höchsten Grad besitzen muss. Der höchste Grad von Existenz ist notwendige Existenz – eine Existenzweise also, deren Nichtsein oder bloßes „kontingentes“ Sein unmöglich ist. Der Übergang von einer idea vera zur Realität scheint erfolgreich geglückt zu sein.
1.1.2.3 Descartes und Caterus
Descartes musste seine Ansätze jedoch gegenüber vielen Theologen und Metaphysikern seiner Zeit verteidigen.39 Insbesondere seine Apologie des ontologischen Gottesbeweises gegenüber Caterus40 ist von großer Bedeutung. Caterus41 wendet im Grunde ein, dass Descartes sein Kriterium des notwendigen, unbezweifelbaren Übergangs von einer Vorstellung zur anderen nicht trennscharf expliziert habe. Das heißt präzise gesagt, Caterus bestreitet, wie Henrich herausarbeitet, dass der Nachweis dafür erbracht werden könne, dass die Idee der „omnitudo realitatis“ qua ens „perfectissimum“ eine „idea vera“ sei.42 Eine Notwendigkeit des Übergangs von Bestimmung zu Bestimmung gebe es doch auch bei willkürlich erzeugten Vorstellungen, denen ganz und gar keine „idea vera“ korrespondierte. So müssten bei Pegasus zum gegebenem Pferderumpf notwendigerweise auch die Flügel hinzugedacht werden. Dennoch sei Pegasus ganz offensichtlich keine idea vera. Descartes müsse also erst beweisen, dass dem Begriff des vollkommensten Wesens eine idea vera korrespondiere. Zur Verteidigung der eigenen Position erläutert Descartes zunächst den essentiellen Unterschied zwischen einer idea vera und dem Phantasieprodukt des Pegasus. Bei Pegasus sei es dem Denken möglich, problemlos die Vorstellung von Pferd und Flügeln separat43 zu fassen. Nur wenn ich Pegasus denke, muss ich Pferd und Flügel denken – ich muss aber keinesfalls, wenn ich Pferd denke, zusätzlich Flügel denken. Ebenso kann ich ohne jeden Widerspruch „isoliert“ Flügel denken, ohne dabei in meinen Gedanken den Pferdekorpus „aufrufen“ zu müssen. Andererseits: Wenn ich „Figur, die stets 180° Winkelsumme aufweist“ denke, so muss ich notwendigerweise auch Dreieck denken. Denke ich Dreieck, so muss ich die Bestimmung „Figur, die stets 180° Winkelsumme aufweist“ ebenso fassen.44 Bei einer solchen idea vera wie Dreieck ist also das isolierte Denken von Bestimmungen nicht möglich. Aus dieser Überlegungen erwächst nun – wie Henrich45 überzeugend darlegt – eine Modifikation des Argumentes durch Descartes. Ausgangspunkt wird nun der Begriff des allmächtigen Wesens. Ein allmächtiges Wesen kann gar nicht anders denn als Grund seiner eigenen Existenz gedacht werden. Verdankte es seine Existenz nicht sich selbst, so wäre seine Macht durch die bloße Vorgegebenheit der eigenen Existenz limitiert. Die Aseität (die Selbstgründung des eigenen Seins) ist also Konstitutionsmoment des Begriffs eines allmächtige Wesens. Ein Wesen, das Grund seiner eigenen Existenz ist, muss aber als ein notwendiges Wesen verstanden werden, so dass der Übergang vom Begriff der Allmacht zu dem notwendiger Existenz zwingend ist. Ein Wesen, das Grund der eigenen Existenz ist, kann nicht als nichtseiend gedacht werden – ihm eignet notwendige Existenz. Es gibt keine ihm externen Gründe, die über seine Existenz oder Nichtexistenz „bestimmen“. Allmacht kann somit nicht isoliert von Notwendigkeit gefasst werden. Ebenso wenig kann Notwendigkeit isoliert von Realexistenz gefasst werden. Damit kann also aufgrund der notwendigen Folgerungskette Allmacht – Notwendigkeit – Realexistenz geschlossen werden, dass das allmächtige Wesen wirklich existiert. Wie Henrich46 gut darlegen kann, ist damit auch der Übergang zur „omnitudo realitatis“ gestiftet. Denn ein realexistierendes allmächtiges Wesen, das sogar der Grund der eigenen Wirklichkeit ist, „stiftet“ sich zwingend auch alle anderen Vollkommenheiten. Also: Das Denken bildet – analog zum Vorgehen im Beispiel von Pegasus – die Idee höchster Vollkommenheit. In dieser ist die Notwendigkeit inkludiert, das ens perfectissimum als realexistent denken zu müssen. Nun muss der Einwand ausgeschlossen werden, dass hier nur die Notwendigkeit eines willkürlichen Konstrukts vorliegt – so wie wir dem Pegasus als willkürlichem Konstrukt Flügel attestieren müssen. Es wird nunmehr eine einzelne Vollkommenheit herausgegriffen – die Allmacht. Von dieser einzelnen Vollkommenheit aus ist der Übergang zur Existenz unter den Kriterien des Cartesius zwingend. Von einem allmächtigen Wesen kann nun auch weiterhin gezeigt werden, dass es uno actu die omnitudo realitatis sein muss.