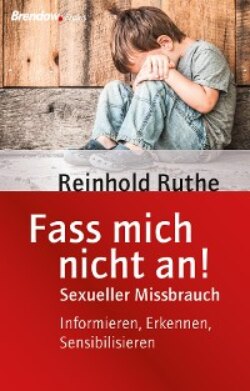Читать книгу Fass mich nicht an! - Reinhold Ruthe - Страница 7
KAPITEL 2 Die Opferrolle der Missbrauchten
ОглавлениеWer systematisch vertuschen, betrügen, verführen und missbrauchen will, findet viele unerlaubte Wege. Kinder und Jugendliche sind in der Regel in einer unterlegenen Situation.
Und wer verführen will, dem fallen ungeahnte Möglichkeiten ein, Opfer zu finden.
Wer aber in der Familie, in Schulen, Heimen und anderen Einrichtungen sexuelle Gewalt und sexuellen Missbrauch verringern und verhindern will, findet hilfreiche Anregungen, konkrete Erziehungstipps und Einstellungen. Wer sich ernstlich hineindenkt, wird für seine Erziehungs- und Präventionspraxis Anregungen finden, die ihm weiterhelfen.
Die Professoren Sabine Andresen und Wilhelm Heitmeyer schreiben: „Eine Erfahrung, die betroffene Kinder häufig machen, nämlich kein Gehör zu finden und der Lüge bezichtigt zu werden, setzt sich bis ins hohe Erwachsenenalter fort. Immer noch muss ein betroffenes Kind im Durchschnitt acht Personen ansprechen, bis ihm jemand glaubt.“ 3
Wer vorbeugen will, muss aber verstehen,
wie Täter und Opfer miteinander umgehen,
wer besonders gefährdet ist,
wer die Täter und Täterinnen sind
und was sie selbst zu Tätern oder Täterinnen macht.
Die Strategie der Täter und die Reaktion der Opfer
Werfen wir zunächst noch einmal einen Blick auf die Machenschaften der Täter und die Befindlichkeit und Einstellungen der Opfer, in der Regel sind es Kinder.
Da alle Kinder unterschiedlich empfinden und unterschiedliche Persönlichkeitseigenarten spiegeln, ist es hilfreich, die Schwachstellen zu erkennen, die von den Tätern ausgenutzt werden.
Pädosexuell empfindende Väter, Erzieher und Lehrer finden in Familien, Schulen, kirchlichen Heimen und staatlich-sozialen Einrichtungen ihren Arbeitsplatz. Sie wissen, wie sie mit Kindern und Jugendlichen umgehen müssen, um sie für ihre Zwecke dienstbar zu machen. Sie haben ein sicheres Gespür, welche Kinder und Jugendliche ihnen machtlos ausgeliefert sind. Wer in Erziehung gegensteuern will, findet in den folgenden Opferbeschreibungen sicherlich ein paar Anregungen. Welche Kinder und Jugendlichen sind gefährdet?
1. Kinder, die sich leicht beeinflussen lassen
Selbst wenn eine gewisse Anlage zu dieser Lebenseinstellung vorliegen sollte, handelt es sich oft um Kinder und Jugendliche, die von Eltern in ihrem Selbstwert und in ihrem Selbstvertrauen nicht gestärkt wurden. Eltern hatten vielleicht zu wenig Zeit, schenkten nicht genug Geborgenheit und Selbstsicherheit. Die Kinder fühlen sich nicht wertgeachtet. Sie wollen aber geliebt und geschätzt werden. Sie verhalten sich eher nachgiebig, artig und angepasst. Sie sind auf diese Weise ein gefundenes Opfer für Erzieher, die sich ihnen liebevoll und einfühlsam nähern.
2. Kinder, die sich einsam und unsicher fühlen
Auch hier liegen häufig Versäumnisse in der Erziehung vor. Es sind Kinder und Jugendliche, die in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule übersehen, vernachlässigt oder ausgegrenzt wurden. Sie stehen abseits, fühlen sich ignoriert und sehnen sich nach Anerkennung und Zuspruch.
Genau um diese Kinder und Jugendlichen kümmern sich die pädosexuell empfindenden Erzieher. Sie schenken ihnen Aufmerksamkeit, Beachtung und Anerkennung. Die Kinder und Jugendlichen blühen auf und sind eine leichte Beute für die Erzieher oder Lehrer.
3. Kinder, die sich durch Geschenke oder bessere Noten beeinflussen lassen
Wer ein Kind für sich gewinnen will, findet viele Wege und Möglichkeiten, es abhängig und gefügig zu machen. Bestechung ist eine Methode, die fast immer funktioniert. Mit Schulnoten hat der Lehrer das Kind fest in der Hand. Es will nicht durchfallen und nicht sitzenbleiben. Es kann dem Lehrer bei Missbrauch kaum widersprechen. Willfährige Kinder bekommen kleine „Pöstchen“ innerhalb der Gemeinschaft, werden anerkannt von den Tätern, und die Jugendlichen nehmen diese Geschenke gern an. Den Missbrauch erleben viele positiv. Denn die Sexualität muss ja schließlich befriedigt werden.
Kommen dann noch die Kinder aus sehr schwierigen Familienverhältnissen oder wurden vom Jugendamt vermittelt, sind die Gefährdungen doppelt so groß.
Die Kinder sind haltlos, fühlen sich nicht geborgen und haben keine Erwachsenen, denen sie vertrauen können. Diese Unsicherheit wird in der Regel von Tätern ausgenutzt.
Oft handelt es sich bei den Tätern um Menschen, die durchaus eine große Ausstrahlung haben und sich geschickt in Szene setzen können. Viele Täter redeten sich heraus, die Kinder und Jugendlichen hätten sie verführt. Oder sie gaben den Schutzbefohlenen die Schuld, sie hätten regelrecht Gefallen an den sexuellen Handlungen gehabt.
Gerold Becker, der ehemalige Leiter der Odenwaldschule (s. hierzu auch Kapitel 6), soll erst kurz vor seinem Tode die Schuld für viele Verfehlungen auf sich genommen und sich bei den betroffenen Schülern entschuldigt haben. Dass er nie ernsthaft zur Rechenschaft gezogen oder bestraft wurde, zeigt, wie in Deutschland in Politik und Pädagogik über Missbrauch und sexuelle Gewalt gedacht wird.
4. Die Reaktion der Opfer
Für alle Verantwortlichen in Familie und Erziehung, in Heimen, in kirchlichen und sozialen Einrichtungen sind die Reaktionen der Opfer interessant. Viele Kinder und Jugendliche haben den Missbrauch gar nicht als problematisch empfunden. Da sie kaum aufgeklärt waren und über Sexualität mit allen Erscheinungsformen wenig wussten, haben sie die Praktiken und Missgriffe als normal empfunden. Schüler, die sich wunderten, die vorsichtige Anfragen an Lehrer und Verantwortliche richteten, wurden aufgeklärt, dass schon in der Antike solche Praktiken zum liebevollen Umgang untereinander dazugehörten.
Da Lehrer und Erzieher ganz selten brutale Praktiken ausübten, bestand für die Schutzbefohlenen kein Anlass, Eltern oder die Polizei zu informieren. Das ist wieder ein Grund, warum Kinder und Jugendliche auch später geschwiegen haben.
Deutlich wird: Eltern, Erzieher, Lehrer und Verantwortliche sind verpflichtet, Kindern und Jugendlichen uneingeschränkt
die Wahrheit über alle Formen der Sexualität zu vermitteln,
die Wahrheit über sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe zu erklären,
die Wahrheit über Knabenliebe, über Päderastie und Pädosexualität offenzulegen,
Kindern und Jugendlichen Mut zu machen, sofort jeden Missbrauch zu melden,
zu vermitteln, dass das Schweigen der Betroffenen den Missbrauch verstärkt.
Noch einmal der Kernpunkt: Je mehr Defizite ein Kind
in Bezug auf Sicherheit und Selbstvertrauen,
Zuwendung und Anerkennung,
Liebe, Geborgenheit und Wärme aufzeigt, desto größer ist die Gefahr, dass es Opfer sexuellen Missbrauchs wird.
Nicht Fremde und Unbekannte, sondern Vertraute und Bekannte sind die Täter
Kinder sind normalerweise bei allem Fremden vorsichtig. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Darum handeln Täter in einer Umgebung, wo sich Kinder sicher fühlen. Ist es daher verwunderlich, dass die Täter in der Hauptsache
leibliche Väter,
Stiefväter,
ältere Geschwister,
Onkel und Großeltern,
gute Bekannte, Verwandte, Freunde und Nachbarn sind?
Das Kind hat keine richtigen Worte für das, was passiert. Das Kind erlebt „Freezing“, wie die Bindungsforscher es nennen, also einen Schockzustand, ein Eingefrorensein. Und dem Kind wird eingeredet: „Du hast mich verführt, du hast doch selbst Erregung empfunden.“ Das Kind schämt sich, dass ihm so etwas passiert ist. Väter und Onkel werden als Haupttäter ermittelt. Und je enger die Beziehung ist, desto weniger werden Drohung und körperliche Gewalt angewendet.
Ausdrücklich muss an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass oft in Heimen, in sogenannten Fürsorgeeinrichtungen, wo im vorigen Jahrhundert „Verwahrloste“, Disziplinlose, Verwilderte, Gestrandete, kriminelle Jugendliche – wie die Beurteilungen damals lauteten – untergebracht waren, der sexuelle Missbrauch durch Strafen, Arrest, Demütigungen und zweifelhafte Machtausübung ausgeübt werden konnte. Diese Strafmaßnahmen geschahen nachweislich noch bis in die Siebziger- und Achtzigerjahre. Auch in christlich geführten Häusern waren diese Praktiken üblich.
Wenn ich den Bericht des Landesjugendamtes im Rheinland4 lese, der die öffentliche Erziehung von 1945 bis 1972 schildert, kommen auf 587(!) Seiten nahezu keine Berichte von sexuellem Missbrauch vor. Und die drei bis vier Fälle, die angedeutet werden, enden in der Regel positiv für die Täter. Oft wurde den Jugendlichen nicht geglaubt, denn sie wurden ja nicht umsonst in diesen Einrichtungen untergebracht.
Sexueller Missbrauch – kein reines Männerverbrechen
Viele sind der Meinung, sexueller Missbrauch sei ein reines Männerverbrechen. In der bisherigen Darstellung konnte durchaus der Eindruck entstehen. Aber das ist in Wahrheit anders. Auch Frauen und Mädchen gehören zu den Täterinnen. Dazu schreibt Elisabeth Raffauf:
„Unvorstellbar ist es, dass Frauen so etwas machen könnten. Noch dazu die eigenen Mütter. Das ist ein Gedanke, gegen den sich alles wehrt. Das darf nicht sein, das entspricht nicht unserem Frauenbild, schon gar nicht dem Bild der fürsorglichen Mutter. Tatsache aber ist: Ungefähr neunzig Prozent der Täter von sexueller Gewalt gegen Mädchen sind männlich. Ungefähr zehn Prozent sind weiblich. Wenn Jungen Opfer werden, so sind Täter sogar zu etwa 25 Prozent weiblich. Weibliche Täter sind also gar nicht so selten, wie man denkt.“5
Übergriffe von Kindern und Jugendlichen
Im Grunde müsste ein Extrakapitel dieses Thema behandeln. Denn hier sprechen erschütternde Zahlen für sich. Wie kann man das verstehen, dass Jugendliche gegenüber Gleichaltrigen und Jüngeren sexuell übergriffig werden? Statistisch gesehen sind ein Drittel aller Täter selbst noch Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende.
Auch unter Geschwistern ist sexueller Missbrauch relativ häufig. Ein amerikanischer Sozialwissenschaftler, David Finkelhor, ist sogar der Meinung, dass dies die häufigste Missbrauchsform ist. Die Dunkelziffer für diese Missbrauchsform sei erschreckend hoch. Er geht jedoch davon aus, dass selten ein kleines Mädchen seinen älteren Bruder anzeigt. Jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder zwölfte Junge wird Opfer von sexueller Gewalt. Die Missbrauchsrate bei behinderten Kindern ist besonders hoch. Sie werden zwei- bis dreimal häufiger Opfer von sexueller Gewalt. Sie verstehen erst recht nicht, was mit ihnen geschieht.
Sie akzeptieren und schweigen und können sich nicht wehren.
„Untersuchungen bestätigen, dass etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland im Laufe ihrer Kindheit und Jugend in dieser oder jener Form sexuell missbraucht wurden. (…) Anita Heiliger, Missbrauchsforscherin am Deutschen Jugendinstitut, zeigt auf, dass immer mehr Kinder und Jugendliche einander sexuell missbrauchen. Das bedeutet also, dass die 14 – 16-Jährigen die insgesamt höchste Risikogruppe ausmachen, sexuellen Missbrauch an Kindern zu begehen (…). In der Altersgruppe der 14 – 16-Jährigen kam es in den letzten 15 Jahren zu mehr als einer Verdoppelung (bei sexuellen Gewaltdelikten).“6
Der Verein Zartbitter, Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen berichtet,
dass ältere Grundschulkinder bereits einen unkontrollierten Medienzugang haben und grenzverletzende Handlungen als normal empfinden,
dass eine Reihe Kinder Pornos im Elternhaus konsumieren und die belastenden Bilder benutzen, um sie wieder in der Praxis neu zu beleben,
dass noch vor zehn Jahren Mädchen und Jungen im Kindergartenalter nur in Ausnahmefällen orale Praktiken von Erwachsenen nachmachten, während heute laufend Mütter nachfragten, ob praktizierte orale Praktiken altersentsprechend wären.
Auch eine Erzieherin, die eine evangelische Tagesstätte für Kinder der Diakonie in Düsseldorf leitet, hat Regeln und ein Konzept veröffentlicht, das an Großzügigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Sie bejaht,
dass in Kuschelecken Kinder die Möglichkeit haben, sich „Penis und Scheide“ unbefangen anzuschauen;
dass Kinder im Kindergarten ihren Körper entdecken und ihre Geschlechtsorgane berühren und streicheln dürfen;
dass Doktorspiele erlaubt sind, wobei große Kinder und Erwachsene da keinen Zutritt haben;
dass bei allen Spielen sich Kinder keine Gegenstände in die Körperöffnungen stecken dürfen.7
Kinder werden von Geburt an als sexuelle Wesen betrachtet. Sie kennen keine Trennung von Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Schmusen und genitaler Sexualität. Die Sexualität darf in allen Formen ausprobiert werden. Es geht um Lustgewinn. Sexualität ist eine Energiequelle, die Liebe wird ausgeklammert. Dass sich hier für die späteren Erwachsenen Defizite ergeben, sollte auf der Hand liegen.
Liebe, Verbindlichkeit, Treue, Zusammengehörigkeitsgefühle und Innigkeit werden unterschlagen. Partnerwechsel und späterer Partnermissbrauch liegen auf der Hand. Wenn der Partner die sexuelle Befriedigung nicht mehr gewährleistet, wird er ausgetauscht. Denn zur Liebe kann man nicht erziehen, meinen viele Verantwortliche. Außerdem sei es unmöglich, Liebe allgemeingültig zu definieren.
Missbrauchsopfer üben Missbrauch
Dieser Zusammenhang ist für alle Begründungen hilfreich.
Die Motivation für diese Form des Missbrauchs lautet so:
„Etwa die Hälfte aller Menschen, die sexuellen Missbrauch begehen, hat selbst sexuelle Gewalt erfahren. So wird, auf den ersten Blick scheinbar absurd, dieses schändliche und als traumatisch erlebte Verhalten von einer Generation an die nächste weitergegeben.“8
Mit anderen Worten: Missbrauchserfahrung prägt unser Bewusstsein und unser Unbewusstes. Alles, was mit schönen Gefühlen zu tun hat, wird in der Missbrauchsverpackung gelernt und erfahren. Alle sexuellen Beziehungen sind von vornherein unter problematischen Umständen gemacht worden.
Auch die Erfahrung muss gehört werden: Sind Kinder und Jugendliche beim Missbrauch „gut“ behandelt worden, setzt sich in den Köpfen von Missbrauchsopfern fest, gute Behandlung und Übergriffigkeit gehören zusammen. Sie praktizieren später ähnliche Verhaltensmuster.
Kinder, die mit Verwahrlosung, Isolation und Einsamkeit zu tun hatten, werden leicht Opfer von Missbrauch, weil sie geliebt und gemocht werden wollen. Täter haben ein Auge dafür.
Alkohol, Drogen, K.o.-Tropfen und Betäubungsmittel
In den letzten Jahren berichten die Zeitungen oft über „Komasaufen“ von Kindern und Jugendlichen, über ein Betrinken bis zur Bewusstlosigkeit.
Ist es nur eine Lust an Alkohol?
Sind es bewusst organisierte Proteste von Jugendlichen?
Wollen sie kleine Erwachsene spielen?
Ist Langeweile ein Auslöser?
Oder geht es versteckt auch um Missbrauch?
Eines Tages erscheint eine Mutter mit ihrer Tochter bei mir in der Beratung. Sie hat die Tochter gezwungen, mitzukommen. Elena ist sechzehn Jahre alt und will nur allein mit mir sprechen (alle Umstände sind verändert, aber die Tatsachen stimmen). Die Tochter sei etliche Male erst nachts betrunken nach Hause gekommen. Männer hätten sie mit dem Auto gebracht. Die Tochter hätte nur gelallt und wäre nicht imstande gewesen, zusammenhängend über die Party zu berichten. Das höre ich zu Anfang von der Mutter.
Elena versichert sich bei mir, ob die Eltern auch nichts von den Vorfällen erführen. Und dann berichtet sie: Sie träfen sich bei einem jungen Mann, der mit einem anderen in zwei Zimmern irgendwo am Rande der Stadt lebte. In einer Disko hätten sie sich kennengelernt. Immer zu viert kämen sie zusammen, manchmal auch zu sechst, Mädchen und Jungs. Die Männer hätten verschiedene alkoholische Getränke dabei. Man rede über alles Mögliche, labere über neue Popsongs und Pegida, schaue sich Bilder auf iPads an und ließe die Alkoholflaschen kreisen. Über kurz oder lang seien sie zugedröhnt, redeten dummes Zeug und verlören ihre Kontrolle. Die anderen Mädchen und sie gingen alle in die gleiche Schule. Sie unterhielten sich am nächsten Tag über alles. Nahezu wörtlich: „Wir sind im Laufe des Abends ohne Kontrolle, wir schweben in einer Traumwelt. Die Erste rutscht auf den Teppich, die andern hinterher. Ich glaube, die Jungen ziehen uns aus. Sie befriedigen uns und sie befriedigen sich. Alles geht im Halbschlaf. Wir sind kraftlos und willenlos. Aber das Ganze ist wunderschön. Es erschreckt mich, wenn ich das erzähle. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, aber gehe immer wieder hin. Den andern Mädchen ergeht es ähnlich.“
„Was, glauben Sie, sind Ihre Motive?“, frage ich die junge Dame.
Sie lächelt und sagt: „Wir gehen zur Schule, alles läuft langweilig ab. Politik interessiert uns nicht. Meine Eltern gehen zur Kirche und ärgern sich, dass wir Kinder keinen Bock haben! Die Eltern reden von Verantwortung. Im Moment wollen wir noch nicht. In der Familie leben wir in zwei Welten. Wir wollen Spaß haben!“
Was macht dieses Beratungsbeispiel deutlich?
Eltern und Kinder leben in zwei Welten. Sie haben es nicht verstanden, eine gemeinsame Erlebniswelt und ein verantwortliches Zusammenleben aufzubauen. Vater und Mutter sind beruflich und in der Gemeinde hochengagiert, aber nicht in der Familie.
Die Tochter geht eigene Wege und wehrt sich gegen den aufgepfropften Glauben.
Selbstverwirklichung und Genuss werden großgeschrieben. Verantwortung kommt früh genug auf das Mädchen zu.
Es hat Gewissensbisse, aber die sexuellen Wünsche sind stärker.
Es handelt sich um Missbrauch, der aber von den Mädchen gutgeheißen wird. Ihre einkalkulierte Passivität und ihre Befriedigung sind gewollt.
Die Eltern schämen sich, die Sache öffentlich zu machen. Sie spüren deutlich, was sie versäumt haben, und sind ratlos.
Ein gefährlicherer und gewalttätiger Missbrauch geschieht mit K.o.-Tropfen. Auch junge und ältere Männer, die ihre sexuelle Gier stillen wollen, benutzen K.o.-Tropfen, die sie heimlich in Getränke mischen, um die Opfer gefügig zu machen. Hin und wieder zeigen Opfer die Täter an, haben aber in der Regel ein schlechtes Gewissen, weil sie sich freiwillig auf ein Abenteuer eingelassen haben.
Während ich an diesem Manuskript arbeite, lese ich in der Tageszeitung einen Bericht über einen Arzt, der an jungen Patientinnen Missbrauch getrieben haben soll, nachdem sie von ihm mit bestimmten zusätzlichen Betäubungsmitteln willenlos gemacht worden waren. Wörtlich schreibt die Zeitung: „Es sind vier der insgesamt zwölf Frauen, die sich dem deutschlandweit anerkannten Gefäßchirurgen für eine angebliche Studie anvertraut haben und die im Nachhinein einen Albtraum erleben: Denn der Arzt soll ihnen ein Hypnotikum verabreicht, sie in ihrem wehrlosen Zustand missbraucht und dabei gefilmt haben.“9
Eine Medizinstudentin klagte anschließend lange über Benommenheit, ließ sich untersuchen und stellte eine sehr hohe Dosis eines Hypnotikums fest. Der Anwalt, der mehrere Frauen vertritt, schildert, dass die Situation für die Opfer extrem belastend sei. Laut Anklage wollte der Arzt sich an den Frauen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren sexuell befriedigen. Im gleichen Artikel werden drei weitere Missbrauchsfälle in anderen Städten geschildert. Ein Frauenarzt wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er insgeheim Zehntausende Fotos von seinen Patientinnen angefertigt hatte. In Hildesheim hatte ein Kinderkrankenpfleger serienweise junge Mädchen betäubt und sexuell missbraucht. Er wurde zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt.
Folgen des sexuellen Missbrauchs
Dass sexueller Missbrauch Folgen hinterlässt, steht außer Frage. Wie können die Folgen aussehen? Ich beginne mit einem Beratungsbeispiel. Eine Frau um die 40 Jahre alt hat sich mit Eheproblemen an mich gewendet. Sie erzählt mir eine äußerst unangenehme Erfahrung als Kind mit dem Großvater. Oft weilte sie als Kind beim Opa, der allein lebte. Seine Frau war bereits gestorben. Damals war sie zwischen 5 und 9 Jahre alt, vielleicht auch schon 10 oder 11. Wenn sie nach dem Essen zu Hause zu ihm kam, sagte er zur Enkelin: „Weißt du was, wir machen zuerst mal ein Mittagsschläfchen. Dann sind wir beide frisch für den ganzen Nachmittag.“ Beide legten sich aufs Sofa. Der Opa mit dem Rücken zur Wand, die Enkelin vor ihm, die ihm auch den Rücken zudrehte. „Wir streicheln uns ein bisschen, das ist schön!“
Er streifte der Enkelin den Schlüpfer herunter und streichelte sie von hinten in und an der Scheide. Sie durfte den Opa am Glied streicheln.
Ihre beiden Eltern waren berufstätig und glücklich, dass die Enkelin beim Opa untergebracht war. Der kümmerte sich intensiv um das Mädchen. Für die Enkelin war Sexualität ein Geheimnis. Zu Hause war nie darüber gesprochen worden. Zuerst fand sie das Streicheln unangenehm. Aber je älter sie wurde, fand sie „das ausgesprochen schön“.
Dann erlebte sie, dass in der Schule über „sexuellen Missbrauch“ gesprochen wurde. Was an Kindern bis zum Alter von 16 Jahren geschehe, wurde als Verbrechen charakterisiert. Die Enkelin war schockiert. Ab der Zeit mied sie den Kontakt zum Opa mit fadenscheinigen Begründungen. Den Eltern erzählte sie nichts. Das Mädchen fühlte sich mitschuldig.
Mit 25 Jahren heiratete sie und hatte nur ein Problem bei sexuellen Beziehungen mit ihrem Mann. Wenn er sie von hinten anfasste und berührte, zuckte sie erschreckt und abwehrend zusammen und hatte ihm sogar einmal ins Gesicht geschlagen, weil sie an das „Verbrechen“ erinnert wurde. Dieser handgreifliche Ausrutscher brachte sie in die Beratung.
Andere sexuelle Probleme hatte sie nicht.
Wir halten fest:
Was die Enkelin erlebte, ist sexueller Missbrauch, ist sexuelle Gewalt.
Ältere Personen, hier der Opa, missbrauchen ihre Stellung, missbrauchen ihr Wissen.
Dieses Beispiel macht aber auch deutlich: Es müssen nicht immer schwere sexuelle Folgen im Zusammenleben mit Partnern oder Partnerinnen erfolgen.
Der „soziale Tod“
Der Ausdruck stammt von Professor Heitmeyer. Er macht deutlich, dass die Betroffenen ihr Vertrauen in die soziale Umgebung nach sexueller Gewalterfahrung verloren haben. Sie sind misstrauisch. Dieses Misstrauen untergräbt die spätere Beziehungsfähigkeit. Beratung, Seelsorge und Therapie wollen diese Defizite verringern. In schweren Fällen kann es zu Isolation, Liebesverlust, zu Selbstwertverlust und Kontaktverlust kommen. Nach meiner Erfahrung muss der sexuelle Missbrauch aber äußerst belastend gewesen sein, und der Betroffene oder die Betroffene sind häufig besonders sensibel.
Sexueller Missbrauch und Traumatisierung
In der Stressforschung hat es einen Blickpunktwechsel gegeben. Nicht psychische Störungen allein, wie Verlust des Arbeitsplatzes, Überarbeitung, Scheidung oder ein Todesfall, rufen traumatische Verletzungen hervor, sondern auch kritische Lebenserfahrungen wie sexuelle Gewalt können seelische Störungen verursachen. Seit den Achtzigerjahren sprechen wir von der PTBS, von der „posttraumatischen Belastungsstörung“. Diese Störung wurde nach dem Vietnamkrieg offiziell in die Diagnosemanuale aufgenommen. Sie beinhaltet, dass Jahre oder Jahrzehnte später noch traumatische Erfahrungen sich im Alltag, im Schlaf oder in der Erinnerung bemerkbar machen können. Daraus kann sich ein Vermeidungsverhalten entwickeln, sodass beispielsweise dunkle Orte, Gespräche über die damaligen Ereignisse, auch bestimmte Aktivitäten, die damit verbunden waren, vermieden werden. In schlimmen Fällen kann die sexuelle Erregung gestoppt werden, um den möglichen Bedrohungen, die damit verbunden waren, aus dem Wege zu gehen. Wieder handelt es sich – nach meinen Erfahrungen – um hochsensible Menschen, die stärker und hellhöriger auf alle Ereignisse im Leben reagieren.
In solchen schweren Fällen ist oft eine lange Therapie erforderlich.
Angst als Folge sexuellen Missbrauchs
Sie tritt später umso deutlicher in Erscheinung, wenn die Erfahrungen als Kind und Jugendlicher mit großer Angst verbunden waren. Diese Angst kann später immer präsent sein. Sie hat den Jugendlichen begleitet. Es kann sich um Angst vor Männern, um Angst vor Dominanz, um Angst, diskriminiert und erniedrigt zu werden, handeln. Diese Angst kann alle Lebensenergie binden. Man wird zum Außenseiter. Krankheiten stellen sich ein. Zum Beispiel reagieren nicht wenige mit Depressionen, mit unerklärlichen Ängsten oder Phobien. Leider können solche Menschen später drogensüchtig oder medikamentenabhängig werden, um diese Ängste zu betäuben. Oder sie ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück.
Das Gleiche gilt für die Liebe. Der Missbrauchte sehnt sich wie jeder andere. Aber er hat böse Gefühle: Ist das wirklich Liebe, was er empfindet, oder nur ein böser Trieb? Etwas Verfluchtes, was er bei seinem Lehrer im Heim erlebt hat? Er zweifelt an sich und seiner Liebe. Er fühlt sich innerlich zerrissen. Ehrlicherweise muss ich hier einblenden, dass ich diese Gefühle auch bei Christen erlebt habe, die nicht missbraucht wurden, die durch Eltern oder Verkündigung von ihrer Sündhaftigkeit, von ihrem sexuellen Egoismus völlig überzeugt waren.
Sie schämten sich, einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau ihre „Liebe“ zu bekennen.
Sie meinten, dass in erster Linie sexuelle Sehnsüchte ihre Liebeswünsche beflügelten.
Ganz sicher kann ich heute sagen, dass sexueller Missbrauch in Seelsorge und Beratung immer auch mit dem Gewordensein, mit der Prägung in der Familie, mit Vererbung, mit der Persönlichkeit dieses Menschen und seinen positiven oder negativen Erfahrungen zu tun hat. Der Hochsensible erlebt alles intensiver, oft auch negativer.