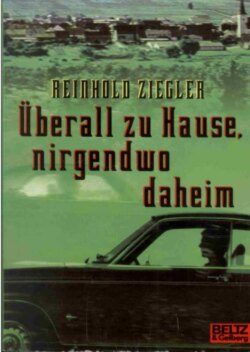Читать книгу Überall zu Hause, nirgendwo daheim - Reinhold Ziegler - Страница 2
2. KAPITEL
ОглавлениеDas Rathaus liegt am anderen Ende vom Ort, ich musste quer durch ganz Waldweibersbach laufen. Wie eine mittelalterliche Trutzburg überragt der protzige zweistöckige Neubau aus glatten, roten Spessartsandsteinquadern die brüchigen, groben Klötze der einstöckigen Bauernhäuser im alten Dorf. Viel zu teure Anlagen drum herum, ein kleiner Teich, sauber gezirkelte Parkplätze, viel zu viele für die Handvoll Gemeindebedienstete und die zwei oder drei Besucher, die wegen einer Passverlängerung, eines Aufgebots oder eines Trauerfalls den Weg bis zum Dorfrand auf sich nehmen. Eine akkurat gemähte Wiese, stiefmütterlich umrahmt, geleitet hinüber zum größten – und teuersten – Gebäude des Ortes, dem Bau der Freiwilligen Feuerwehr Waldweibersbach. Durch die Drahtglasscheiben von vier grauen Stahltoren schimmerten vertrauenerweckend feuerrot vier hochmoderne Löschfahrzeuge. »Wir lassen nichts anbrennen«, schienen sie zu signalisieren. Auch wenn der letzte Brand in Waldweibersbach sieben Jahre zurücklag und zum Entsetzen der Freiwilligen aus dem Dorf die Berufsfeuerwehr aus der Stadt zehn Minuten früher vor Ort war und schon alles gelöscht hatte, gilt die Feuerwehr im Ort als heilig – heiliger noch als die katholische Kirche, deren plumper Ziegelsteinturm denn auch vom modernen Schlauchturm der Feuerwache um einige Zentimeter überragt wird.
Das Rathaus wird von einer schweren Eichentür mit eingeschnitztem Gemeindewappen unter Verschluss gehalten, die ich nur mit aller Kraft auf wuchten konnte. Ein strenger Geruch nach Papier, Schweiß und Putzmittel dünstete mir entgegen, einen Moment lang stand ich wie betäubt, dann weckte mich die hinter mir ins Schloss fallende Tür. Hippie war neben mir in die Vorhalle geschossen, kam auf dem spiegelglatt gewienerten Linoleum sofort ins Schlingern und trat dann, angepasst und vorsichtig, neben mir den Weg durch die Instanzen an. Das Haus wirkte verlassen. Ich nahm Hippie an die Leine, um den Beamtenapparat nicht wie gestern durch Zungenküsse durcheinanderzubringen, und klopfte dann. Das Vorzimmer erwies sich als leer, erst als ich es eigenmächtig durchquerte, wurde die zweite Tür auf mein Klopfen hin geöffnet.
»Da sind wir ja, Herr Weber – guten Tag.« Der Bürgermeister streckte mir, mit misstrauischem Seitenblick auf Hippie, die Hand hin. Ich nahm sie, es fühlte sich merkwürdig an, also schaute ich unwillkürlich hin, sah für einen Augenblick, bevor er sie mit der Linken verdeckte, dass am Zeigefinger der rechten Hand ein Teil des letzten Gliedes fehlte. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht bemerkt, hätte es auf jeden Fall wieder vergessen, wären da nicht dieses schnelle Verstecken und sein anschließender irritierter Gesichtsausdruck gewesen. So blieb mir sein kleiner Makel im Gedächtnis, aber es dauerte über ein Jahr, bis ich verstand, was es mit dem verdammten Finger auf sich hatte.
Seine Irritation verflog so schnell, wie sie sein Gesicht überzogen hatte, nur ein kleiner, kaum merklicher Hauch blieb zurück. Ich spürte seine Feindseligkeit, trotz seiner sülzigen, bemüht hochdeutschen Rede, zu der er ansetzte.
»Wie schon am Telefon erwähnt, lieber Herr Weber, also wir hätten Ihnen da eine kleine Wohnung gefunden, in der Sie sich bestimmt eine sozusagen ewige Heimat in unserer schönen Gemeinde einrichten können. Bevor wir aber jetzt gemeinsam dorthin fahren, möchte ich Ihnen nochmals betonen, dass es nicht meine Sache ist, dafür geradezustehen, also für die Wohnung. Ihrem unverblümten Erpressungsversuch wollte ich aber, als praktizierender Katholik, als der ich mich immer verstanden habe, einen demonstrativen Akt christlicher Nächstenliebe dagegensetzen. Ich hoffe«, fuhr er fort, »dass wir beide in dieser Zeit, die nun einmal vor uns liegen muss, nicht wie...«
Während seiner Rede hatte Hippie begonnen, unruhig hin und her zu trippeln, nun sprang er plötzlich auf, winselte, jaulte und quiekte wie ein kleines Kind. Verunsichert bis in die Haarspitzen unterbrach der Bürgermeister seine bis dahin vorgetragenen Ausführungen und fragte erschrocken: »Was hat der jetzt?«
»Er wird mal rausmüssen«, sagte ich, »immer wenn’s dem komisch wird, drückt ihn der Darm.«
Hastig schob der Bürgermeister ein paar Papiere zusammen und stand auf. »Dann lassen Sie uns lieber gehen, es ist ohnehin alles gesagt.«
Er flog geradezu vor Hippie und mir die Treppe hinab, riss die Eichentür weit auf, Hippie schoss raus, irrte verzweifelt auf der Wiese herum, bis er den Asphalt der Feuerwehrausfahrt entdeckte, kam dann dort zur Ruhe und produzierte seinen unvermeidbaren Haufen.
»Es ist ein Stadthund, Herr Bürgermeister, er kann nun mal auf der Wiese nicht – ich mach’s gleich weg.«
Im brabbelnden dunkelgrünen Bauernmercedes kutschierte er uns durch das ganze Dorf, fast zurück bis zur Mühle, wo ich gerade gegessen hatte, dann rollte er in eine Einfahrt und stoppte den Wagen auf dem Hof eines großen Anwesens. In U-Form umgaben verschiedene Gebäude den teils gepflasterten, teils lehmigen Hof, der selbst an diesem heißen Augusttag von zwei riesigen Kastanien in angenehm kühlen Schatten getaucht wurde. Rechts begrenzte ein relativ neues, weiß verputztes Wohnhaus den Hof, mit seiner Blumenpracht vor den Fenstern und den Pflanzenkübeln links und rechts der Eingangstür leuchtete es aus dem grauen Verfall der übrigen Gebäude wie eine neue Jacketkrone aus einem ansonsten morbiden Gebiss. Vor dem Haus, fast getarnt durch die harmlosen Pflanzkübel, bebte eine Hundehütte. Aus dem Halbrund des Eingangs drohte ein riesiger, struppiger Kopf, der, wie ich später erfuhr, zum Hofbastard Agathe gehörte. Durch ihre riesige Erscheinung und ihr martialisches Gebell schaffte sie es, jeden Fremdling so einzuschüchtern, dass sie es in ihrem ganzen Leben nie nötig hatte, auch nur ein einziges Mal wirklich von ihren Kräften Gebrauch zu machen. Wie um zu beweisen, dass sie sehr wohl in der Lage war, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, machte sie, noch immer furchterregend bellend, zwei kleinen Kätzchen Platz, die verschlafen aus ihrer Hütte kullerten und sich in Richtung Scheune verzogen. Hippie saß, zitternd wie Espenlaub, im Fußraum des Wagens und traute sich nicht auszusteigen – mir ging es nicht viel anders.
Das Ende des Hofes, in den uns der Bürgermeister verschleppt hatte, wurde durch eine querstehende, offene Scheune gebildet, in der rote und grüne Ackergeräte dicht gedrängt zusammenstanden. Nur der Anführer der Maschinen, der übergroße silberschwarzrote Massey-Ferguson-Traktor, stand, seine Überlegenheit und Unabkömmlichkeit beweisend, souverän im hellen Sonnenlicht davor. Im linken, flachen Gebäude mit seinen verlotterten Stallfenstern und dem Welleternitdach waren die Milchkühe des Hofes untergebracht. Müdes Muhen drang von dort ab und zu ins Freie, ansonsten lag der Hof, nachdem auch Agathe sich endlich beruhigt hatte, in sommerlich fauler Stille.
»Kommen Sie mit, Herr Weber«, forderte mich der Bürgermeister auf, »der Hund ist bestimmt harmlos – wir müssen dort hinten hinein.«
Das, was er mit dort hinten meinte, war kein Haus, es waren allenfalls die Reste eines Hauses, angebaut an den Kuhstall, mit seiner hinteren Ecke versteckt im Dunkel hinter dem Ge-
räteschuppen, der offensichtlich später irgendwann einmal davorgestellt worden war.
Ich muss wohl ziemlich entsetzt stehengeblieben sein, als mir schlagartig klar wurde, wo ich, durch den einmaligen Akt christlicher Nächstenliebe, meine neue Heimat finden sollte, jedenfalls zog mich der Bürgermeister geschäftig am Ärmel weiter. Wir gingen auf den Eingang des Hauses zu, nur ein schmaler Trampelpfad schlängelte sich zwischen rostigen Geräten aller Art der schiefen Eingangstür entgegen. Ich war schon beim Anblick des Hauses kurz davor, in Panik zu verfallen. Der Firstbalken hing durch, und mehrere Fensterstürze waren in der Mitte gesprungen, im Untergeschoß hingen zersplitterte Fensterflügel schief in den Angeln, und nur der Anblick eines ehemals altrosa-weiß lackierten Opel-Olympia- Rekord-Caravan-Autowracks mitten im Schrottberg vor dem Haus konnte mich minimal mit der Gegend versöhnen.
Ich bewegte mich trotzdem nicht weiter. »Ist das Ihr Ernst?« fragte ich den Bürgermeister, aber er versuchte mich immer weiter auf das Haus zuzuziehen. Ich hasse es, wenn mich jemand rumzerrt, also bockte ich direkt vor der offenstehenden Tür des Kellers, aus der ein Geruch wie aus einer schlecht verschlossenen Grabkammer drang.
Der Bürgermeister ließ von mir ab und brüllte jetzt zu einem Dachfenster hoch: »He, ist da jemand?«
Es dauerte eine Weile, dann tauchte hinter der Scheibe ein Gesicht auf, aber erst als das dreckige Fenster geöffnet wurde, erkannte ich ihn, es war der halb verrückte Alte aus der Post.
»Grüß dich, Opa Alfred!« rief der Bürgermeister hoch. »Du hast uns doch mal einen Zettel reingeworfen, dass du ein Zimmer vermieten willst, weißte das noch?«
»Was hab ich?«
»Ein Zimmer zum Vermieten!« »Wenn ihr die Miete zahlt, könnt ihr mir Asylanten schicken, hab ich gesagt, Hofschmied!«
Erschrocken drehte sich der Bürgermeister zu mir. »Hören Sie gar nicht hin, er weiß manchmal nicht mehr so recht, was er redet.« Und dann wieder hoch: »Asylanten hammer keine, Opa Alfred, aber der junge Mann hier, das ist der neue Lehrer. Dem kannste doch auch vermieten.«
»Kann der auch putzen, den Hof kehren und Holz machen?«
»Das macht der alles, Opa«, und zu mir: »Sie wissen doch, wie man fegt und Holz spaltet, oder?«
»Das ist nicht Ihr Ernst, oder?« fragte ich noch einmal den Bürgermeister, und nachdem der entschlossen nickte, drehte ich mich wortlos um, um die Szene zu verlassen. Er stellte sich mir in den Weg.
»Bitte, Herr Weber, bitte. Ganz wie Sie wünschen. Aber wir haben getan, was wir konnten. Wir sind eine Gemeindeverwaltung und kein Maklerbüro, schon gar nicht eines für überzogene Komfortansprüche. Aber Sie sind ja ein freier Mann und können machen, was Sie wollen. Nur – bis heute abend ist dieses Zelt vom Fußballplatz verschwunden, sonst gebe ich mal unseren Aktiven einen Tip, die zeigen Ihnen dann, wofür wir hier ein Sportfeld benutzen – alles klar?«
Mit dieser für seine Verhältnisse tatsächlich ungewöhnlich klaren Aussage machte Werner Hofschmied kehrt, stieg mühsam in seinen Wagen und fuhr vom Hof. Ich blieb alleine zurück.
Wie hundertmal danach stand sie auch bei diesem ersten Mal plötzlich hinter mir, aufgetaucht aus dem Nichts.
»Und jetzt?« fragte sie. Ich denke, dass es diese Stimme war, die mich damals sofort packte, eine rauchige, junge Frauenstimme, aber doch viel zu alt, viel zu erfahren, zu verrucht für
das Gesicht, aus dem sie kam. In diesem Gesicht ihre Augen, zu jung, zu naiv und kindlich, schwarze Augen, groß und offen, bereit, alles zu entdecken, unruhig und staunend. Das Mädchen, die Frau, das Kind – das Wesen, zu dem all das gehörte, stand neben mir, schaute hoch zu mir, offen und frech, pak- kend, krallend, festhaltend zugleich. Da war ein Sog in ihren Augen, ein Sog in ihrer Stimme. Wie alt sie wohl war? Sie brachte mich mit ihren zwei Worten »Und jetzt?« völlig aus der Fassung, ich versteinerte bei dieser ersten Begegnung unter ihrer Macht, gegen die ich damals keine Chance hatte.
»Ich heiße Luise«, sagte sie dann. Und, als hätte ich das, was mir im Kopf herumging, tatsächlich gefragt und nicht nur gedacht, antwortete sie: »Ich bin sechzehn. Wenn ich siebzehn werde, machen wir ein schönes Fest.«
Dann beugte sie sich zu Hippie runter, der anscheinend genauso gebannt war wie ich, jedenfalls hatte er sie weder geküsst noch einen Muckser von sich gegeben. Sie kraulte ihm kurz das Fell und ließ ihn dann von der Leine. »Der braucht keine Leine mehr, der weiß jetzt, wo er hingehört.« Dann drehte sie sich wieder zu mir. »Komm«, sagte sie, »wir gehen jetzt mal zum Opa rein.«
Sie ging voran, nahm mich bei der Hand wie einen Schulbuben, aber ich wäre ihr auf jeden Fall gefolgt. Wir schlängelten uns durch das Gerümpel zu dem alten Haus, sie drückte die Tür auf, ein modriger, kühler Geruch schlug uns entgegen. »Ich bin’s, Opa«, rief sie die alte Treppe hoch und zeigte mir dann, ohne auf Antwort zu warten, den ersten Raum auf der rechten Seite. »Hier war früher die Stube.«
Mit meinen sonnenblinden Augen konnte ich im Halbdunkel nichts erkennen, sah nur ein heilloses Durcheinander, aufeinander getürmte Möbel und Geräte, alles graufarbig eingestaubt, ein monochromes Zerfallskunstwerk. Sie zog mich mitten rein.
»Der Tisch ist noch der alte, den kannst du nehmen. Der Ofen ist auch noch gut, den machen wir sauber und bessern die Ausmauerung aus, dann ist der wie neu. Und siehst du die Tür da, das ist die Küche. Da können wir nur jetzt nicht rein, weil der Papa seinen ganzen Dünger da drin liegen hat – aber ich kann dir beim Ausräumen helfen.«
Und dann plötzlich, als habe ihre Vertrautheit sie selber überrascht: »Ich kann doch du sagen, oder?«
Ich nickte nur, hielt sie noch immer bei der Hand und suchte im Chaos meiner Gedanken vergeblich nach etwas, aus dem ich einen Satz oder wenigstens ein Wort formen konnte.
Sie war schon wieder woanders. »Und dann ist hier unten noch ein Schlafzimmer, das ist aber nicht mehr so gut, und ein Bad, hinten an der Küche. Und oben sind auch noch drei Zimmer – komm mit hoch!
Ich bin’s, Opa«, rief sie wieder nach oben.
Der Alte saß bewegungslos auf einem schmuddeligen Ledersessel in einem der oberen Zimmer, die Tür stand offen, sein Blick war stier auf uns gerichtet.
»Lassen Sie sofort meine Enkelin los«, blaffte er, noch bevor wir ganz oben waren. Erst jetzt merkte ich, dass sie noch immer meine Hand hielt, wollte sie zurückziehen, aber sie hielt mich fest.
»Ich bring dir deinen neuen Mieter«, sagte sie zu ihm.
Ich erwartete einen neuen Blaffer, aber erstaunlicherweise blieb er ganz ruhig. Was seine Enkelin Luise sagte, schien für ihn unangreifbar zu sein, er machte nicht einmal mehr einen matten Versuch, die Tatsache eines neuen Mieters anzuzweifeln.
»Aber gehascht wird bei mir nicht, und keine Sauereien. Das ist mein Haus, das kann ich beweisen, und ich bestimme hier.« Und zu Luise: »Macht der sein Klo sauber? Und schreit der nachts auch nicht?«
»Ist schon gut, Opa«, sagte sie liebevoll zu ihm, da gab er Ruhe. Er lehnte sich in seinen Sessel zurück und beobachtete uns.
»Opa, hör mal zu, der Lehrer will das ganze untere Stockwerk, wir richten das wieder her – wieviel Miete willst du dafür?« »Mindestens tausend Mark!« sagte er gierig.
Das war für mich wie ein Schwall kalten Wassers, der mich endlich aus dieser irrealen Theatervorstellung erlöste. Ich ließ die Hand des fremden Mädchens namens Luise los, drehte mich um, stolperte die Treppe runter, raus in den Hof. Die Hitze schlug mir dumpf entgegen. Ich suchte Hippie, entdeckte ihn dann vor der Hundehütte. In Spielhaltung, den Hintern weit hochgereckt und wild mit dem Schwanz wedelnd, versuchte er Agathe aus ihrem Haus zu locken.
Wieder war sie plötzlich hinter mir. »Ich will, dass du bleibst!« sagte sie. Ihre Augen, ihre Stimme, ich spürte wieder, wie diese Macht nach mir griff, Krallen hatte sie diesmal und fühlte sich gefährlich an, keine Chance für mich, zu entkommen und derselbe zu bleiben, der ich vorher im Leben gewesen war. »Er will tausend Mark für die Bruchbude, der spinnt doch«, protestierte ich schwach.
»Natürlich spinnt er, komm wieder mit rein, ich glaube, er hat’s als Scherz gemeint.«
Sie nahm wieder meine Hand, zog mich wieder ins Dunkel, hoch die Treppe und dann nach links in einen Raum, den ich bis dahin noch nicht bemerkt hatte. Teddy-Kindertapete an den schrägen Wänden, ein altes Eisengestell-Bett, ein verwohnter Schrank. Trotzdem war der Raum in weit besserem Zustand als alle anderen Zimmer des Hauses, die ich bisher gesehen hatte. Das Fenster war geputzt, der Boden gefegt, und von dem Modergeruch, der das übrige Haus durchzog, war hier kaum etwas zu riechen.
»Hier kannst du bleiben, bis wir unten alles fertig haben. Es ist mein Zimmer, weißt du. Aber ich bin nur manchmal hier, wenn ich allein sein muss oder wenn der Opa mal gar nicht klarkommt.«
»Ich weiß nicht recht«, sagte ich, aber sie ließ meine Bedenken nicht zu.
»Ich will, dass du bleibst!« wiederholte sie langsam und beschwörend, und unter ihrem Zauber brach mein Widerstand zusammen.
Vom Gang her hörte man schlurfende Schritte, dann stieß der Alte die Tür auf. »Aber wenn er das Klo nicht putzt oder im Schlaf schreit, schmeiß ich ihn raus, es ist mein Haus!«
Das Mädchen legte dem Alten zärtlich die Arme um die Schultern. »Opa«, sagte sie, »er gibt dir jeden Monat zweihundert Mark, und wir machen unten alles wieder schön. Bis das fertig ist, schläft er hier oben.«
Der alte Mann machte sich frei, drehte sich wortlos um und ging zu seinem Ledersessel zurück. »Wenn der nur einmal sein Klo nicht putzt, schmeiß ich ihn sofort raus«, grummelte er. Das Mädchen sah mich wieder an, als hätte ich noch die Macht, etwas zu entscheiden. Da ich nichts sagte, nickte sie mit dem Kopf. »Der Opa ist auch einverstanden!« sagte sie, und tatsächlich nickte der Alte. Ohne es wirklich zu wollen, nickte auch ich – der Vertrag war geschlossen.
Ich folgte ihr nach draußen in den Hof, jetzt, wo es entschieden war, fand ich langsam meine Fassung wieder.
»Du weißt nicht einmal, wer ich bin«, sagte ich.
Sie lachte. »Du bist der neue Lehrer, du heißt Karl, stimmt’s?«
»Karl sagt nur meine Mutter, eigentlich heiß ich Karl-Dietrich, so hat mein Vater früher immer gesagt, und in Berlin haben sie mich Kadewe getauft.«
»Kadewe klingt super, das sag ich auch. Zu mir sagen sie Lui.«
Sie konnte den Sog ihrer Augen an- und abschalten wie eine Lampe. Jetzt war sie der nette, hübsche Teenager, harmlos und eher kindlich, ein nettes Bauernmädchen in Arbeitshose und T-Shirt, dunkelbraune, halblange Haare und schwarze, liebevolle Augen, ohne Geheimnis oder Gefahr.
»Du musst deine Sachen holen, Ka-de-we«, sagte sie und genoss hörbar den fremden Namen, »ich bleibe hier und warte auf euch, falls dich der Opa nicht wiedererkennt.« Dann rief sie Hippie zu sich, und erstaunlicherweise gehorchte er ihr und kam sofort. »Komm her, mein Kleiner«, sagte sie und kraulte ihm das Fell, »dein Herrchen und du, ihr wohnt jetzt hier, brauchst heute Nacht nicht mehr im Zelt zu schlafen.«
»Was haben wir jetzt nur wieder angestellt?« sagte ich zu Hippie, als wir durch die heiße Nachmittagssonne zurück zum Sportplatz liefen, aber er antwortete nicht, schien mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. Unter den kritischen Blicken einiger Anwohner baute ich mein Zelt ab und verstaute alles im Goggo. Ich hätte Lust gehabt zu rufen »Sehr verehrte Damen und Herren, hiermit ist die Ruhe im Dorf wiederhergestellt«, aber ich wollte die armen Leute nicht noch mehr verunsichern, also fuhr ich grußlos davon.
Lui winkte schon vom Hoftor aus. Sie freute sich kindlich, als sie mein Auto sah, hüpfte drum herum und wollte mich sofort zu einer Probefahrt zwingen. Nur der völlig zugebaute Beifahrersitz konnte sie überzeugen, dass wir erst auspacken mussten.
»Ich hab dich gestern schon gesehen!« rief sie. »Manta hätte dich fast platt gemacht.«
Ich hörte diesen seltsamen Namen, aber ich kam nicht dazu, sie zu fragen, wer Manta war.
Es war ein Hindernislauf, zwischen all dem Schrott mit meinen Taschen ins Haus zu kommen, Gott sei dank passt nicht viel in
so ein Goggo, und wir mussten nur dreimal laufen. Beim ersten Mal stoppte sie mich kurz vor der Haustür.
»Ganz, ganz wichtig, Kadewe. Immer wenn du ins Haus gehst, musst du dem Opa vorher rufen, damit er weiß, wer es ist – sonst kriegt er Angst.« Und um gleich zu demonstrieren, wie sie das meinte, drückte sie sich an mir vorbei, schob die Tür auf und rief: »Opa, hier kommt dein neuer Mieter!« Aber antworten, erklärte sie, würde er nie.
Dann musste ich noch unbedingt mit rüber in den Neubau, den Rest der Familie Reusten kennenlernen. Die Mutter begrüßte mich recht herzlich, sie betrachtete mich lange mit denselben tiefen, dunklen Augen, wie sie auch ihre Tochter hatte. Sie fragte mich nicht aus, sondern sie sah mich an, als ob sie schon alles über mich wüsste.
Plötzlich tauchte Luis Vater auf, ein Bauer, wie man ihn sich vorstellt, grobe Schuhe, Arbeitshose, kariertes Hemd, sonnenverbranntes Gesicht. Was so gar nicht passen mochte, war die Videokamera, die er vor sich in den Raum schob.
»Ach Papa«, sagte Lui, »muss das jetzt sein?«
Aber er ließ sich nicht abhalten, filmte mich, Lui, Hippie, schwenkte raus in den Hof, zoomte auf mein Goggo, hielt dann auf das alte Haus und sprach den gedankenschweren Kommentar: »Opa bekommt einen Mieter!« Erst als das alles erledigt war, ließ er die Kamera sinken und schüttelte mir kräftig die Hand. »Willkommen auf unserem Hof, Herr Weber.«
Sie boten mir einen Kaffee an, wir saßen in der modernen Küche mit Blick auf den schattigen Hof, redeten und erzählten, als kennten wir uns schon seit langer Zeit. Keiner schien überrascht, es war, als hätten alle schon geraume Zeit auf mein Erscheinen gewartet.
Später kam Heiner hinzu, Luis großer Bruder, sechs, sieben Jahre mochte er älter sein. Er war ein grober, mir unangenehmer Typ, ein Dorfjunge, den innerhalb der engen Grenzen seiner Welt nichts erschüttern kann. Er parkte seinen GTI rasant im Hof, kam mit schweren Schritten in die Küche gestapft, ließ sich die neue Situation kurz erklären und drückte mir dann etwas zu kräftig die Hand. Schon in diesem Moment spürte ich den Machtkampf, auf den er aus war und den ich nicht bereit war aufzunehmen.
»Viel zupacken kann er mit den Händchen aber nicht, der wird keine große Hilfe auf dem Hof sein«, sagte er zu seinem Vater.
»Halt dich zurück«, zischte Lui ihn an, und es blitzte gefährlich in ihren Augen. Erstaunlicherweise gab er sofort seine feindliche Haltung auf.
»Also dann«, sagte ich.
Lui kam mit raus.
»Gehst du eigentlich noch in die Schule?« fragte ich sie. »Oh, nie wieder, ich hab gerade die Realschule hinter mir, mir langt’s.«
»Und was hast du seitdem gemacht?«
»Gewartet«, sagte sie lachend, aber sie sagte nicht, worauf.
Am Abend – ich war erschöpft von all dem Neuen, geplättet von der Hitze – lag ich oben auf dem Bett mit dem schweren Eisengestell, stierte Löcher in die schräge Decke, dachte an alles und nichts, genoss nur die immer kühlere Luft, die eine Abendbrise durch das weit geöffnete Fenster hereinwirbelte. Es klopfte kurz, und Lui schlüpfte zur Tür rein.
»Was machst du heute Abend?«
»Ausruhen«, sagte ich, »lesen, nachdenken. Überlegen, wie ich alles organisieren kann, und sehen, was die Zukunft bringt.«
»Dabei kannst du gar nicht sehen, was die Zukunft bringt, das können nur wenige«, sagte sie mit ihrer rauchigen Stimme, und dann, nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten: »Soll ich dir von deinem Haus erzählen?
Es gehört dem Opa«, fing sie an, »er hat es von der Mama geschenkt bekommen. Eigentlich gehört nämlich der ganze Hof der Mama, weißt du. Und hier hat sie früher gewohnt. Sie und die Oma, aber die ist schon lange tot. Die hat nach dem Krieg keinen Mann mehr gehabt und war ganz alleine hier.«
Lui erzählte die Geschichte des Reustenhofes wie ein Märchen, ein Märchen, das mit ihrer Großmutter und dem Hofhund Agathe irgendwann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begann.
»Agathe?« fragte ich. »Aber die kann doch nicht ...« »Agathe!« unterbrach mich Lui und erzählte weiter.
In den ersten Jahren der Nachkriegszeit war der Hof von der kriegsverwitweten Großmutter alleine geführt worden, mehr schlecht als recht hatte sich die gut Vierzigjährige mit ein paar Milchkühen und einem Schwein pro Jahr über Wasser gehalten, hatte ab und zu einen Acker verkauft, um wieder ein bisschen Geld fürs Nötigste flüssig zu haben, und ansonsten auf ein Wunder gewartet – ein Wunder in Form eines Mannes, der sie trotz ihres Alters und ihres krummgeschafften Rückens noch nehmen würde.
Und das Wunder kam – allerdings nur für eine Nacht, dann war es über die Spessarthügel in Richtung Ascheberg verschwunden. Was nun zu all dem anderen Mangel blieb, waren der Mangel einer Illusion und ein dicker Bauch, der später den Namen Martha bekam. Martha, Luis Mutter, wurde 1948 geboren, lernte von ihrem ersten Lebenstag an die Einsamkeit, mit einem Jahr das Beten, mit vier Jahren das Melken und mit sechs in der damaligen Einklassenschule von Waldweibersbach die ersten ungelenken Schriftkringel, die sich bis heute als ihre Handschrift erhalten haben.
Lui kramte aus ihrem Schrank ein Foto hervor, es war das Firmungsfoto ihrer Mutter. Eine frühentwickelte, derbe Schönheit, deren große, schwarze Augen und deren sinnlicher Mund verrieten, dass ihr Interesse bereits in diesem Alter weit jenseits von Puppenwagen und Sandkästen lag.
Sie war noch keine siebzehn, als sie auf der alljährlichen Waldweibersbacher Kirchweih auf Adolf Reusten stieß, einen groben fünfundzwanzigjährigen Dorfburschen aus dem Odenwald, Halbwaise seit den letzten Kriegstagen, als eine verirrte Panzergranate vor den Augen des Fünfjährigen Haus und Mutter in Stücke gerissen hatte.
Adolf, allein mit seinem Vater und ohne Haus oder Hof, war seither auf der Suche nach Heimat und Lebenssinn, nach Arbeit, Unterkunft und Auskommen. All dies schuf er sich in ein paar Minuten, irgendwo im Unterholz zwischen Bahnlinie und Kirchweihplatz, als er mit ein paar wilden, groben Bewegungen seines massigen Körpers der lebenshungrigen, neugierigen Hoferbin Martha ein Kind machte. Schon zwei Monate später war Hochzeit, denn Marthas Mutter bestand darauf, dem in Suff und Sünde gezeugten Balg wenigstens eine christliche Geburt auszurichten.
Trotzdem hatte die Oma 1965 durch ihre sechzehnjährige Tochter endlich das, worauf sie zwanzig Jahre lang gehofft hatte – einen Bauern auf ihrem Hof und einen schreienden Erben namens Heiner in der Kinderwiege. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte die verbrauchte Frau die Hände in den Schoß legen und die Arbeit dem jungen Mann überlassen, aber die ungewohnte Ruhe tat ihr nicht gut, bereits die Geburt ihrer Enkelin Luise sieben Jahre später sollte sie nicht mehr erleben.
»Als der Papa dann auf dem Hof war, muss sich hier alles sehr schnell geändert haben«, erzählte Lui weiter.
Adolf Reusten, autoritär und voller Energie, hatte den runtergewirtschafteten Hof schnell wieder auf die Beine gebracht. Er kaufte alte Äcker zurück, schaffte neue Maschinen an, erweiterte den Stall, baute den großen Geräteunterstand. In einem Gewaltakt, mit viel Nachbarschaftshilfe und immensen Eigenleistungen, stellte er Mitte der siebziger Jahre seiner Familie das neue Wohnhaus in den Hof. Endlich waren die Räume hell und die Fenster dicht, endlich keine Mäuse mehr im Vorratsraum und keine Ratten mehr im Keller. Adolf Reusten hatte erreicht, wonach er immer gesucht hatte, Anerkennung und eine neue Heimat.
Das alte Wohnhaus blieb nach dem Umzug leer stehen. Wurden in den ersten Wintern noch ab und zu die Öfen durchgeheizt, im Herbst die Spinnweben beseitigt und im Frühjahr die Fenster geputzt, so verfiel das unbewohnte Haus in den nächsten Jahren mehr und mehr. Alte Möbel wurden dort gestapelt, bis Mäuse und Holzwürmer ihren endgültigen Verfall besiegelten, das Bad wurde zur Werkstatt, die Küche zum Düngerlager. Alles, was möglicherweise irgendwann noch einmal nützlich sein konnte, aber im Augenblick überflüssig war, wurde rund um das Haus gelagert. Schwere Eichenbalken aus dem Abriss der alten Scheune, stapelweise Dachziegel, eine alte Egge, ein Pflug, der nicht mehr an den neuen Traktor passte, die Reste eines Ochsenkarrens, Blechtonnen, zersprungene Fenster und schließlich sogar das Wrack des ersten Wagens der jungen Reustenfamilie, der schon damals gebraucht gekaufte 1960er Opel-Kombi, altrosa mit einem weißen Dach.
»Der Papa wollte ihn nie wegschmeißen – es war sein erstes Auto!«
»Und seit wann ist der Opa da?« fragte ich.
»Der Opa kam vor ungefähr zehn Jahren. Das ging nicht mehr mit ihm alleine da oben im Odenwald, da hat der Papa ihn irgendwann einfach mitgebracht.«
Das alte Haus, in das man den Alten stecken wollte, erwies sich schon damals als nahezu abbruchreif. Drei Wochen brauchte die Bäuerin, um zusammen mit dem fünfzehnjährigen Heiner wenigstens den oberen Stock einigermaßen bewohnbar zu machen – so lange wohnte der Alte mit im Neubau. Aber auch dann war er nicht zu bewegen umzuziehen, bis Martha seine Starrköpfigkeit schließlich überlistete, indem sie ihm das Haus notariell überließ. »Ich will endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf«, hatte er gezetert, und er hatte es bekommen.
Die Pflege des eigenwilligen Alten aber rutschte mehr und mehr in die Verantwortung der heranwachsenden Luise. Sie war die einzige, die sich mit ihm verstand, die einzige, die er, ohne sie zu beschimpfen oder ihr zu misstrauen, sogar in eines seiner beiden Zimmer ließ, damit sie dort fegen und nach dem Rechten sehen konnte. Im dritten Zimmer, dort, wo nun auch
ich ein Zuhause angeboten bekam, hatte sich Lui selber wieder eingerichtet. Es war vor dem Umzug ihr Kinderzimmer gewesen, und sie war einfach Jahre später wieder eingezogen. »Ich spüre manchmal«, sagte sie, als sie ihre Geschichte zu Ende erzählt hatte, »dass mit dem Haus etwas Besonderes ist. Ich spüre, dass es wieder jung wird. Nicht nur du bist gekommen, es werden noch mehr kommen.« Sie stand auf. »Das Haus lebt wieder, du wirst es selber spüren – gute Nacht.« Es war schon dämmrig draußen. Lautlos verließ sie das Zimmer. »Ich bin’s, Opa«, rief sie leise auf dem Gang, dann hörte ich am Knarren der Tür, dass ich mit dem Alten allein war. Über mir im Karree des Dachfensters gingen die Sterne auf. Wirre Geschichten drehten sich in meinem Kopf, manchmal spürte ich ihre schwarzen Augen auf mir, manchmal hallte noch ihre Stimme im Raum. Erst das leise, gleichmäßige Schnarchen von Hippie unter meinem Bett half mir hinüber in den Schlaf.