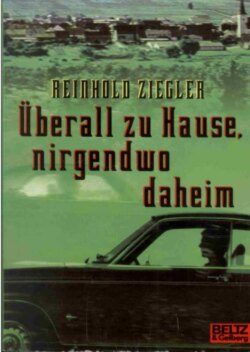Читать книгу Überall zu Hause, nirgendwo daheim - Reinhold Ziegler - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. KAPITEL
ОглавлениеFünf Tage hatte ich noch, fünf Tage, eingeklemmt zwischen diesem ersten Abend mit Lui, in dem kleinen, muffigen Zimmer unter dem Dachfenster, und dem Schulanfang. Fünf Tage mit Lui. Sie wich nicht von meiner Seite, und, um ehrlich zu sein, ich machte auch wenig Anstrengungen, sie von dort zu vertreiben. Sie brachte mir euterwarme Milch zum Frühstück, fuhr mit mir im Goggo los, um mir die Stadt zu zeigen, erklärte mir das Dorf und ihre Welt bis zum Abend, wenn sie sich mit einem »Gute Nacht, Kadewe, bis morgen« verabschiedete. Ihre Augen leuchteten in meinem Kopf weiter, wie eine Bildröhre nachleuchtet in einem dunklen Zimmer. Dann lag ich wieder auf der Matratze, ließ mir heute, gestern und morgen durch den Kopf ziehen und dachte doch eigentlich nur an sie.
Sie sagte: »Ich hab gehört, du hast in Berlin eine Freundin.«
»Woher willst du das gehört haben?« fragte ich sie.
»Ich höre soviel«, sagte sie nur, das sagte sie oft, »ich höre soviel«, und ihre Augen waren seltsam fremd, wenn sie es sagte.
Ich nahm ihre sechzehn Jahre mal zwei und kam auf zweiunddreißig. Ich zählte meine eigenen Jahre und kam auf einunddreißig. Manchmal, wenn ich abends dalag und sie mir vorstellte, kam ich mir vor wie ein Kindsverführer.
Aber wir tauschten nicht nur verliebte Blicke, wir arbeiteten auch viel in diesen fünf Tagen, bevor für mich der Schulalltag begann.
Lui schien nicht besonders viele Pflichten auf dem Hof zu haben, sie war ständig bei mir und half, und jeder fand es in Ordnung, ihr Bruder Heiner vielleicht ausgenommen, aber den versuchte ich so gut es ging zu ignorieren.
Schon nach den ersten zwei Stunden, in denen wir begonnen hatten, das Erdgeschoß auszuräumen, türmte sich ein riesiger Haufen Unrat und Möbel, Abfälle und Gerümpel im Hof. Abends spannte der Bauer seinen Traktor vor den großen Anhänger, wir warfen alles drauf und fuhren es zusammen zur Müllkippe. Es war das erste Mal, dass ich auf einem Traktor mitfahren durfte, Lui merkte es und fühlte sich stolz und überlegen.
Das größte Problem aber war der verdammte Dünger in der Küche. Ich hab sie nicht gezählt, aber es müssen Hunderte von Säcken gewesen sen. Vierzig Kilo pro Sack, Heiner kam mir immer lächelnd mit der Last auf der Schulter entgegen, wenn ich schnaufend und dem Ende nahe zurück wankte, um den nächsten Sack auf meinen geschundenen Städterkörper zu laden. Der Nitrophoska-Gestank in der Küche blieb mir ewig erhalten, in den ersten Wochen meinte ich, ihn auf jedem Brötchen, in jedem Glas Bier zu schmecken, später nahm ich ihn nur noch wahr, wenn ich von draußen kam und meine Riechzellen sich resensibilisiert hatten. Wer immer mich besuchen kam, rümpfte die Nase.
Der Alte im Dachgeschoß war nicht bereit, auch nur eine müde Mark für sein Haus auszugeben. Ich brauchte zwei neue Fenster und musste den Türsturz austauschen lassen. Aber Lui reagierte schnell, informierte ihren Vater, und der sprang kommentarlos in die Bresche. Leute kamen vorbei, irgendwelche Freunde und Handwerker aus dem Dorf, und ein paar Tage später waren die Sachen in Ordnung.
Immerhin schafften wir es bis zum Montagmorgen der Lehrerkonferenz, die drei unteren Räume zumindest auszuräumen und zum Tapezieren vorzubereiten. Leer waren sie größer, als es am Anfang ausgesehen hatte, ich fing an, mein Leben in sie hineinzudenken, und begann mein Häuschen zu mögen.
Am Morgen vor der Lehrerkonferenz war ich von Aufregung wie durchgeschüttelt. Ich hatte seit Jahren keine Schule mehr von innen gesehen. Nur mühsam konnte ich mich zwingen, zwischen den fremden Kollegen auf einem der klebrigen roten Kunstledersessel still zu sitzen. Die vier Tische des Lehrerzimmers waren zu einer langen Tafel zusammengeschoben, am Kopfende thronte Rektor Ludwig Klein, ein unscheinbares, profilloses, faltiges Wesen kurz vor der Pensionierung, den niemand ernst zu nehmen schien, der aber beständig bemüht war, seine vermeintliche Wichtigkeit und Kompetenz durch langwierige Erläuterungen zu untermauern.
Sein Versuch, mich »in aller Kürze« den Kollegen vorzustellen, verlor sich in umständlichen Erklärungen, warum das Kollegium überhaupt vergrößert werden musste, so, als hätte er sich zu entschuldigen, dem eingeschworenen Kreis einen Fremdkörper wie mich hinzufügen zu müssen. Dann verirrte er sich in Geschichten aus der Schulgeschichte, schwelgte in Erinnerungen an damals, früher und »vor Ihrer Zeit, verehrte junge Kolleginnen und Kollegen«, bis ihn eine dieser jungen Kolleginnen mit einem etwas schnippischen »Wollten Sie uns nicht eigentlich Herrn Weber vorstellen?« wieder auf den Boden der Gegenwart zurückholte.
»Richtig, unser Herr Weber – vielleicht, wenn Sie selber ein paar Worte zu Ihrer Vorstellung sagen wollen?«
»Mein Name ist Karl-Dietrich Weber«, sagte ich knapp, »ich habe in München studiert, war dann auf der Warteliste und habe seitdem drei Jahre in Berlin gelebt – noch Fragen?« Ein junger Typ in Jeans, etwa mein Alter – ich hatte mich neben ihn gesetzt, weil er mir von allen der sympathischste zu sein schien -, fragte halblaut: »Steht dein Zelt immer noch auf dem Sportplatz?«
Ich grinste ihn wortlos an.
Die sogenannte Konferenz zog sich in die Länge. Nach über zwei Stunden stand endlich fest, dass »unserem Neuen« eine dritte Klasse anvertraut werden würde. Das war im Grunde alles, was ich wissen wollte. Der Typ neben mir fand im Verlauf der rektorlichen Verirrungen genügend Zeit, sich mir als Rainer Klee vorzustellen und mich aufs gemeinsame Lehrerbier nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung aufmerksam zu machen.
Endlich saßen wir im Ochsen, Rektor Klein hatte sich wegen dringender anderer Verpflichtungen entschuldigt, und niemand schien darüber besonders traurig zu sein. Ich hockte hinter meinem Weizenbier und lauschte. Feriengeschichten, Dorfgeschichten, Schulgeschichten, Maulzerfetzen über Rektor, Schulrat und Pfarrer, dann waren die Eltern dran – nach ein paar Versuchen gab ich es auf, von Rainer irgendwelche Hintergründe zu erfahren. »Zwanzig Jahre Waldweibersbach«, sagte er, »dann verstehst du alles!«
»Und von Ihnen hört man«, sagte plötzlich eine der älteren Kolleginnen, »Sie haben Quartier bei Opa Alfred genommen?«
Schlagartig verstummte das Gespräch, alle Gesichter drehten sich zu mir.
»Es wurde mir sozusagen bürgermeisterlicherseits verordnet.«
»Und? Schon viel Spaß gehabt?« Alle sahen mich in spöttischer Erwartung an.
»Was soll sein?« fragte ich. »Der Alte hat sie nicht mehr alle. Hat Verkalkung oder Alzheimer, man muss ihm immer wieder sagen, wer man ist, und einfach nicht hinhören, was er so absondert, dann läuft alles bestens.«
»Na, viel Glück «, meinte jemand und fragte dann in die Runde: »Was ist eigentlich mit dem Rest der Familie?«
Nun waren plötzlich die Reusten zum Thema geworden, die alte Geschichte von Martha und Adolf kam wieder hoch, einige der Älteren hatten auch Heiner und Luise in der Schule gehabt, halfen den anderen auf die Sprünge. »Weißt doch, der Heiner, der jetzt beim FCW den Tormann macht, so ’n bisschen Stärkerer. Und die Luise war so ’ne merkwürdige, dunkle, die kam ganz nach ihrer Mutter, sie ist später auf die Realschule.« – »Ach die, ja klar, die immer mit der durchgedrehten Martina vom Bürgermeister zusammenhing. Die konnte ’ne ganze Klasse aufscheuchen, wenn sie mit ihrem komischen Gerede anfing. Die hab ich übrigens neulich mal gesehen, ist ein hübsches Ding geworden, vierzehn, fünfzehn muss die doch jetzt auch schon sein, oder?«
»Siebzehn«, sagte ich und wusste gar nicht, warum ich log. Einen Tag später dann, Dienstag morgen, stand ich vor meiner neuen Klasse. Erwartungsvolle Gesichter von achtundzwanzig Achtjährigen, denen ich groß an die Tafel schrieb: »Weber«.
Ich musste meine Tafelschrift wieder in den Griff kriegen, mein altes Problem, x-mal gerügt von Seminarleitern und Schulräten, ein Vorbild sollte ich sein, und mein Tafelanschrieb sah aus wie das verwahrloste Heft des schlechtesten Schülers. Ein kleiner Steppke meldete sich. »Meine Mama hat gesagt, dass Sie in einem Zelt wohnen, stimmt das?«
»Nein«, sagte ich, »ich wohne in der Hauptstraße 113, im Reustenhof, aber ich habe die erste Nacht in einem Zelt geschlafen, weil ich aus Berlin gekommen bin und nirgendwo ein Zimmer gefunden habe, ist das schlimm?«
Keine Antwort, nur allgemeines Kichern.
»Wer von euch hat schon einmal in einem Zelt geschlafen?« fragte ich.
Gott sei Dank gingen ein paar Finger hoch, ich ließ die Zeltschläfer erzählen. Von den Geräuschen berichteten sie, dem
Wind und dem Regen, dass einmal Wasser oben reingelaufen sei und dass sie manchmal Angst gehabt hätten, weil man ein Zelt nicht absperren kann.
Andere rührten sich jetzt langsam mit ihren Urlaubserinnerungen, einer trumpfte mit Kenia auf, neun Kinder berichteten, dass sie noch nie im Urlaub waren, weil sie Viecher daheim haben, die man nicht alleine lassen kann.
Einen kleinen Jungen konnte ich beim besten Willen nicht verstehen, so breit redete er den fränkisch-hessischen Dialekt. Ich versuchte ihm zu erklären, warum ich immer wieder fragen musste, was er gesagt hätte, schließlich sagte ich einen Satz auf englisch und fragte dann, wer mich verstanden hätte. Alle schüttelten kichernd den Kopf.
»Das war Englisch«, sagte ich. »Man kann eine andere Sprache nur mit dem sprechen, der sie auch versteht. Und wenn ihr euren Dialekt sprecht, dann kann ich euch nicht verstehen, weil ich ihn nie gelernt habe.«
Wieder kicherten alle.
»Kartoffeln heiße bei uns fei Krombeern«, rief ein Mädchen, »nur dass Sie’s glei wisse!«
»Gut«, sagte ich, »das merke ich mir. Und für euch habe ich auch ein Wort: Schrippe. Das ist aus Berlin und heißt Brötchen.«
Kennzeichen der Klasse war wohl ihr Kichern, stellte ich fest.
Ich machte mir einen Sitzplan, schrieb Schülerlisten, versuchte die Kinder auswendig mit ihrem Namen aufzurufen und verwechselte, zum kichernden Vergnügen der Kinder, immer wieder Eva mit Christine und Matthias mit Rolf.
Gegen elf wurde es im übrigen Schulhaus unruhig, die Kollegen ließen ihre Schäfchen springen. Auch ich ließ schließlich meine Drittklässler gehen, blieb einen Moment noch alleine im Klassenzimmer, setzte mich hinter mein Pult.
War das nun das, was ich gesucht hatte? Es war sicher anders, als Buchtitel und Preislisten durch den Computer zu jagen und Telefonate mit ungeduldigen Händlern zu führen. Aber was war vor Berlin? Sofort fiel mir diese letzte Klasse ein, die ich ein halbes Jahr lang im Seminar unterrichten musste. Kaputte Stadtkinder, die Mädchen Barbie-Imitationen, die Jungen Stallone-Fans. Geld und Mode, Killen und Kämpfen in den Köpfen von Dreizehnjährigen, und ich davor, mit dem vergeblichen Versuch, noch etwas anderes in diese Köpfe hineinzubekommen. Damals sind meine Illusionen zerbrochen, die Tage habe ich gezählt bis zu den Ferien, bis ich diese Brut nicht mehr sehen musste, einschließlich des allwissenden Seminarleiters, der für jede Situation eine theoretische Lösung hatte, aber genau wusste, warum er sich nicht selber vor die Klasse stellte.
Dann kam die Prüfung, die schlechte Staatsnote. Nach dem ersten Erschrecken war ich fast froh, dass sie mich nicht genommen hatten. Jemand anderes hatte die Entscheidung für mich getroffen. Ein Studium für die Katz, aber doch noch die Kurve gekriegt. Und dann, gegen meine eigentliche Überzeugung, die Warteliste. Versuchen musste man es, schon der Mutter wegen.
Und jedes Jahr aufs neue musste ich auf dem Wartelistenfragebogen meinen gewünschten Einsatzort angeben. Erste Wahl und Zweite Wahl. Erste Wahl war immer München, aber nicht im Stadtkern, sondern irgendwo ein paar Kilometer draußen. Aber genau das wollten alle anderen Kollegen auch, da gab es also keine freien Stellen. Also zweite Wahl irgendwo, wo die Chancen besser waren. Unterfranken, sagte jemand, kein Mensch will nach Unterfranken. Also füllte ich aus: Zweite Wahl: Unterfranken. Eigentlich war für mich der ganze Lehrerberuf nur noch zweite Wahl, aber auch in drei Jahren Berlin war mir keine bessere erste Berufswahl eingefallen.
Das Klassenzimmer sah kahl aus, erst als die bunten Ranzen nicht mehr da waren, fiel es mir auf. Ich könnte die Kinder ihr schönstes Ferienerlebnis malen lassen. Schönstes Ferienerlebnis, wahnsinnig originell, aber mir fiel nichts anderes ein. Und immerhin mal kein Aufsatz, sondern ein Bild, es könnte was Gutes dabei rauskommen. Das Meer bei St. Peter oder die Zebras in Kenia oder diese ulkige Geschichte von diesem, wie hieß er noch, ich würde es schon noch lernen, jedenfalls einer von denen, die nicht weggefahren waren. Er erzählte vorhin:
»Die Kuh will saufen, weil sie Durscht hat. Und geht zum Bach, guckt die Böschung runter, aber das Wasser ist viel zu weit weg. Also macht sie noch einen Schritt, guckt wieder runter, aber das Wasser ist immer noch zu weit weg. Da macht sie noch einen Schritt, aber da ist schon keine Weide mehr, sondern nur noch ein bisschen Gras über dem Lehm. Die Kuh rutscht mit beiden Beinen voran die Böschung runter, unten ist der Boden ganz nass und weich, und die Beine sinken ein, bis zum Bauch. Da steht sie, den Kopf ganz tief unten am Wasser. Jetzt könnt sie saufen, aber jetzt will sie gar nicht mehr und muht nur noch. Die Hinterbeine sind noch immer oben auf der Weide, und den Hintern streckt sie hoch zum Himmel. Und sie hat Angst und strampelt und sinkt davon immer tiefer ein. Sie schreit wie ein Ochs, weil sie so Angst hat, und der Bauer hört’s und muss drei Nachbarn rufen, weil er sie nicht alleine rauskriegt.«
Der Matthias hat das erzählt, richtig. Ich stellte mir seine Geschichte auf einem Bild an der Wand vor. Die vier Männer, wie sie gemeinsam die Kuh aus dem Bach ziehen. Zu dumm, dass ich ihnen nicht gesagt hatte, sie sollten am nächsten Tag ihre Malsachen mitbringen.
Ich lief noch ein bisschen zwischen den Schülertischen durch, versuchte mir vorzustellen, was ich da vorne für ein Bild abgab. Fragte mich plötzlich, ob wohl Lui hier gesessen hatte. Dahinten vielleicht, die ganze Klasse vor sich. Dann sah ich mich plötzlich selber, ich setzte mich auf einen der kleinen Stühle, quetschte die Beine unter den Tisch. Klein muss ich gewesen sein damals. Lietzenbach fiel mir ein. Oberlehrer Lietzenbach. Ich wurde unruhig, dann spürte ich Angst, alte Angst.
Oberlehrer Lietzenbach gibt Schönschreiben. Karl-Dietrich kann aber nicht schön schreiben.
»Zeig dein Heft vor, wo sind deine Hausaufgaben?« Karl-Dietrich schaut auf den Boden. Er wartet auf das erlösende Klingeln. Er hört, wie Oberlehrer Lietzenbach sein Heft zum Pult trägt, hört das kurze, harte Kratzen des Rotstifts. Er schaut nicht auf. »Das ganze noch mal!«
Das war 1967. Von da an, zwei Jahre lang, die ganze dritte und vierte Klasse hindurch, hieß mein Alptraum Lietzenbach. Friedrich-Rückert-Schule in Bochum. Lärmendes, stinkendes, vertrautes Bochum. Zwei Kilometer Fußmarsch über gepflasterte Bürgersteige, den schwarzen Lederranzen auf dem Rücken. Entlang an grauschwarzen Reihenhäuschen, aus deren Schornsteinen, als müßten sie mit den großen Stahlschloten mithalten, graubrauner Rauch kräuselte. Grauschwarze Häuser, die Straßen graubraun, die Bäume graugrün, selbst frischgefallener Schnee nach einer Nacht hellgrau, nach zwei Nächten grau wie die monochrome Einöde drum herum. Und wenn ich zur Schule ging, zwei Kilometer mit dem Lederranzen, zertrat ich jeden grauen Schneehaufen, nur um das Weiß darunter zu sehen.
Zu Hause gab es eine Familie. Der Vater trug, wenn er morgens Punkt sieben Uhr fünfzehn das Haus verließ, einen grauen Anzug, eine silbergraue Krawatte und eine schwarze
Aktentasche. Er schloss die Tür des dunkelbraunen Admiral auf und fuhr ins neue Opelwerk. Er hatte eine Stoppuhr und einen Notizblock und sorgte dafür, dass das neue Fließband mit den neuen Kadetts darauf nicht langsamer wurde.
Abends, oft spät, wenn ich schon im Bett lag, hörte ich den Vater kommen, seinen Mantel ausziehen, stöhnen. Ich hörte einen flüchtigen Kuss für die Mutter, oft hörte ich Streit.
Ab und zu fuhren wir am Wochenende mit dem frischgewaschenen Admiral über Land. Vater fuhr gerne Auto, Mutter wäre lieber gewandert, also stritten sie wieder. Wir saßen in dem riesigen Wagen hinten. Gabi, meine Schwester, und ich. Jeder guckte zu seiner Seite aus dem Fenster, Gabi kaute Kaugummi, und zwischen uns war eine breite Armlehne, die wir immer heruntergeklappt hatten.
»Wenn ich mich etwas anstrenge, bekomme ich nächsten Sommer einen Diplomat V8«, sagte Vater, und Mutter drehte die Augen zum Himmel.
Als ich endlich ins Gymnasium durfte, weg vom Tyrannen Lietzenbach, hatte Vater seinen Diplomat. Der lief fast zweihundert, und Vater kam abends noch später nach Hause. Er war jetzt der Chef aller Männer mit Stoppuhr. Mutter saß derweil zu Hause, half uns bei den Hausaufgaben, bügelte oder ging einkaufen. Manchmal war ich dabei. In den Geschäften redete sie anders als zu Hause. Sie sagte nicht »Servus« und »Pfürtie«, sondern »Guten Tach« und »Schönen Tach noch« und versuchte so zu sein wie die anderen Frauen aus dem Pott. Und wie immer, wenn ich an Bochum denke, wenn ich an Vater denke, tauchte eine Szene auf:
Die Familie fährt nach München, die Oma besuchen. Der Vater ist nicht dabei, und Karl-Dietrich fährt zum ersten Mal im Leben eine lange Strecke mit der Bahn. Sie gucken zum Fenster hinaus, sehen Berge, grüne Bäume, Häuser aus Holz mit leuchtendroten Dächern. Mutter fragt Karl-Dietrich und
Gabi, ob sie nicht auch viel lieber hier bleiben wollen, bei Oma im Haus, oben, in den vier Zimmern, ohne graubraune Straßen und graugrüne Bäume.
»Und der Papa?« fragt Karl-Dietrich.
»Die wollen sich scheiden lassen, Mensch, bist du zu blöd, um das zu kapieren!« schreit Gabi und rennt aus dem Abteil.
Ein halbes Jahr später wohnten wir in München. Von Papa kam regelmäßig Geld an Mutti und unregelmäßig ein Brief an mich, wo er schrieb: Schick mir doch einmal ein neues Bild, und manchmal lagen zehn Mark im Umschlag. Erst Jahre später – ich war schon sechzehn und durfte alleine reisen – sah ich ihn in Bochum wieder. In meiner Erinnerung wurde sein Bild grau und grauer, bis es sich nicht mehr von der Umgebung abhob.
Plötzlich gongte es, sanft und angenehm, kein Vergleich mit der Welt aus schrillen Klingeln, in die ich abgerutscht war. Ich schaute raus auf das Feld vor der Schule, die flimmernde Hitze über den sattgelben Getreidehalmen löste die Gesichter auf, den cholerischen Oberlehrer Lietzenbach, den grauen Vater, die nörgelnde Mutter, die ewig kaugummikauende Schwester. Die Gegenwart war ein Schulschlüssel in meiner Tasche: Klassenlehrer Weber.
Die Hitze draußen machte dösig wie ein mittägliches Glas Pils. Leute grüßten mich über Zäune weg, als ich durchs Dorf schlenderte, fremde Leute, die ich nie zuvor gesehen hatte. Klassenlehrer Weber, eine Respektsperson. Als ich auf der Höhe der Kirche war, begannen die Glocken Mittag zu läuten. Schwer schwangen sie hin und her, unregelmäßig schlugen die Klöppel an, bis sie ihren Takt gefunden hatten, Interferenzen dröhnten zwischen den Häusern, eine zähe Klangflüssigkeit, die die Hauptstraße hinunterquoll. Gemischt mit Hitze und
Staub, schwappte sie in jeden Hof, erreichte jedes Haus, wurde schrill gesteigert durch den Sirenenton der Fabrik – jeder bekam die Nachricht aufgedrängt, dass es Zeit war für den Mittagstisch.
Hippie sprang mich schwanzwedelnd im Hof an, in der einen Woche hatte er es zu Agathes Butler gebracht, war der Zweithund auf dem Reustenhof geworden. Agathe ließ jetzt die Besucher durch Hippie melden, erst wenn ernste Schwierigkeiten auftraten, kam sie tief bellend und knurrend aus ihrer Hütte, um Ordnung zu schaffen. Nur nachts, wenn der Hof von merkwürdigen Geräuschen erfüllt war, ging Hippie lieber mit mir, legte sich unter mein Bett und wiegte mich mit seinem Schnarchen in den Schlaf.
Ich könnte jetzt tatsächlich ein Bier trinken, dachte ich, mir einen Stuhl vor mein Häuschen stellen und mich in die Sonne setzen. Ich umkurvte das Gerümpel vor dem Haus, drückte langsam die alte Tür auf, sie quietschte, ich dachte mir nichts Böses dabei, auch nicht, als ich oben ein paar eilige Geräusche hörte. Öffnete noch die Tür zu meiner neuen Stube, langsam wird’s sauber da drin, dachte ich, ein, zwei Wochen noch, dann kann ich nach unten ziehen, stieg dann ahnungslos, fast ein bisschen zufrieden und glücklich die Treppe hoch.
Der Knall, der Blitz, der Schmerz, ich spüre und höre alles im gleichen Moment, bin sekundenlang sicher, tot zu sein, finde mich dann, halb sitzend, halb liegend, auf der Treppe, über mir, im oberen Stockwerk, breitbeinig der Alte, ein Sturmgewehr im Anschlag, bereit, auch noch einen zweiten Schuß auf mich abzugeben.
»Halt, oder ich schieße! Halt, oder ich schieße!« brüllt er immer wieder, ich spüre Blut meine Backe runterlaufen, zittere, schreie: »Ich bin’s doch, Opa Alfred, ich bin’s doch!«
»Ach so – ja«, sagt er in plötzlichem Erkennen, nimmt sein Gewehr runter und schlurft wortlos in sein Zimmer zurück.
Einen Moment später fliegt unten die Tür auf, Lui kommt reingestürzt. »Was ist los, Opa, verdammt, was hast du wieder angestellt!«
Sie zieht mich hoch, bringt mich in ihr Zimmer, ich bin noch immer wie gelähmt vor Schreck und bringe kein Wort raus, fange nur an zu heulen, als ich endlich in Sicherheit bin. »Zeig mal her«, sagt sie, nimmt mir die Hände von der Backe, wischt mit einem Taschentuch drüber, lacht und zieht dann mit einem beherzten Ruck einen streichholzkleinen Holzsplitter heraus. »Hier«, sagt sie, hält mir das Ding unter die Nase, »das war alles. Es ist gar nichts passiert.«
Ich versuche mich zusammenzureißen, zittere am ganzen Körper, kann es nicht stoppen. »Er hat auf mich geschossen!« stammle ich.
»Er hat danebengeschossen«, sagt sie, »er hat bestimmt nur die Wand getroffen, und da ist der Splitter rausgebrochen.«
Ich sehe es wie in Zeitlupe, die Kugel, die Zentimeter vor meinem Gesicht entlangpfeift, in die Holzverkleidung einschlägt, den Splitter, der sich in meine Backe bohrt. Das Heulen und Zittern will nicht aufhören, alle Nerven mit dem Schuß zerfetzt, die Kugel zentimeterdicht vor dem Kopf.
Lui wischt mir wieder über die Backe. »Da«, sagt sie ärgerlich, »blutet schon gar nicht mehr. Jetzt reiß dich zusammen, es ist nichts passiert!« Dann lässt sie mich einfach alleine sitzen, zieht die Tür hinter sich zu.
Ich lege mich auf dem Bett zurück, presse das Taschentuch gegen die Backe und atme, warte, bis das Zittern allmählich nachlässt.
Christine hätte mich getröstet, mütterlich, emanzipiert mütterlich, hätte mit mir geweint, mir dann versichert, wie toll es ist, dass ich als Mann so weinen kann, und mich damit wohl genauso alleine gelassen.
Draußen höre ich Lui mit dem Opa rumgiften. »Ich nehm dir
jetzt dein Gewehr weg, ich hab’s dir das letzte Mal schon gesagt!«
»Ich hab immer mein Gewehr gehabt«, schreit er, »das kriegt ihr nicht, auch du nicht, da musst du mich umbringen, das kriegst du nicht!«
»Du kannst nicht auf jeden schießen, der hier die Treppe hochkommt, kapier das doch!«
»Der hätte ja Meldung machen können, ich dachte, die wollten mich holen. Wenn die kommen, sind die dran.«
»Niemand kommt dich holen, Opa«, sagt Lui nun leiser, »sei jetzt still, es kommt niemand dich holen.«
Nach einer Weile geht die Tür wieder auf. »Hast du dich jetzt ausgeheult?«
»Du bist gut«, sage ich, »der Idiot schießt mir fast eine Kugel durch den Kopf, und du fragst, ob ich mich ausgeheult habe.«
»Ich kann Männer nicht ausstehen, die heulen«, sagt sie trocken, »zeig mir noch mal deine Backe!« Sie zieht mich ins Licht unter das Fenster, wischt drüber. »Komm mit, wir waschen’s mal richtig ab – es ist wirklich nur ein Kratzer.«
Ich folge ihr raus zum Waschbecken auf dem Gang. Der alte Mann sitzt regungslos in seinem Sessel und sieht uns beleidigt nach.
Sie wischt mir mit einem nassen Lappen übers Gesicht, zerrt mich vor den Spiegel. Es ist wirklich kaum der Rede wert, ein Kratzer.
»Und kein Wort zum Vater«, sagt sie dann fast drohend, als wir wieder im Zimmer sind, »der bringt ihn sonst ins Heim, kapiert?«
»Aber ...«
»Kapiert?!«
Ich nicke. »Also gut.«
Gerade noch Gift in ihren Augen, und dann, plötzlich, wieder die andere Lui. Sie schlingt ihre Arme um mich, wie ein weiches Kissen spüre ich den Anprall ihres Körpers. »Danke«, sagt sie, gibt mir einen feuchten Kuss, flüchtig nur, aber doch viel zu viel für ein Dankeschön.
»Tut’s noch weh?« sagt sie. »Komm, ich sing dir was vor.« Damals habe ich es zum ersten Mal gehört. Plötzlich wusste ich, woher ich diese tiefe, raue Stimme kannte, plötzlich verstand ich meine Gänsehaut, wenn sie sprach.
Sie sang: »Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz, my friends all drive Porsches, I must make amends ...«
An der Stelle brach sie ab, fragte mich, als sähe sie mein Erstaunen nicht: »Was heißt das, 'make amends', kein Mensch weiß das.«
Ich zuckte die Schultern. »Woher hast du das?« fragte ich. »Weißt du überhaupt, von wem das ist?«
»Klar«, sagte sie, »das ist Janis Joplin. Ich hab die Platte von Manta. Manta sagt, ich singe wie Janis Joplin.« Sie ging zur Tür. »Also, ich muss wieder runter, hab noch zu tun.«
Sie ließ mich zurück mit ihrer Stimme im Raum. Alles war so irreal. Ich singe wie Janis Joplin, sagte sie ganz gelassen, und der Wahnsinn war, es stimmte, sie sang wie Janis Joplin – schon damals mit sechzehn.
Mein Bild von ihr wurde immer gefährlicher. Ich begann die Kontrolle zu verlieren, das machte es gefährlich. Vielleicht hatte ich die Kontrolle längst verloren.
Es wurde eine unruhige Nacht, so viele Fetzen, die in meinem Kopf herumflogen, wilde Träume von Schüssen und Küssen, ihre Beine, ihr Bauch, ihre Augen, ihr Busen. Träume von wildgewordenen Stadtkindern und Kühen im Bach, von einem grauen Herrn in einem Diplomat V8, Holzsplitter, die tödlich verletzen, zerfetzen, dann plötzlich das Gefühl eines anderen Körpers auf mir, Luis Körper, weg mit dem nächsten Lidschlag.
Von drüben drang das Stöhnen und Schnarchen des Alten herüber, im Lauf dieser ersten Woche hatte ich mich schon fast dran gewöhnt. Manchmal hörte ich ihn aufstehen, hörte ihn hin und her gehen, Worte murmeln, dann warf er sich wieder krachend ins Bett. Meine Drittklässler fielen mir ein, jetzt waren sie es, die mich vom Schlafen abhielten. Mitternacht ging vorbei, und ich schlief noch immer nicht, zählte die Sterne in dem kleinen Rechteck, den das Fenster aus dem Himmel herausstanzte, verzählte mich, merkte, wie sich der Himmel langsam verschob, wie einige Sterne links verschwanden, andere rechts in mein Blickfeld rutschten.
Ich war gerade am Einschlafen, da wurde der Alte wieder unruhiger, aus dem Stöhnen, Schnarchen und Brabbeln hinter seiner Tür waren einzelne Worte herauszuhören. »Mitkommen«, verstand ich einmal ganz deutlich, »alle mitkommen, los!« Dann: »Schießen, schießen, schießen!«, danach war wieder alles still, ich drehte mich auf die Seite, um endlich Ruhe zu finden, aber da ging es erst richtig los. Jetzt grummelte und brabbelte er nicht mehr, er schrie, schrie wie am Spieß, wie einer, der Schaum vor dem Mund bekommt, dem die Augen raustreten. »Raus da, raus da, raus da! Ihr Schweine. Macht, dass ihr da rauskommt!«
Er wurde immer lauter, seine Stimme schnappte über, es klang, als triebe er eine Herde vor sich her, immer wieder »Alle raus da«, bis nichts mehr zu verstehen war, nur noch ein bestialisches, furchterregendes Brüllen, das all meinen Mut, rüberzugehen und ihn zu beruhigen, im Keim erstickte. Ich dachte an sein Gewehr und zog mir die Decke über den Kopf, bereit abzuwarten, bis er von alleine aufhören würde, und wenn es erst am Morgen wäre.
Aber dann wurde unten die Tür aufgerissen. »Opa, Opa!« Es war Lui. Sie stürmte die Treppe hoch, anscheinend schüttelte sie ihn. Drei-, vier-, fünfmal klatschte es, dann war plötzlich
Ruhe. Heftiges Atmen nur noch, Schluchzen, Weinen, Wimmern, dazu ihre Stimme.
»Ist gut, Opa, war nur ein Traum, schläfste wieder ein. Nimmste noch ’nen Schluck Bier und schläfst wieder. Ist alles in Ordnung, niemand will dich holen, kein Mensch. Trinkst noch ein Bier und schläfst wieder.«
Das Wimmern wurde leiser. Sie redete auf ihn ein, bis sein Schluchzen in gleichmäßiges Schnarchen übergegangen war. Dann hörte ich ihre Schritte über die knarzenden Bodendielen. Sie ging aus seinem Raum, zog leise die Tür zu, schlich über den Gang, blieb vor meiner Tür stehen. Nach dem Gebrüll der letzten Viertelstunde war alles unwirklich ruhig. Ich spürte sie mehr vor meiner Tür, als dass ich sie hörte, wartete, dachte schließlich, sie sei vielleicht doch schon fort, glaubte dann wieder ihren Atem zu hören, vielleicht war es auch meiner, oder mein Herzschlag.
Zweimal holte ich Luft und hielt mich doch selbst zurück, beim dritten Mal wollte ich mich nicht mehr wehren. »Ich bin wach«, sagte ich leise.
Die blankgewetzte Messingklinke senkte sich, dann quietschte die Tür. Sie stand im Raum, barfuß, nur mit einem dünnen Nachthemd über dem Körper. »Hast du alles mitgekriegt?« fragte sie, und ohne eine Antwort abzuwarten: »Tut mir leid, er hat das ab und zu – hattest du Angst?«
»Es ist nicht gerade das, was ich mir nachts um eins wünsche.«
»Es ist nicht oft«, sagte sie.
»Ich denke, es ist vielleicht besser, ich suche mir woanders eine Wohnung. Ohne Schüsse und Schreie. Einfach ’ne kleine Wohnung mit ’ner Tür, die ich absperren kann.«
Sie sagte nichts, stand bewegungslos im Dunkel, ich konnte nur ihre Umrisse gegen den matten Lichtschein aus dem Gang
erkennen. Ich spürte, dass sie versuchte, mich zu bannen, war froh, ihr nicht in die Augen sehen zu müssen.
»Rutsch mal, mir ist kalt«, sagte sie dann plötzlich und war auch schon neben mir unter der Decke. »Aber keine unanständigen Sachen, sonst gehe ich gleich wieder!«
Sie lag ausgestreckt neben mir, ich spürte die Wärmestrahlung ihres Körpers, roch ihre Haut. Aber nur eine winzige Stelle der Berührung gab es zwischen uns, ihr Knie war es, es lag ganz leicht an meinem Oberschenkel, es fühlte sich an, als zeichne sie mich mit einem glühenden Eisen.
»Bleib doch hier«, sagte sie dann leise, »ich hab gehört, es geht nicht mehr lange.«
»Was meinst du?«
»Mit dem Opa. Es geht wohl nicht mehr sehr lange. Ich habe die Friedhofsglocke gehört, sie läutete noch vor den Weihnachtsglocken.«
Ihre Stimme klang fremd, ich hatte mich längst an ihre rauchige Stimme gewöhnt, an diese Worte aus Kehle und Bauch, aber dieser letzte Satz kam noch von viel weiter weg, aus einer fremden Welt. Ich sagte nichts, und es dauerte, bis sie weitersprach.
»Sei einfach nett mit ihm, sprich mit ihm, lob ihn, iß mit ihm, erzähl ihm was. Er wird nie bitte und danke sagen, er hat’s nie gemacht und wird’s nicht mehr lernen, aber manchmal lacht er. Und er schläft dann besser und hat weniger Angst, verstehst du?«
»Vielleicht schießt er dann auch nicht mehr auf mich«, sagte ich, »das würde mir schon genügen.«
»Ich kann ihm die Patronen wegnehmen, wenn du willst. Bleibst du hier wohnen, wenn ich ihm die Patronen wegnehme?«
»Nimm sie ihm ab, und vergiss die eine im Lauf nicht, dann sehen wir weiter.« »Gut«, sagte sie und schlüpfte so schnell, wie sie gekommen war, wieder aus dem Bett. Sie blieb im Dunkeln vor mir stehen.
»Ich habe gehört, du begehrst mich?« sagte sie nach einer langen Pause und fragte, nachdem ich darauf keine Antwort gab: »Willst du mich anfassen?«
»Nein«, sagte ich scharf, bereute im nächsten Moment, dass und wie ich es gesagt hatte.
»Gut, dann gehe ich jetzt, schlaf gut.«
Natürlich hinterlässt eine solche Nacht Spuren, vor allem bei mir. Mit viel Mühe schleppte ich mich am Morgen raus zu dem alten Emaillewaschbecken.
Schnarchen des Alten klang laut und friedlich durch die Tür. Ich besah mir mein Gesicht im Spiegel, ein kleiner roter Punkt auf der Backe und eine leichte Schwellung waren alles, was man von dem Attentat noch sehen konnte. Ich ließ den Wasserhahn laufen, bis die warme Brühe aus dem Rohr abgelaufen war, wartete, bis eisiges Wasser kam, und schaufelte es mir händeweise ins Gesicht.
Unten im Hof herrschte schon rege Betriebsamkeit. Lui stapfte in Gummistiefeln hinüber in den Stall, hinter ihr her die beiden Hunde. Hippie hatte in der Nacht zum ersten Mal draußen geschlafen, seit dem Schuss gestern Mittag weigerte er sich, das Haus noch einmal zu betreten.
»Morgen, Lui«, rief ich in den Stall, »ich bin spät dran, bis heute Mittag!« Ich wollte nicht mit ihr reden, nicht morgens um sieben, wenn meine Welt noch in Unordnung und meine Elefantenhaut gegen Gutes, Schlechtes, Böses und Ergreifendes noch hauchdünn ist. Hippie, der am ersten Schultag beim Abschied noch hinter mir her geheult hatte, machte sich heute schon nicht mal mehr die Mühe, mir bis zum Hoftor zu folgen.
Ich nahm mir auf dem Weg zwei Stöllchen bei der Bäckerei mit.
»Das war wohl heut Nacht bei euch auf dem Hof, gell?« fragte die Bäckersfrau.
»Was meinen Sie?« fragte ich doof und ließ sie stehen.
Ich setzte mich in mein Klassenzimmer, wartete auf meine Schäfchen. »Morgen, Michael.« – »Ich bin aber der Matthias!« – »Morgen, Nicole.« – »Guten Morgen, Herr Weber!« So ging es achtundzwanzigmal, dann war die Klasse komplett. Ich fing gerade an mit organisatorischen Fragen, welche Hefte wofür, welche Farbe für welches Fach, da ging ein Finger hoch. Es war Linda, ein schüchternes, kleines Dorfmädchen, das den ganzen ersten Tag kein Wort gesagt hatte. Sie stand auf, fragte leise: »Beten wir jetzt nicht mehr?«
Laut Lohnsteuerkarte bin ich ein evangelischer Christ, noch immer.
»Willst du morgens beten?«
»Meine Mutti hat gesagt, wer morgens nicht betet, ist Heide, und der Tag wird eine Sünde.« Sie setzte sich wieder. Alle sahen mich erwartungsvoll an.
»Wer von euch will denn morgens beten?«
Fast alle Finger gingen hoch.
»Gut«, sagte ich, »dann beten wir. Was wollen wir beten?« Schweigen. Dann stand Linda wieder auf. »Frau Bretz hat uns immer aus einem Buch was vorgebetet.«
Kollegin Bretz, Ende Vierzig, dunkelblauer Faltenrock mit weißer Rüschenbluse, steht vor den Kindern und liest aus dem Gebetbuch vor, das konnte ich mir gut vorstellen. Ich versuchte den Kindern zu erklären, dass für mich ein Gebet etwas sehr Persönliches sei, das man nicht aus einem Buch vorlesen könne. Jeder habe andere Freuden und Sorgen, da solle auch jeder etwas anderes mit dem lieben Gott besprechen, fände ich.
»Dann bete ich für mich«, rief Andre, der dicke Junge, der im Sommer bis Kenia gekommen war. Alle lachten. »Für meine Katze!« sagte ein Mädchen. »Oder für die armen Lehrer.« Gekicher.
»Dann machen wir es doch so«, schlug ich vor, »jeden Morgen betet jemand von euch laut vor. Und er betet einfach das, was ihm auf dem Herzen liegt. Wer will denn heute anfangen?« Natürlich funktioniert Pädagogik nur in den theoretischen Lehrbüchern für Lehrer. In der Praxis will nie jemand anfangen, schon gar nicht mit Beten.
»Linda, wie wär’s, wenn du heute mal den Anfang machst?«
Sie wurde rot, stand dann aber doch auf, faltete die Hände, sagte: »Lieber Gott ...« und überlegte dann lange. »Lieber Gott«, fing sie schließlich noch einmal an, »ich bete für meine kranke Oma, für meine Mutti und für die Lehrer, für der Nicole ihre Katze – aber nicht für den Andre.« Sie stockte, wollte sich setzen, da fiel ihr noch was ein. »Und außerdem, dass es bald wieder regnet, weil der Weizen schon knickt und die Kartoffeln eintrocknen und weil das Gras für unsere Küh’ nicht mehr recht wachsen will. Amen.«
Wie gesagt, morgens ist meine Haut noch sehr dünn, viel zu dünn für einen Drittklasslehrer. Ich schluckte, damit mir nicht die Tränen kamen.
»Danke, Linda«, sagte ich dann, »das war ein schöner Anfang!«
Sie strahlte mich verliebt an.
In der Pause suchte ich nach einem Platz im Lehrerzimmer. Aber jeder Stuhl schien schon besetzt, auch wenn niemand darauf saß. Grüppchen bildeten sich, enge, abgekapselte Cliquen – ich stand ziemlich verloren da.
»Komm hier zu uns rüber, Karl-Dietrich!« rief Rainer schließlich. »Aber nimm dir den Stuhl dort hinten, alle anderen sind besetzt.«
Ich aß meine trockenen Stöllchen, trank viel zu starken Kaffee.
Ich hörte zu. Das Dorfkarussell war wieder in Betrieb: Der hat dies gemacht und der das, weißt du schon, und der erst, hast du schon gehört, die hab ich auch mal wieder gesehen ...
»Sag mal«, fragte mich Rainer plötzlich, »heute Nacht war bei euch Highlife, hab ich gehört?«
»Wie hört man so was?« fragte ich.
»Mach dir keine Illusionen, Karl-Dietrich, jeden Furz, den du hier lässt, hört sofort das ganze Dorf – was ist denn nun wieder los mit eurem Alten?«
»Er schreit«, sagte ich, »er schreit, dass einem das Blut gefriert.«
»Der wird schon seinen Grund haben«, sagte jemand am Tisch, und alle grinsten verlegen.
»Stimmt irgendwas mit dem nicht, oder wie?« wollte ich wissen.
»Mit dem ganzen Reustenhof stimmt so manches nicht«, sagte Rainer, ein paar nickten – und wechselten schnell das Thema.