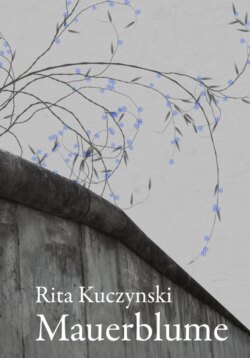Читать книгу Mauerblume - Rita Kuczynski - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеMein eher unfreiwilliger Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik begann also mit der schrittweisen Entlassung aus der Nervenklinik.
Zunächst waren es Spaziergänge im Klinikpark, stundenweise. Sie wurden als Training zu meiner Wiederbelebung angeordnet. Es folgten Probeentlassungen, vorerst über das Wochenende. Das war mir nicht recht. Denn ich wußte nicht, wohin. Zu den Eltern zu gehen, war nicht gerade vergnüglich, zumal der Vater schon immer gewußt hatte, daß ich nie normal gewesen wäre, sonst hätte ich meine Klimperei auf dem Klavier selbst nicht ausgehalten. Daß ich in der Klapsmühle gelandet war, sei daher nur folgerichtig gewesen und allein Schuld meiner Großmutter und meiner Mutter. Sie hätten mir den Klimperkasten wegnehmen müssen, eben weil ich von Anfang an nicht richtig tickte. Aber auf ihn wollte ja keiner hören. Und warum nicht? Weil man ihn ja nicht ernstnehme. Weil man ja denke, er als Sohn der Arbeiterklasse wisse nicht, was los sei. Mit “man” meinte er vor allem meine Großmutter, aber auch meine Mutter. Was mich betraf, habe man wohl genug Schaden angerichtet. Gut, daß damit jetzt Schluß sei.
Zu meinen Geschwistern hatte ich über die Jahre den emotionellen Kontakt verloren, in zu unterschiedlichen Milieus waren wir sozialisiert worden. Da gab es wenig geschwisterlich Bindendes.
Meine Mutter versuchte nett zu mir zu sein. Aber es war ihr peinlich, daß ich aus der Psychiatrie kam. Soweit als möglich versuchte sie, diesen Umstand in der Verwandtschaft zu vertuschen. Klinik ja, aber nicht psychiatrische, gab sie mir zu verstehen. Das brauche ja nicht jeder zu wissen.
Die zweite Phase der schrittweisen Entlassung aus der Klinik bedeutete, daß ich nur noch zum Schlafen in das Krankenhaus zurückkehren mußte. Das war schon besser. Meine Mutter versorgte mich in dieser Zeit großzügig mit Geld. Sie wollte, daß ich nach Hause zurückkäme. Sie wollte es wirklich, glaube ich. Aber ich wollte es auf gar keinen Fall. Ich gab ihr eine gehörige Portion Schuld daran, daß ich nun im Osten befreit vom Klassenfeind festsaß. Ich gab ihr auch die größte Schuld daran, meine musikalische Existenz zerstört zu haben. Später verachtete ich sie dafür, daß sie den Vater nicht verlassen hatte, von dem sie sich bis hin zu Schlägen hatte demütigen lassen.
Ich hatte nie sehr viel Lust, mich in die möglichen Gründe meiner Mutter für ihre Entscheidungen hineinzudenken. Bestimmt hingen sie auch mit meiner Großmutter zusammen. Meine Großmutter war eine starke Persönlichkeit: Charme, Klugheit und Ausstrahlung gehörten untrennbar zu ihr. Bestimmt war sie als Sängerin enttäuscht von ihrer einzigen Tochter, weil sie erstaunlich unmusikalisch war. Und bestimmt hatte meine Mutter darunter gelitten, wie sie auch darunter leiden mußte, daß meine Großmutter nun mich statt ihrer gerade wegen meiner Musikalität über alles liebte und Gott dankte, wie sie sagte, daß sie in mir nun doch noch eine Tochter hatte. Ich konnte meiner Mutter gegenüber nie nachsichtig sein. Schließlich hatten weder meine Geschwister noch ich darum gebeten, auf die Welt zu kommen.
Nach der endgültigen Entlassung aus der Nervenheilanstalt ging ich nicht wieder zurück zu den Eltern. Meine persönlichen Sachen fanden Platz in einer Reisetasche, mit der ich durch die zwangsverordnete Heimat zog. Natürlich war ich irgendwo in Berlin polizeilich gemeldet. Keinen festen Wohnsitz zu haben, war strafbar. Aber sich irgendwo bei Bekannten anzumelden, ein Namensschild an ihren Briefkasten zu kleben, blieb eine Formalität.
Irgendwer gab mir den Rat, zu einer Berufsberatung zu gehen, weil keine Arbeit zu haben auch strafbar war. Man nannte das asozial. Im Zentrum für Berufsberatung schlug mir ein Berater vor, ehe ich auf die Idee käme, ein Studium aufzunehmen, sollte ich unbedingt einen ordentlichen Beruf erlernen. Weißnäherin zum Beispiel, da gäbe es freie Lehrstellen. Auf meine Nachfrage, was das denn sei, wurde mir erklärt, daß ich in diesem Beruf lernte, Bettwäsche zu nähen. Die Freude in meinem Gesicht muß wohl nicht sehr groß gewesen sein. Daher schlug mir der Berater vor, Gärtnerin zu werden, das sei gut für die Nerven. Feinmechanikerin, dafür hätte ich mit meiner Vorgeschichte als Klavierspielerin auch gute Voraussetzungen. Ich solle mir alles in Ruhe überlegen. Ich überlegte und ging nie wieder zu der Beratungsstelle.
Ich schlug mich durch mit Gelegenheitsarbeiten. Ich brauchte nicht viel in dieser Zeit. Ich hatte kein Ziel, das mir lebenswert schien. Warum ich überhaupt noch lebte und herumlief, verstand ich selbst nicht. Auf die Idee, mein Leben zu beenden, kam ich erst langsam. Ich war sprachlos nach dem Einsturz meiner musikalischen Welt. Mich in einer anderen Sprache als in der der Musik auszudrücken, hatte ich nicht gelernt. Darüber hinaus schienen mir alle anderen Ausdrucksformen wenn nicht minderwertig, dann zumindest unbrauchbar, jedenfalls für mich. Ich wußte nicht, wie zu sprechen war über das, was geschehen war. Was ich sagte, war unbeholfen und grob. Die Wörter brachten nicht zum Ausdruck, was ich sagen wollte. Ich bekam Angst zu sprechen, weil mir meine Entfremdung unüberhörbar und unverhohlen gegenüberstand.
Wortkarg arbeitete ich am liebsten als Hilfsarbeiterin in Nachtschichten im volkseigenen Glühlampenwerk Narva. Diese Arbeit hatte nichts mit mir zu tun und wurde gut bezahlt. Die Arbeiter tolerierten mich, weil ich meine Arbeit schaffte, trotz meines immer abwesenden Blicks.
In dieser Zeit hatte ich einen kaum zu bändigenden Drang zu stehlen. Wenn ich schon gezwungenermaßen im ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat leben mußte, wollte ich auch etwas davon haben. Schließlich gehörte das Eigentum allen, und so nahm ich mir vom Volkseigentum, was ich zum Leben brauchte.
Etwa zwei Jahre zog ich mit meiner Tasche durch Berlin-Brandenburg. Inzwischen hatte ich Deddi, Maria und Leisten-Paul kennengelernt. Deddi war vor 1961 ein sogenannter Grenzgänger. Er wohnte im Osten und arbeitete im Westen. Sein Lohn wurde gesplittet, 50 Prozent in West, 50 in Ost. Deddi ging es vor dem Mauerbau finanziell gut. In Westberlin arbeitete er als Einkäufer für ein Hotel. Manchmal erzählte er, wie er Eier, Butter und Fleisch vom Osten in den Westen verschob und wie alle Beteiligten daran verdienten. Daß er nach dem 13. August 1961 im Osten hängengeblieben war, hatte er nie verkraftet. Deddi hatte einen Lastwagen und eine ungeheure Wut auf die DDR. Diese Wut, eingesperrt zu sein, einte uns. Der Zukunft zugewandt, die vor der Mauer endete, waren wir uns schnell einig, daß wir etwas tun mußten, um unser sozialistisches Glück zu verkraften. Mit dieser Wut organisierten wir den Diebstahl von Holzzäunen.
Ich hatte Deddi über Maria kennengelernt. Maria arbeitetete auch im Glühlampenwerk. Wir verabredeten uns immer häufiger zur Nachtschicht. Sie hatte Schulden, wie sie mir später sagte. Maria war beeindruckt von meinem Gehör. Ich konnte ihr nämlich sagen, wann das Band, an dem wir Glühlampen einsortierten, stillstehen würde. Ich hörte es vorher, weil der Antriebsmotor in unregelmäßigen Drehzahlen arbeitete, bevor er kaputtging. Ich sagte ihr dann, gleich könnten wir eine Zigarette rauchen. In diesen Rauch- und Quasselpausen haben wir uns angefreundet. Den Pauschallohn für die Nacht bekamen wir auch, wenn das Band wegen eines technischen Defekts nicht lief. Als ich vertrauter war mit Maria, erzählte ich ihr von den Kopfschmerzen, die ich häufig vom Lärm in den Maschinenhallen bekam. Eines Tages fragte sie, ob ich nicht als Horcherin mitmachen wolle bei dem Diebstahl der Zäune. Das wäre gut für alle. Sie wären nämlich beinahe mal erwischt worden, weil sie die nahenden Spaziergänger nicht gehört hätten. Natürlich müsse ich nicht nur horchen, sondern auch Zäune schleppen. Ich war einverstanden und schleppte mit Maria und Deddi den ganzen Winter lang Schneewachten von den volkseigenen Feldern. Leisten-Paul hatte einen Privatladen für Gartengeräte. In seinem Schuppen strich er die Wachten mit dunkelbrauner Holzbeize zu Zäunen um und verkaufte sie unter der Hand. Gartenzäune aus Holz waren knapp, wie alles in der DDR knapp war. Und die Zahl der Kleingärtner stieg gerade in dieser Zeit. Von dem Erlös der Schneewachten ließ sich leben. So wechselte ich also von der Nachtschicht im Glühlampenwerk zur Nachtschicht bei Deddi. Meine Arbeit bei ihm nahm ich ernster, als ich sie im volkseigenen Werk genommen hatte, weil mein Verdienst im hohen Maße von mir, von meiner Geschicklichkeit und meinen Einfällen abhing.
Als der Winter zu Ende ging, ging auch unsere Saisonarbeit zu Ende. Die Genossenschaftsbauern holten die übriggebliebenen Schneewachten von den Feldern. Deddi und Maria zogen mit ihrem Lastwagen gen Ostsee. Ich hatte etwas Geld gespart und besetzte eine leerstehende Wohnung. Sie war ziemlich heruntergekommen, aber gemütlich. In dieser Zeit lebte ich sehr spartanisch. Ich stahl nur, was ich zum Essen brauchte und Bücher, vor allem Klassiker: Hölderlin, Schiller, Kleist, Büchner und Eichendorff. Es war das erste Mal, nachdem ich von meiner Großmutter fort war, daß ich wieder las. Hölderlin war schon als fünfzehnjährige mein Lieblingsdichter gewesen, und er sollte es noch Jahrzehnte bleiben.
Der Aufbau-Verlag hatte in dieser Zeit eine sehr gute Klassikerreihe herausgebracht. Ich besaß sie bald komplett. Irgendwer hatte mir einen Band Rilke geschenkt. Ich las Gedichte und Dramen wie eine Süchtige. Über den Sommer gingen meine Ersparnisse am Volkseigentum zu Ende. Das war in der Zeit, da das Fleisch in Berlin mal wieder rationiert wurde. Jeder mußte eine feste Fleischerei wählen, seine Adresse notieren lassen, um Fleisch zu bekommen. So sehr ich über den Sommer süchtig war nach Gedichten, so sehr bekam ich im Übergang zum Herbst Appetit auf Fleisch. Ich hatte in der Zeit, als ich Klavier spielte, in Prüfungszeiten immer Steaks gegessen. Meine Großmutter schwor auf Steaks gegen Prüfungsstreß, ich glaubte daher an die stärkende Wirkung von Rindersteaks.
Ob zuerst das Fleisch knapp wurde und sich dann mein Hunger einstellte oder umgekehrt, kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Auf jeden Fall waren zwei Pfund Fleisch in der Woche, oder etwas mehr, zu wenig für meinen Hunger, der so plötzlich über mich gekommen war. Ein Schild in einer privaten Fleischerei: “Suche Verkäuferin”, brachte mich auf die Idee, hier meinen Hunger loswerden zu können. Ich ging in den Laden und sagte, daß ich als Verkäuferin arbeiten wollte. Der Fleischermeister besah mich von oben, nach unten, nach oben. Ich war sehr dünn zu dieser Zeit. Ich glaube, der Meister war sich einen Augenblick lang unsicher, ob ich ihn veralbere. Ich wiederholte mein Angebot mit dem mir möglichen Ernst. Daraufhin sah er sich meine Hände an. Er wollte sehen, ob ich auch zupacken könnte. Ich sagte nichts von der Klavierspielerin. Ich packte zu. Er stellte mich ein. Er zeigte mir die Handgriffe, die ich brauchte, damit ich mir nicht die Finger abschnitt beim Rouladenschneiden. Er zeigte mir, wie ich mit Beil und Knochen umzugehen hatte und wie mit dem Wurstmesser. Dann ließ er mich in Ruhe. Er belästigte mich nicht mal sexuell. Ich war ihm zu dünne, wie er sagte. Er erlaubte mir auch deshalb, soviel Fleisch und Wurst zu essen, wie ich wollte. Natürlich nur während der Arbeitszeit. Für das Wochenende gab er den beiden anderen Verkäuferinnen und mir immer etwas Feines mit für den Sonntagsbraten, wie er sagte.
Als Verkäuferin in einer privaten Fleischerei hatte ich mein erstes ordentliches Arbeitsverhältnis im Arbeiter-und Bauern-Staat.
Nachdem ich durch Rindfleisch und Koteletts tatsächlich wieder zu Kräften gekommen war, ging mir der Winter und meine Arbeit in der Fleischerei bald derart auf die Nerven, daß ich Depressionen bekam. “Hundert Gramm Jagdwurst, 100 Gramm Leberwurst und 150 Gramm Thüringer im Stück.” - “Rinderfilet haben wir nicht.” In Gedanken: Jedenfalls nicht für Sie. “Aber Kaßlerrippchen haben wir, die sind sehr schön. Fragen Sie mal Freitag nach. Freitag kommt neue Ware. Vielleicht ist da etwas dabei...” Das tägliche Einerlei. Immer die gleichen Handgriffe, Gespräche, die gleichen Kunden und Kommentare der Verkäuferinnen. Was ging mich das an? Das konnte nicht das Leben sein, jedenfalls nicht für mich.
Aber ich weigerte mich, mich mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen, in denen ich lebte. Ich lief, als hätte ich selbst eine Decke über mich geworfen, die mich unsichtbar machte, auch vor mir selbst. Es war eine Art Dämmerzustand, in den ich gefallen war. Ich wollte nichts wissen von der DDR, von Politik und vom sozialistischen Tralala. Ich las auch keine Zeitung in jener Zeit. Die Zeitungssprache erzeugte Brechreiz in mir.
Meine eigene Leere machte mir sehr viel Angst. Mit dieser Angst nahm ich eines Tages all die Pillen, die mir die Psychiater über Monate verschrieben hatten und die ich nicht genommen, wohl aber gesammelt hatte. Ich wachte in einem Krankenhaus auf. Die Station, auf der ich lag, hieß Reanimation. Mein Bett war umstellt von blauen Sauerstoffflaschen. Ich fühlte mich elend und war wütend auf die Ärzte und Schwestern, die um mein Leben kämpften, wie sie sagten. Was ging sie mein Leben an? Ich wollte es beenden, und sie hatten kein Recht, sich da einzumischen.
Als ich aus der Klinik entlassen wurde, hatte ich wieder keine Wohnung. Auf den Spaziergängen durch die Klinik aber hatte ich die Aushänge gelesen: “Suchen Krankenschwestern und Hilfsschwestern. Unterkunft im Schwesternwohnheim möglich.” Ich ging zur Personalabteilung und bewarb mich. Zwei Tage später fing ich auf einer chirurgischen Station als Hilfsschwester an. Ich trug Essen auf und ab, lernte Betten bauen und Steckbecken desinfizieren. Bald hatte ich gelernt, was zu lernen war als Hilfsschwester.
Wieder war da diese Leere in meinem Kopf und die Angst. Ich versuchte ein zweites Mal, mich umzubringen. Als ich in der Reanimation aufwachte, die gleichen Ärzte und Schwestern an meinem Bett sah, die mich “ins Leben” zurückgeholt hatten, schwor ich mir bei den blauen Sauerstoffflaschen an meinem Bett, hier nicht noch einmal zu landen. Nicht nur, weil ich auch hier in der medizinischen Reihenfolge der Wiederbelebungsmaßnahmen Routine befürchtete. Ich verstand, wenn auch nur undeutlich, daß ich nicht wirklich sterben wollte. Die Sinnfrage allen Lebens und Seins stellte sich zum ersten Mal mit großer Heftigkeit ein. Mit ungeheuerem Eifer ging ich ihrem WARUM, WESHALB, WOZU bald nach, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen.
Ich zog zu Alex. Ich hatte ihn in einer Nachtbar kennengelernt. Ich suchte sie ab und zu auf, wenn ich nicht schlafen konnte, weil meine diffusen Nachtängste so groß wurden.
Alex träumte von Motorrädern, Autos, von raffinierten Plattenspielern und modernen Radios. Alex dachte sehr konkret und bastelte immer an irgend einem Motor oder an einem Radio. Er war Elektroingenieur. Mit meinen abstrakten und lyrischen Sinnfragen konnte er nichts anfangen. Er liebte den Wald, nicht Eichendorffs Gedichte über den Wald. Wir zelteten viel und segelten. Er nahm mich mit in den Segelclub, den er über die Betriebsgewerkschaft nutzen konnte. Alex führte mich zurück in die Natur: zum Pilzesammeln - Pilzetrocknen, zum Beerensammeln - Marmeladekochen. Vorräte schaffen für den Winter. Wenn ich ihn fragte, für welchen Winter, wir seien doch schon tief in ihm, sah er mich verständnislos an. Alex war gut zu mir. Für große Liebe fehlte es mir an Kraft. Aber daß ich nicht mehr alleine war, auch nachts, wenn die Angst aufstand und mich mitnahm auf ihrem Schrei, daß ich mich festhalten konnte in solchen Momenten an Alex und seinen Atem spürte, beruhigte mich.
In dieser Zeit kümmerte sich wieder meine Mutter um mich. Es tat ihr leid, daß ich versuchte mich umzubringen. Schließlich liebe sie mich, sagte sie. Und es war ihr auch unangenehm, weil ich schließlich ihre Tochter war, die nicht einsehen wollte, daß ich, wie alle anderen auch, im sozialistischen Vaterland eine enorme Chance hätte, wenn ich nur wollte...
Selbstmordversuche waren nicht vorgesehen in der Ideologie des sozialistischen Glücksprogramms und daher moralisch nicht zu rechtfertigen. Schließlich gehörte dem Sozialismus die Zukunft und mir daher auch. Daß ich nicht einsah, welch ein Glück es für mich sei, an der besseren Zukunft der Menschheit teilnehmen zu können, sei allein meine Schuld. Ich sei verstockt, so meine Mutter. Ich wolle ihr wehtun, das sei der tiefere Grund für meine Trotzreaktionen. Als ich ihr klarzumachen versuchte, daß mir mein sozialistisches Leben hier auf die Nerven ginge, daß mich Routinearbeit fertigmache, daß ich an Stumpfsinn zugrunde ginge, versprach sie mir, sich um eine Arbeit für mich zu kümmern, in der ich Erfüllung fände, wie sie sagte. Und sie kümmerte sich auch tatsächlich. Ich wurde als Kulturfunktionärin in einem großen Krankenhauskomplex eingestellt.
Meine Mutter hatte das über die SED-Kreisleitung des Stadtbezirks eingefädelt. Sie selbst galt als Garant meiner politischen Zuverlässigkeit und sprach von dem großen Vertrauen, das sie für diese Stelle in mich gesetzt habe und von einem Risiko, das sie da eingegangen war. Ich sollte sie daher nicht enttäuschen. Natürlich begriff ich erst viel später, daß hier ein familiäres Vererbungsprinzip zur Anwendung gekommen war: Die politische Zuverlässigkeit meiner Mutter wurde auf mich übertragen, ohne daß meine wirkliche Eignung in Betracht gezogen worden war.
Die einzige Bedingung, die ich bei dieser Stellenvermittlung zu erfüllen hatte, galt einer Formsache, nämlich, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund beizutreten. Ich besprach den Eintritt mit Alex. Er fand nichts weiter dabei, in den FDGB einzutreten. Er sei selbst Mitglied dort, schon wegen des Segelclubs. Außerdem bekomme man billig Ferienreisen über die Gewerkschaft. In dem Eintritt sähe er keine Hürde, meinte er. Ich vergäbe mir nichts dabei. Ich trat also dem freien Bund bei und war plötzlich Kulturfunktionär in einem großen Krankenhaus. Für Ärzte und Schwestern sollte ich sozialistische Kultur organisieren. Was wußte ich davon. Ich griff zurück auf das, was ich kannte. Ich organisierte als erstes ein Konzert des Ärzteorchesters im Krankenhaus am Vorabend zum 1. Mai: Händel, Bartok, Brahms. Mit den Ärzten kam ich gut aus, die Fragen, die wir hatten, waren vornehmlich musikalischer Art. Neben Konzerten organisierte ich Tanzveranstaltungen. Lesungen standen auch auf dem Programm. Sie wurden mit der Gewerkschaftsbibliothek gemeinsam vorbereitet.
Die Programmanschläge der Ortskirche zu wöchentlichen Orgelvespern brachten mich auf die Idee, mit dem Pfarrer zu sprechen, ob wir nicht eine Reihe barocker Orgelkonzerte veranstalten könnten. Er war sehr angetan von der Idee. Ich hatte keine Ahnung, daß ich mit der Kirche nicht gemeinsame Sache machen durfte. Das erste Orgelkonzert fand an einem Freitag statt. Es wurden Bach und Buxtehude gespielt. Die Kirche war überfüllt. Als zwei Tage später der Organist krank war und nicht zum Gottesdienst spielen konnte, klingelte der Pfarrer in aller Frühe bei Alex und mir. Er fragte, ob ich nicht ausnahmsweise die Orgel spielen würde. Ich hatte ihm davon erzählt, daß ich in der Hochschule Orgel als Zweitfach hatte. Verschlafen wie ich war, konnte ich nur Ja-sagen. Er wartete, bis ich mich angezogen hatte, dann fuhren wir in seinem Trabant zur Kirche. Daran, daß ich als erstes den von Bach für die Orgel bearbeiteten Choral, “Wachet auf, ruft uns die Stimme” spielte, erinnere ich mich genau, auch weil ich selbst noch mit der Morgenmüdigkeit zu kämpfen hatte.
Am Tag darauf wurde ich zum Ärztlichen Direktor des Krankenhauses bestellt. In seinem Zimmer warteten der Gewerkschaftsvorsitzende, der FDJ-Sekretär und der Parteisekretär des Krankenhauses auf mich. Welche Stimmen denn da aufwachen sollten, war die Begrüßungsfrage. Ob ich nicht wisse, daß der Gegner gerade heutzutage in den Kirchenbänken säße? Als ich eine erste Erklärung versuchte, daß ich auf einen Gegner so früh am Morgen nicht gekommen sei, außerdem sei der Choral vor mehr als zwei Jahrhunderten geschrieben worden und also kein Kampflied, unterbrach mich der Parteisekretär: Es wäre ein Skandal, daß ich zum Gottesdienst in der Kirche spielte. Ich sei hier Gewerkschaftsfunktionär, das hätte ich anscheinend bislang nicht begriffen. Ob ich politisch nicht bei Verstand sei? Das war ich in der Tat nicht und verstand daher den Grund der ganzen Aufregung nicht. Auf meine Frage, wo ich denn sonst Orgel spielen sollte, schließlich stünden Orgeln nun mal in Kirchen und nicht in Gewerkschaftshäusern, bekam der Krankenhausdirektor einen Tobsuchtanfall. Er sprach von einer politischen Provokation ohne gleichen. Als ich versuchte zu erklären, daß sich Bach, soweit ich wisse, für Politik einen Dreck interessiert hätte, verwies er mich des Zimmers. Ich flog aus der eben erworbenen Stellung.
Zunächst einmal hatte ich wieder keine Arbeit, dafür aber ein Mitgliedsbuch des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Alex tröstete mich damit, daß solch eine Mitgliedschaft ruhen könne, ich aber bei einer von ihm beantragten FDGB-Reise trotzdem den gewerkschaftlichen Rabatt bekäme. Den Segelklub könnte ich bei ruhender Mitgliedschaft auch nutzen. Das waren die sachlichen Kommentare eines Elektroingenieurs, die ich an Alex so sehr mochte.