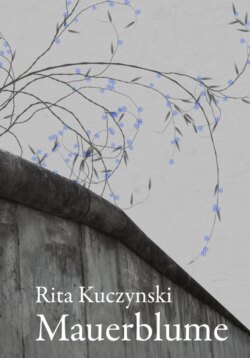Читать книгу Mauerblume - Rita Kuczynski - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDie Lust auf ein Angestelltenverhältnis war mir wieder einmal vergangen. Ich zog mich zurück und jobbte im Glühlampenwerk. Wenn keine besonderen finanziellen Ausgaben wie Urlaub oder Wintermantel anstanden, reichten zwei Nachtschichten in der Woche. Das Leben in der DDR war billig, wenn man von allen bürgerlichen Differenzierungen des Geschmacks absah. Und die bürgerlichen Standards, die an Essen, Trinken, Wohnen und an Kleidung und geknüpft waren, hatte ich ohnehin längst als Krimskrams verworfen. Essen hatte ich zur Nahrungsaufnahme degradiert, wobei ich mich an die sogenannten Grundnahrungsmittel hielt, wie sie von den DDR-Behörden so treffend benannt wurden. Diese Grundnahrungsmittel gab es beinahe gratis, das Wohnen auch. Die Mieten hatten eher einen Symbolwert. Eine Neubauwohnung mit Bad, Warmwasser und Zentralheizung war von Familien mit Kindern sehr begehrt. Daß diese Wohnungen im Lego-Baukasten-System des Plattenbaus gebaut waren, wurde seiner Eintönigkeit wegen, wenn überhaupt, nur von Intellektuellen bemäkelt.
Dieses Erlebnis, daß Essen, Trinken und Wohnen nahezu gratis sein können, wenn man von allem anderen absieht, gehört zu meinen wichtigsten Erlebnissen in der DDR. Im einfachen Wortsinn konnte in der DDR niemand verhungern, nicht einmal aus Protest. Man konnte schlecht essen und wohnen, aber wenn jemand auf der Parkbank schlafen wollte oder gar auf irgend einem Bahnhof, wurde er von der Polizei aufgegriffen und kam unter das polizeiliche Obdach.
Doch daß der Mensch nicht vom Brot allein lebt, war nicht erst seit Brecht bekannt. Einen Teil dessen, was der Mensch außer einem Obdach noch brauchen könnte, schwirrte an den DDR-Bürgern allabendlich auf der Mattscheibe in der Reklamezeit des Westfernsehens vorbei. Zunächst in schwarz-weiß, später in Farbe. Ich erzog mich in dieser Zeit zur Bedürfnislosigkeit gegenüber den alltäglichen Dingen. Dafür konsumierte ich, wie viele Intellektuelle im “Leseland DDR”, Bücher.
Ich wog mein spartanisches Leben auf mit dem Konsum philosophischer Literatur. Gierig verschlang ich ein Buch nach dem anderen: Heidegger, Nietzsche und Sartre. Alex’ Schwester hatte gerade diese Philosophie vor dem Mauerbau kontinuierlich gekauft. Zunächst aber las ich wie gebannt Heideggers “Holzwege” und war begeistert von jedem neuen Satz, den ich mir eroberte. Ich verstand nicht viel von dem, was ich las. Aber ich war getroffen von dem Rhythmus der Heideggerschen Sprache. Und mit jedem Satz traf er mich erneut, versetzte mir einen Schlag und schürte die Angst. Ja, die Panik war es, die sich angestaut hatte, und die Verzweiflung, die keinen anderen Weg aus mir fand als den der Selbstzerstörung. Für eben diese Existenzpanik gab es bei Heidegger bereits einen sprachlichen Ausdruck. Meine verrückte Angst hatte also einen Ort auch außerhalb von mir. Sie war kommunizierbar. Insofern beruhigten mich Heideggers Sätze auch, selbst wenn sie mich immer tiefer in die Verzweiflung trieben. Auszudrücken, was geschehen war und die eigene Leere durch Sprache zu überbrücken war die Absicht, die ich so erst wieder auszudrücken vermochte, als ich Sprache schon wieder gefunden hatte.
Alex mochte meine Nachdenklichkeit, zu der er keinen Zugang hatte. Sie brachten mich in die Nähe seiner älteren Schwester, die er über alles liebte. Alex fühlte sich auf eine unheimliche Weise von metaphysischen Fragen angezogen, hatte aber, bis er mich kennenlernte, eine Distanz zu ihnen halten können, auch weil seine Schwester gegenüber dem jüngeren Bruder Distanz wahrte, wozu ich in gar keiner Weise fähig war.
Neben Heidegger las ich Hölderlins “Hyperion”. Ich las ihn täglich, wie eine Bibel. Die Trauer um unwiederbringlich Verlorenes, die aus jeder Seite seines Romans sprach, brachte mir die Gewißheit, daß ich mit einem Verlust nicht allein war. Eher zufällig griff ich in dieser Zeit auch zu einer Taschenbuchausgabe von Hegels “Phänomenologie des Geistes”, die ich bei Alex’ Schwester fand. Es war das erste Buch, das ich von Hegel las. Der Rhythmus, in dem Hegel schrieb, war mir vertraut, die Satzmelodie bekannt. Sie erinnerte mich an Bach, genauer an die Struktur der Bachschen Fuge, an die Schrittfolge der Verknüpfung von Ton und Ton und daran, daß die Auslassung eines einzigen Schritts die ganze Komposition zum Einsturz zu bringen vermochte. Ja, an die “Kunst der Fuge” wurde ich beim Lesen der Hegelschen Sätze erinnert. Endlich widerschien da etwas aus meiner zerbrochenen musikalischen Existenz, das mir vertraut war, ein Rhythmus, ein Klang, an denen ich festhalten wollte, unbedingt. Ich war übervoll von Erlebtem und konnte die Erfahrung des Lebensbruchs dazugeben, mußte sie dazugeben, denn irgendwie mußte ich, um weiterzuleben, mit dem fertigwerden, was ich erlebt hatte. Läßt sich der Bruch berechnen, entsteht die Chance, nie wieder durch alle Raster ins Bodenlose zu fallen. Wenn es Regeln für Kontinuität gab, gab es auch Regeln, die ihren Abbruch berechenbar machten.
Ich hatte also endlich eine Frequenz gefunden, in der Kommunikation versucht werden konnte, Verständigung, die meine Sprachlosigkeit vielleicht aufzuheben vermochte. Weit ab von der wirklichen Welt, in der ich umherlief, hörte ich eine Wellenlänge, die für mich kommunizierbar schien. Den Heideggerschen Satzrhythmus setzte ich gegen den Hegels. Daß bei Hegel der Bruch nicht Abbruch war wie bei Heidegger, ließ mich immer wieder aufhorchen. Das war eine Art Trance, in die mich diese Sätze versetzen konnten. Entrückt vom Alltag, ging ich in meine Nachtschichten zum Glühlampenwerk und packte die Glühbirnen in ihre blauen Pappschachteln und war mit Sein und Nichts beschäftigt.
Ich hatte ein mir verträgliches Maß zwischen Bandarbeit und Existenzphilosophie gefunden und war einigermaßen im Lot mit mir, da trat Alex’ Schwester auf mich zu. Sie meinte, ich hätte nun wohl genügend Kraft geschöpft, um es doch noch darauf ankommen zu lassen, einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Sie habe sich in der Medizinischen Fachschule des Krankenhauses erkundigt, in dem sie als Medizinische Assistentin arbeitete. In jenem Jahr waren noch Studienplätze für den Beruf als Diätassistentin frei. Ich sollte mich doch bewerben. Da Alex ihre Meinung teilte, schaute ich mir an, um was es ging. In einer Lehrküche der medizinischen Schule wurde mir der Beruf praktisch vorgeführt: In unzählig kleinen Töpfen wurde Essen für Leberkranke, Gallendiäten, Brei für Magenkranke und Schonkost für Nierenpatienten angerührt. Schülerinnen mit weißen Haarnetzen versuchten ihre Suppen.
Die Idee, ab September auch vor solchen Töpfchen zu stehen und salzarme Diäten zu rühren, mobilisierte meine tatsächlich wiedergekehrten Lebenskräfte. Energisch kümmerte ich mich um einen Studienplatz im Fach Philosophie. Alex war nicht begeistert. Er wollte, daß ich einen ordentlichen Beruf erlernte. Ordentlich war für ihn, was seine Schwester tat, wenn ich nicht wie er ein Ingenieurstudium auf mich nehmen wollte. Meine Neigung zur Mathematik hatte er längst herausgefunden.
Ich blieb bei der Philosophie. Alex’ Schwester verstand mich und half. Sie kannte jemanden in Leipzig, der jemanden in Leipzig kannte, und der wieder kannte den Dekan der Philosophischen Fakultät. Eben diesem Dekan erzählte ich von dem traurigen Niedergang meiner musikalischen Existenz. Da er selbst musisch interessiert war und eine Schwester hatte, die ganz und gar in Musik aufging, wie er sagte, hatte er einiges Verständnis für musikalische Talente. Wir saßen lange in einer Speisegaststätte zusammen, wie Restaurants in der DDR hießen. Geduldig hörte er sich an, was ich zu sagen hatte über Sprache und Musik. Bei Sauerbraten mit Thüringer Klößen und Rotkohl erzählte ich ausführlich über den Zusammenhang des Bachschen Kontrapunktes mit der Hegelschen Satzmelodie und versuchte, ihn zu überzeugen, daß da strukturelle Gemeinsamkeiten bestünden, die ich spürte, aber unfähig war, sprachlich zu formulieren, was sich natürlich ändern würde, sobald ich Philosophie studierte. Ein Zusammenhang bestünde, ich hörte ihn ganz deutlich. Er könne mir schon glauben. Und was Bach betraf, glaubte er mir auch. Was er nicht glauben konnte, wie er mir später gestand, war, daß ich nicht wußte, was Philosophie in einem sozialistischen Land war.
Aber erst einmal versprach er, sich zu kümmern. Er wußte von den Schwierigkeiten der Immatrikulation für Studenten, die wie ich gestrauchelt waren, gab er mir zu verstehen. Ich solle inzwischen aber zumindest in ein Lehrbuch für marxistisch-leninistische Philosophie hineinsehen. Meinen Immatrikulationsbescheid bekam ich später von ihm persönlich zugeschickt und ging nach Leipzig.
Den an einzelne Personen gebundenen politischen Machtbefugnissen und der Möglichkeit ihrer willkürlichen Handhabe verdanke ich es, daß ich als Quereinsteigerin irgendwann immer da landete, wo ich landen wollte. Irgendeine der zuständigen Autoritäten hatte sich letztlich für mich persönlich eingesetzt und politische Verantwortung für mein Tun übernommen. Innerhalb der politischen Führungsschicht gab es immer wieder Menschen, die sich für mich einsetzten und auch ein Risiko übernommen haben, da sie damit rechnen mußten, daß ich mich politisch nicht korrekt verhielt, schon weil ich nicht wußte, was in der DDR politisch korrekt war. Damals begriff ich die Zivilcourage dieser Führungskader als menschliche Handlungen von Edelkommunisten. Daß ich politisch auch entmündigt war, begriff ich erst viel später.
In der Einführungsvorlesung für marxistisch-leninistische Philosophie erfuhr ich von einem blond und blauäugigen Professor mit Specknacken, daß hier niemand abginge, der nicht Mitglied der SED geworden sei und nicht verantwortungsvoll gegenüber dem Arbeiter-und-Bauern-Staat handeln würde. Ich hatte alle Mühe, keine Panikattacke zu bekommen.
Er sprach von der Arbeiterklasse, der zu dienen meine oberste Pflicht als Philosoph sei. Ich schluckte heftig, denn aus der Arbeiterklasse hatte sich gerade mein Vater bei der Universität gemeldet. Er hatte von meiner Mutter gehört, daß ich zum Studium nach Leipzig gegangen war. Bei der Universitätsleitung hatte er vorgesprochen. Er wollte klarstellen, daß ich erstens nicht normal sei, das könne bei den Psychiatern in Berlin nachgefragt werden, und daß ich zweitens politisch-moralisch eine Null sei. Dem Dekan erklärte er, er sähe überhaupt nicht ein, warum er für mich ein Stipendium zahle sollte. Er denke nicht im Traum daran. Er habe schließlich auch nicht studieren können. Mir erklärte der Dekan, daß meine Eltern zahlen müßten, ich könnte sie verklagen. Eltern, die über eine bestimmte Grenze hinaus Geld verdienten, müßten für das Stipendium ihrer Kinder aufkommen. Schließlich gäbe es Gesetze. Die Universität würde hinter mir stehen. Im Prorektorat für Studienangelegenheiten könnte ich die Einzelheiten erfahren.
Mir fehlte es an Kraft und Mut zu solch einem Gerichtsverfahren. Ich entschied, meine Nachtschichten in Leipzig weiterzuführen. Wenn auch nicht im Großbetrieb, sondern in der Nachtbar eines Interhotels, in der ich als Bardame vorsprach. Meine Kenntnisse von Wein, Weinbränden, einschließlich des Wissens, welches Glas für welches Getränk zu benutzen war, überzeugte das Barpersonal in einer Probeschicht. Daß ich bei meiner Großmutter für Abendgesellschaften mit dem Hauspersonal oft den Tisch decken mußte, kam mir also hier zugute. Da es ein Interhotel war, waren die meisten Getränke Import, das heißt aus dem Westen. Bei den Weinen hatte ich zu lernen, daß es ungarische, bulgarische und rumänische gab.
Da hatte ich also wieder mein Kontrastprogramm. Am Tage hörte ich Vorlesungen über die Vorzüge des dialektischen Materialismus und darüber, daß der Sozialismus siegen würde. Nachts mixte ich Cocktails und kokettierte mit den feindlichen Devisenbringern im Hotel Deutschland. Ich lernte meine Schweigsamkeit funktional einzusetzen. Ich sagte nichts, wenn ich aus meiner Buntlicht-Bar übernächtigt in die Vorlesung für Sozialismustheorie ging und hörte, daß es im Sozialismus keine entfremdete Arbeit gäbe. Ich hatte zum ersten Mal seit dem Niedergang meines musikalischen Talents wieder ein Ziel. Ich wollte wissen, was der Sinn des Lebens und der Welt war.
Damals faßte ich den Entschluß, nie Kinder zu gebären. Ich wollte zu jeder Zeit meine Zeit abbrechen können. Für den Fall, daß es nicht weiterging, wollte ich aus dem Leben gehen können, ohne daß ich Verantwortung zurückgelassen hatte, der ich hätte nachkommen müssen. Von meiner Familie hatte ich mich getrennt. Dabei wollte ich es belassen.
Die Familie, auf die ich zuging, war groß und unbestimmt, die Verantwortung praktisch folgenlos. Die Philosophen des Abendlandes, zu ihnen war ich auf dem Weg.
In Leipzig gab es einen exzellenten Gastprofessor aus der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, der Logik las. Die faszinierte mich: Dem Erlebten einen Wert zusprechen. Das bedeutete ein Maß für Erleben und Erlebtes zu finden. Ich vertiefte mich bis über den Kopf zunächst in Aussagenlogik, später dann in Widerspruchslogik. Bald hieß das Zauberwort dialektische Logik, das mich durch den Tag brachte. Die Dialektik ist die Logik der Widersprüche. Das war großartig. “Wahr” und “falsch” in einem Wert nehmen. Den Bruch zum Prinzip erheben. Was für ein Maß! Die Widersprüche benennen und sie in eine Logik bringen können. Ihnen eine Reihenfolge aufzwingen, damit sie beherrschbar werden.
Endlich hatte ich also einen zeitlosen Raum gefunden, in dem ich mich niederlassen und den ich sichermachen konnte gegen jene Wirklichkeit, in der ich mich nicht zurechtgefunden hatte. Ich war bereit, den Weg in die rationale Philosophie zu gehen. Ich war dabei, einen Faden aufzunehmen, einen, der lief, unbedingt.
Ich war fasziniert von der Methode, die mir emotional so sehr entgegenkam. Sie wurde die dialektische genannt: “Alles ist, alles ist nicht. Alles ist, in dem es nicht ist. Sein und Nichts wird zu Etwas. Was ich setzte, hebe ich, indem ich es setze, wieder auf.” Was für eine Dynamik, was für ein Klang! Das waren auch Tanzschritte: was ich in einem Schritt setze, hebe ich im nächsten Schritt wieder auf und komme trotzdem weiter. Es könnte also auch alles anders sein, als ich bisher annahm. Die Antworten, die ich bisher hatte, könnten auch Fragen sein. Wenn dem so ist, stimmte vielleicht selbst die Angst und ihre Größe nicht. Nach solcher Unschärferelation hatte ich gesucht. Sie war weit genug, damit mein Erleben einen Platz in ihr fand.
Den “Rest des Studiums” verschob ich auf äußere Bahnen. Das heißt, ich versuchte seine ganze Widrigkeit inhaltlich nicht an mich herankommen zu lassen. Zunächst gelang mir das nicht. Über den ersten Versuch einer Teilung meiner Person in eine wesentliche und eine un-wesentliche wurde ich krank. Bald konnte ich nicht mehr in meiner Buntlicht-Bar arbeiten. Die Kommilitonen des Studienjahres sammelten Geld, damit ich über die Runden kam. Das war gut gemeint, aber unerträglich für mich. Ich schmiß das Studium und ging nach Berlin zurück.
Alex in seiner nüchternen Art gab seinen Kommentar: Das habe ich dir ja gleich gesagt, Philosophie zu studieren ist ein absoluter Quatsch und macht krank. Ich diskutierte nicht. Ich war froh, wenn mir Alex eine warme Suppe brachte. Es dauerte, bis ich mich von mir erholt hatte und als Schulsekretärin in einer Grundschule vorsprach. Die Arbeit selbst war nicht besonders schwierig, aber man mußte sich auf sie konzentrieren. Das schaffte ich nicht. Ich war zu sehr mit Sein und Nichts beschäftigt, das unter bestimmten Bedingungen dasselbe sein konnte. Ich machte bei der Arbeit unverzeihliche Fehler. Nachdem ich irgendwelche Einladungen für den Elternbeirat zum Milchhof und die Rechnungen für die Schulmilch zu den Eltern geschickt hatte, gab es einen ziemlichen Krach mit dem Direktor. Er wollte mich als Sachbearbeiterin in den Rat des Stadtbezirks befördern lassen. Da könnte ich weniger Unheil anrichten. In seiner Schule könne er mich nicht länger ertragen. Ich kündigte und ging wieder ins Glühlampenwerk zur Nachtschicht. Bei dieser Arbeit konnte ich zumindest meinen Kopf frei halten.
Aber es lag auf der Hand, beim Sortieren der Glühlampen und ihrem Verpacken am Fließband kam ich nicht weiter mit meiner Frage nach Sein und Nichts und ihrem Klang. Bald drehten sich die Wörter im Kreis und nahmen zeitweilig den Takt des Laufbandes an, auf dem die Glühlampen mir entgegenkamen.
Ich verstand, ich mußte noch einmal von vorne beginnen. Nach einigem Zögern beschäftigte ich mich daher endlich mit den politischen Prämissen eines Philosophiestudiums in der DDR, um diesmal klüger und effizienter mit meiner Kraft umzugehen.
Ich ging zur Humboldt-Universität, ließ meine Immatrikulation von Leipzig nach Berlin umschreiben und begann 1966 noch einmal im ersten Studienjahr. Zuvor hatte ich allerdings das Problem des Stipendiums zu regeln. Mit den Eltern zu verhandeln war aussichtslos. Die Lösung fand ich in den Verordnungen für den Erhalt eines Stipendiums selbst. Da stand nämlich, als Verheiratete bekomme ich unabhängig vom Einkommen der Eltern ein Stipendium. Ich heiratete daraufhin meinen homosexuellen Freund Dieter. Ihm war der Status ”Verheiratet” auch willkommen, da Schwulsein in der DDR zu dieser Zeit noch verboten war und nicht nur politisch verfolgt wurde. Für zehn Mark Schreibgebühren schlossen Dieter und ich also die Ehe. Wir bestanden auf einem Doppelnamen. Nach diesem formellen Akt unterschrieben wir beide ein persönliches Schriftstück, in dem wir uns verpflichteten, nach einem Jahr die Scheidung einzureichen. Grund: “Sexuelle Unverträglichkeit”. Das taten wir auch, ohne dem hohen Gericht mit Einzelheiten aufzuwarten. Die Scheidung kostete 200 Mark. Der Status: “Geschieden” garantierte mir weiterhin ein Grundstipendium von 185 Mark im Monat. Das war nicht viel, reichte aber zum Überleben.
Danach heirateten Alex und ich, obwohl Alex nach wie vor mit meinem Philosophiestudium nicht einverstanden war.