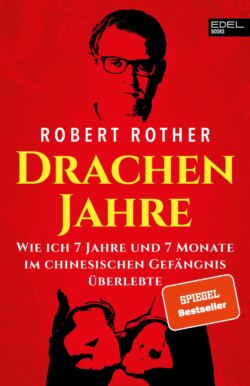Читать книгу Drachenjahre - Robert Rother - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2 KONTOERÖFFNUNG
ОглавлениеEs gibt nur einen Weg, die Hölle zu überleben: Man muss abstumpfen, sich emotional abschotten, dicht machen, alle Gefühle wegdrücken, verdrängen. Nichts fühlen, nichts sehen, nichts hören. Hart zu werden, war meine einzige Chance, und das habe ich geschafft, obwohl es oft bis zur Selbstaufgabe ging. Ich lief vorbei an Folteropfern mit schmerzverzerrten Gesichtern – und registrierte ihre Qualen wie ein Buchhalter den Eingang einer Rechnung. Wenn ich noch Mitgefühl hatte, drang dies nicht bis in mein Bewusstsein vor. Ich wäre sonst auch durchgedreht. Dabei war mir glasklar, welch fundamentales Unrecht hier geschah. Folter ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Menschenrechte. Doch was hätte ich tun können? Schreien? Randalieren? Ich hätte lediglich riskiert, selbst auf dem Eisernen Stuhl zu landen und von anderen Häftlingen mit Augen wie aus Stahl angesehen zu werden. Ich hatte nur noch ein Ziel: Ich wollte überleben.
Seelischen Schmerz sollte man sich im Knast auf keinen Fall anmerken lassen. Wer Schwäche offenbart, gerät von zwei Seiten unter Druck: Die Wärter traktieren dich, gleichzeitig verachten dich die anderen Gefangenen (oder verprügeln dich), weil du ein Schlappschwanz bist und sie einen noch Schwächeren gefunden haben.
Noch in der Untersuchungshaft hatte ich Vom Winde verweht von Margaret Mitchell gelesen. Der Roman spielt zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, bei dem es um die Abschaffung der Sklaverei ging. Das Motto der Romanheldin Scarlett O’Hara lautet: »After all, tomorrow is another day!« Ihre Devise: »Morgen ist auch noch ein Tag!« wurde im Gefängnis mein Leitspruch, an dem ich mich im Stillen immer wieder aufrichtete. Für mich bedeutete er: Mit Seelenqualen muss ich mich heute nicht plagen. Ich kann sowieso nichts ändern.
Ich verbarg also meine Gefühle und erschütternden Erfahrungen wie in einer Schublade: rein damit und weg. Ich dachte: Eines Tages, wenn die Umstände andere sind und wenn ich dazu in der Lage bin, werde ich sie öffnen und mich um den Inhalt kümmern. Das war die richtige Entscheidung. Inzwischen habe ich verstanden, dass die vielen schrecklichen Erlebnisse, auch wenn ich sie verdrängt habe, einen anderen Menschen aus mir gemacht haben. Es ist so hart, wie es klingt: Gerettet hat mich der pragmatische Umgang mit Schmerz – eigenem und fremdem, körperlichem und seelischem. Ich wollte lebend raus aus der Hölle, um später davon erzählen zu können.
Ich lernte, alles, was mich bewegte, worunter ich litt, mit mir selbst auszumachen, aber auch, meiner Familie Normalität und gute Laune vorzugaukeln – und wenn es sein musste, sogar mir selbst. Bereits in der U-Haft lernte ich, zu verdrängen. Ich sagte mir: Morgen ist dieser Wahnsinn vorbei. Oder übermorgen. Allerspätestens. Meine Briefe nach Hause, die genehmigten wie die herausgeschmuggelten, sind ein beredtes Zeugnis dafür. Bis zu meiner Verurteilung redete ich mir mantraartig ein, bald wieder frei zu sein. Und tatsächlich glaubte ich auch fest daran, dass der ganze Spuk sich bald in Luft auflösen würde, wie die Gespenster, die ich als Kind im Flur sah, weshalb nachts dort das Licht brennen und die Tür zu meinem Zimmer einen Spalt offen stehen musste.
In der Hölle von Dongguan wollte ich – anders als in der Untersuchungshaft – niemanden aus der Familie sehen, nicht mal meine Mutter. Ich hätte es nicht ausgehalten. Jeder Gefangene, der sich in den Augen der chinesischen Polizei gut benahm, durfte einmal im Monat 30 Minuten einen einzigen Besucher empfangen. Damit erpressten sie einen: Wenn du brav bist, darfst du jemanden empfangen … Nicht mit mir! Für meine Mutter wäre das ein Wahnsinnsaufwand gewesen, psychisch und finanziell. Und reden konnte man sowieso nur per Telefon, getrennt durch eine dicke, versiffte Panzerglasscheibe. Eine Umarmung, ein Handschlag, eine Berührung – alles verboten, alles nicht möglich! Ich hatte immer versucht, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Gedanken an meine Familie, mein Zuhause schob ich sehr weit weg – anders ging es nicht.
In der U-Haft hatte ich noch mitbekommen, dass mein Großvater an Blutkrebs erkrankt war. Meine Mum hatte mir einen langen Brief geschrieben, in dem sie seine letzten Tage ausführlich schilderte. Sie wusste, wie sehr ich an ihm gehangen hatte, was er mir bedeutete. Erst mit einem Jahr Verspätung ist mir der Brief im Knast ausgehändigt worden. Die Chinesen hatten ihn mir vorenthalten. Den Grund dafür habe ich nie erfahren. Der Gedanke, dass ich mich von meinem Großvater nicht hatte verabschieden können, war entsetzlich. Ich unterdrückte meine Tränen, fraß die Trauer in mich hinein. Sich nur nichts anmerken lassen, nur keine Schwäche zeigen, niemand sollte mitbekommen, wie es mir ging. »After all, tomorrow is another day!«
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. In einem Kassiber aus dem Gefängnis schrieb ich: »Liebe Oma und lieber Opa, wie geht es euch? Ich hoffe, Opa hält noch durch! Gott hat mir gesagt: Du schaffst es! Dass wir noch angeln gehen können. Freue mich schon darauf.« Und wenige Wochen später malte ich an die Zellenwand: »Hallo Opa! Du musst noch ein wenig durchhalten, bis ich zurückkomme. Einmal müssen wir noch angeln gehen und das Schiff fahren lassen. Solltest du dich aber schon früher verabschieden, dann ist das nicht schlimm. Die neue Welt ist deutlich besser als die jetzige, frei von Schmerz. Dort treffen wir uns dann wieder. Liebe Grüße, Robert.«
Ach ja, unser wunderbares Schiff! Ich liebte meinen Großvater und hätte viel dafür gegeben, noch einmal mit ihm in See zu stechen. Er wäre wieder der Kapitän gewesen, ich sein Schiffsjunge. Wie damals, als ich klein war und mir Opa ein Stück von der großen weiten Welt zeigte, die gleich hinter dem Elternhaus begann. Wir gingen auf Abenteuer, fuhren oft zum Angeln und zelteten. Wenn es dunkel war, lauschte ich seinen Geschichten. Er war ein echter Bilderbuchgroßvater.
Als Kind hatte ich eine blühende Fantasie. Ich war begeisterter Modellbauer, bastelte Autos, Flugzeuge mit Fernsteuerung – und eben mein und Opas Traumschiff. Für teures Spielzeug hatten wir kein Geld, vieles machte ich selbst. Und mein Großvater half mir dabei. Zusammen bauten wir das Schiff. Mit seinen eineinhalb Metern Länge ist es auch heute noch sehr imposant. Ich war der Konstrukteur, der es entwarf, Opa sägte die Teile aus und verleimte sie.
Niemand traute mir zu, ein funktionstüchtiges Schiff dieser Größe oder überhaupt irgendwas Brauchbares hinzubekommen. Das war etwas, was mich mein Leben lang begleitete: Immer fühlte ich mich von Menschen unterschätzt. Und gerade das trieb mich an, motivierte mich, Erfolg zu haben, Geld zu verdienen. Mir ging es in erster Linie gar nicht so sehr um die Kohle. Klar, welche zu haben, ist natürlich schön. Vor allem ging es mir darum, der Welt zu beweisen, dass ich es zu etwas bringen kann, mit dem niemand rechnete.
Mein Opa hatte ein wenig die Rolle meines Vaters übernommen. Papa starb, als ich 20 Monate alt war. Ich kenne ihn nur von Fotos. Dass ich überhaupt geboren wurde, ist ein medizinisches Wunder. Meine Mutter hatte vor meiner Geburt eine Eileiterschwangerschaft und musste notoperiert werden. Nach dem Eingriff sagte ihr der Arzt: »Ihren Kinderwunsch können Sie vergessen.« Meine Eltern wollten das allerdings nicht einfach so akzeptieren, und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis meine Mutter mit mir schwanger wurde. Geboren wurde ich am 12. September 1982 in Dortmund.
Mein Vater war Informatiker und verdiente ganz ordentlich. Alles, was ich über ihn weiß, weiß ich von meiner Mutter. Sie lernte ihren Reinhard bei Freunden kennen. Er war ein hübscher, junger Mann mit Lederjacke und halblangen Haaren, einer Art Günther-Netzer-Frisur, wie sie in den 70er-Jahren modern war. Um meine Mutter war es sofort geschehen. Sie riskierte für ihren Freund ein Zerwürfnis mit ihren Eltern, denen es nicht passte, dass sie zu einem »Langhaarigen« zog.
Mein Vater trieb viel Sport. Dass er zu hohen Blutdruck hatte, wurde durch Zufall entdeckt. Meine Eltern waren zu Besuch bei einem Freund, der ein Blutdruckmessgerät zum Testen daheim hatte, das sie aus Spaß alle ausprobierten. Nachdem mein Vater sich die Manschette umgelegt hatte und seine Werte ermittelt waren, sagte der Freund: »Reinhard, du musst zum Arzt.« Es wurde bei ihm eine Herz-Kreislauf-Erkrankung diagnostiziert. Mein Vater nahm die ihm verschriebenen Tabletten, und alles war okay. Bis zu dieser verhängnisvollen Nacht. Ihm war hundeelend und er wurde mit Blaulicht in ein Krankenhaus gebracht, in dem die Ärzte jedoch nicht erkannten, dass er in akuter Lebensgefahr schwebte. Sie schickten ihn in eine andere Klinik, wo er sofort auf die Intensivstation kam. Zu spät. Seine innere Blutung konnte nicht mehr rechtzeitig gestillt werden.
Was für ein Schock! Meine Mutter war aus heiterem Himmel Witwe geworden – fünf Wochen vor dem ausgerechneten Geburtstermin meiner Schwester. Nur dank der Hilfe ihrer Familie überstand meine Mutter diese schwere Zeit. Mein Vater ist nur 31 Jahre alt geworden. Ich glaube, ich fühlte mich ihm im Gefängnis so nah wie nie zuvor. Er war auf ganz besondere Weise bei mir, ich führte sogar Gespräche mit ihm.
Im April 1984 kam meine Schwester Melina zur Welt. Meine Mutter sagt immer: »Robert, du warst ein liebevoller Bruder.« Sie beteuert, ich hätte ihre Notlage schon als Dreijähriger verstanden und sei deshalb immer artig gewesen und hätte brav auf mein Schwesterchen aufgepasst. Meine Mutter ist wenige Monate nach dem Tod meines Vaters mit einem neuen Mann zusammengekommen, den ich nie ausstehen konnte, weshalb ich hier den Mantel des Schweigens über ihn ausbreite. Es dauerte nicht lange, dann kam mein Halbbruder Max zur Welt.
Der frühe Verlust meines Vaters war meine erste Begegnung mit dem Tod, aber nicht die einzige in meiner Kindheit. Im Alter zwischen vier und zehn Jahren litt ich an schlimmem Krupphusten. Wenn ich nachts einen schweren Asthmaanfall hatte, wusste ich, was zu tun war: Ruhe bewahren, aufstehen, zu Mama runtergehen. Die Überlebensstrategie eines kleinen Jungen, dem bewusst war: Wenn ich in Panik gerate, verschlimmert das nur die Atemnot. Meine Mutter fuhr mich ins Krankenhaus, wo ich ans Sauerstoffgerät kam. Von den ersten Symptomen bis zum rettenden Luftschlauch vergingen 45 Minuten. Dieser Ablauf wurde über die Jahre zur Routine. Ich erlebte diese Dreiviertelstunde Lebensgefahr wie in Trance. Es war, als schaute mein Geist von oben auf meinen Körper. So lernte ich als Kind, dem Tod in die Augen zu schauen, ohne in Panik zu geraten, und diese Extremsituation zu meistern, indem ich meine Atmung kontrollierte. Gerade in den ersten Tagen der Untersuchungshaft, als ich oft das Gefühl hatte, mir drücke jemand die Kehle zu, griff ich auf das bewährte Mittel aus der Kindheit zurück. Die Technik half, meine innere Ruhe zu bewahren.
Als Kind und Jugendlicher habe ich mir oft gewünscht, tot zu sein. Vielleicht, um meinem Vater näher zu sein. Der Gedanke, alles hinter mir zu lassen, war verlockend. Der Tod versprach Erlösung. Ich war zwar kein Sonderling oder Außenseiter in der Schule, aber hatte immer das Gefühl, nicht dazuzugehören.
Mir wurde ständig gesagt, dass das, was ich mache, plane, konstruiere, nicht funktionieren könne. Ich solle doch – wie die anderen – den »normalen Weg« gehen: Schule, Abi, Studium, Beruf, Heirat, Kinder, Doppelhaushälfte. Je öfter ich das hörte, desto mehr spornte es mich an, es anders zu machen. Es war, als kippte jemand Öl in das Feuer, das in mir loderte – und das mich schließlich nach China trieb. Es gab kein Halten für mich. Es ging weiter, immer weiter. Geld machen, mehr Geld machen, noch mehr Geld machen. Ich brauchte all die Millionen Dollar nicht, die ich verdiente – sie nährten nur die Flamme. Doch sie erlosch schlagartig, als ich mit 28 Jahren in die Untersuchungshaft kam und gezwungen war, mir zum ersten Mal ernsthaft die Frage zu stellen: Wofür machst du das alles?
Während der Grundschulzeit machte ich zunächst das, was alle Jungs gerne tun: Fußball spielen, Rad fahren, rumtollen. Doch dann fesselte mich ein für Kinder etwas ungewöhnliches Hobby. Mit elf Jahren entdeckte ich die Welt der Aktien. Meine Freunde gingen reiten, kickten, spielten Cowboy und Indianer oder träumten von der Formel-1-Weltmeisterschaft. Ich schaute Telebörse und zeichnete Charts, die den Verlauf von Aktienkursen abbildeten. Diese Kurven faszinierten mich ungemein. Ich beschäftigte mich mit wirtschaftlichen Themen und fing an zu kapieren, warum der Kapitalmarktwert eines Unternehmens fiel oder stieg, wenn dieses oder jenes passiert. Offensichtlich hatte ich Talent auf diesem Gebiet. Ich begriff, dass die Börse ein Mix aus Fakten und Irrationalität ist, dass alle dem großen Geld hinterherjagen und damit das Spiel immer weiter befeuern. Versprichst du jemandem, ihn reich oder noch reicher zu machen, wirft er dir die Kohle hinterher.
Beim SG Massen spielte ich rechter Verteidiger. Im Gegensatz zu vielen meiner Schulkameraden war es nie mein Traum, Fußballprofi zu werden. Auch weil ich wusste: Selbst Bundesligaprofis werden nie so reich wie Banker und Fondsmanager. Was verdienten die Kicker schon im Vergleich zu George Soros oder Warren Buffett?! Kleckerbeträge. Für mich stand fest, dass ich niemals nur für ein paar Kröten arbeiten wollte. Ich wollte raus aus den Verhältnissen, in denen meine Familie lebte. Also warum nicht mit Aktien handeln und jede Menge Asche verdienen, statt früh um vier Uhr aufzustehen und für ein paar Taler Zeitungen austragen?! Ich sah mich schon damals jede Menge bedrucktes Papier in den Händen halten, aber keine Zeitungen, sondern Banknoten, wie ich es später in China tatsächlich erlebte, als ich wie in einem Gangsterfilm in Koffern Millionen in Scheinen nach Hongkong brachte.
So ging ich, ein Bengel von 13 Jahren, zur Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in Unna – wir waren inzwischen hierhergezogen – und erklärte: »Ich möchte ein Aktiendepot eröffnen.« Am Empfang stand ein Sparkassen-Angestellter, der aussah, wie man sich einen Sparkassen-Angestellten in Unna vorstellt: Anzug, Krawatte, Scheitel. Er sagte: »Das geht nicht. Du bist zu jung.« Ich erwiderte: »Warum? Das ist keine Frage des Alters. Ich glaube, ich kann das.« Der Sparkassen-Angestellte ließ sich erweichen und schickte mich eine Etage höher zu einem Kollegen. »Geh hoch und versuch dort dein Glück.«
Ich ging in den ersten Stock hinauf und wurde von einem älteren Angestellten empfangen, der aussah, wie man sich einen älteren Sparkassen-Angestellten in Unna vorstellt: Anzug, Krawatte, Scheitel. Er dürfte kurz vor der Pensionierung gestanden haben. Er reagierte so verdutzt, als hätte ich soeben gesagt: »Hände hoch, das ist ein Banküberfall!« Ich konnte das schon als Kind nachvollziehen. Ich bin mir sicher, die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, war für Angestellte der Sparkasse Unna weitaus größer als die, dass ein 13-Jähriger vorbeikam und erklärte, in den Aktienhandel einsteigen zu wollen. »Das geht nicht. Du bist viel zu jung«, sagte der Mann, als hätte er sich mit dem Kollegen von unten abgesprochen.
Ich trottete nach Hause, suchte nach einer Lösung und fand eine. Meine Mutter stellte mir eine Vollmacht aus und unterschrieb eine Einverständniserklärung. Gemeinsam mit ihr ging ich wieder zur Sparkasse und regelte alles. Ich durfte mein erstes Aktiendepot eröffnen und investierte die 5000 Mark, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Von nun an rief ich jeden Tag in der Bank an und gab meine Kauf- und Verkaufsorder durch.
Die Sparkassen-Mitarbeiterin, die für mich zuständig war, hieß Frau Kopmann. Wir verstanden uns bestens. Jeden Tag rief ich während der Schulzeit bei ihr an, zunächst noch von der Telefonzelle in der Nähe des Ernst-Barlach-Gymnasiums aus. Doch schon bald kaufte ich mir von meinen ersten Gewinnen ein Siemens-Handy, eins von der Sorte, die eine halbe Tonne auf die Waage brachten. Jetzt konnte ich schneller auf die Entwicklungen an der Börse reagieren. Meistens flitzte ich nach dem Unterricht zur Sparkasse, um die Kassakurse zu checken. Danach fuhr ich – mal triumphierend, mal frustriert – mit dem Bus nach Hause.
In der Schule machte ich kein Geheimnis aus meinen Geschäften, Freunde und Lehrer wussten, was ich trieb. Einige fanden spannend, was ich machte, andere hielten es für Angeberei, was mir egal war. Ich schwänzte nun immer häufiger den Unterricht. Ging der DAX in den Keller, ging Robert nach Hause.
Mit 17 gründete ich mit der Nauerz & Noell Aktiengesellschaft mein erstes Unternehmen – gemeinsam mit zwei Partnern, die in den USA an den Börsen unterwegs waren. Sie hatten mich im Internet entdeckt und angefragt, ob ich Interesse an einer Zusammenarbeit hätte. Ich brachte 50 000 Mark Startkapital ein. Wir setzten auf alternative Investments, die damals kaum jemand kannte und die nach der Lehman-Pleite in Verruf gerieten: Eigenhandel, Termingeschäfte, Hedgefonds und Private Equity. Im Jahr 2000 zog die Nauerz & Noell um ins Steuerparadies: Wir gründeten einen Hedgefonds als Briefkastenfirma auf den Cayman Islands. Ich habe dabei erlebt, wie leicht es ist, den Fiskus zu umgehen.
Die Schule brach ich irgendwann ab, nicht zuletzt, weil sie mir nichts mehr brachte, obwohl ich eigentlich ja ein Fachabitur Wirtschaft ablegen wollte. Es war inzwischen so, dass mir die Lehrer Dinge erklärten, von denen ich aus eigener Erfahrung mehr Ahnung hatte als sie selbst. Ich zog die Schule des Lebens vor.
Ich lebte fast nur noch in der Bankenmetropole Frankfurt. Zeitungen berichteten über mich, über den 18-Jährigen aus Unna, der am Aktienmarkt mitmischt. Einmal wurde ich in den Schlagzeilen als »junger Wilder« bezeichnet. Tatsächlich war Nauerz & Noell eine der ersten Firmen in Deutschland, die nicht auf langfristige Anlagestrategien setzten, sondern Wertpapiere minütlich kauften und verkauften. Ich gab Schulungen für angehende Daytrader, mit denen ich 2000 Euro am Tag verdiente. In dieser Zeit rackerte ich wie verrückt, jeden Tag von frühmorgens bis Mitternacht. Bis ich zusammenbrach. Ich war total ausgebrannt, pfiff aus dem letzten Loch wie damals als Kind, wenn ich einen Krupphustenanfall hatte. Meine Familie erkannte mich nicht wieder, meine Schwester fand mich bescheuert und ziemlich abgehoben. Im Herbst 2003 zog ich die Reißleine und verkaufte meine Anteile an der Firma für 200 000 Euro.
Ein paar Wochen hing ich rum, ohne eine Ahnung zu haben, wie es weitergehen könnte. Anfang 2004 fragte mich mein Freund Gunther, ob ich Lust hätte, ihn für zwei Wochen nach Shanghai zu begleiten, wo er im Import-Export-Geschäft tätig war. Warum nicht, dachte ich. Ich hatte ja nichts zu tun. Von China hatte ich keinen blassen Schimmer, wusste nur, dass es eine Wirtschaftsmacht ist, in der die ganze Welt produzieren lässt, und dass dort seit Jahrzehnten Kommunisten regieren, die in Wahrheit Erzkapitalisten sind.
Im Februar 2004 landeten wir in Shanghai. Von der ersten Minute an war ich begeistert. Alles war riesig, brandneu und funktionierte, sogar der Transrapid, den die Bayern nicht auf die Spur kriegten. Hier lief er wie am Magnetbahnschnürchen. Mit 430 km/h rauschte das Gefährt superleise vom Flughafen in Richtung Zentrum.
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich bei den ersten Schritten durch diese Monster-Millionen-Metropole nur »Wahnsinn« dachte. Jeder Straßenzug, jeder Wolkenkratzer sprengte die mir bekannten Dimensionen. Dazu das unvorstellbare Gewusel. Menschenmassen ohne Ende. Schon damals hatte Shanghai mehr als 20 Millionen Einwohner. Ein Ameisenhaufen ist nichts dagegen. Wenn das Klischee der niemals schlafenden Stadt auf irgendeinen Ort der Erde zutraf, dann auf Shanghai. Sie leidet kollektiv an ADHS.
Wir stiegen im Jin Mao Tower ab, einem Fünfsternehotel mit 88 Stockwerken im Finanzdistrikt Pudong. Das Gebäude ragt 420 Meter hoch in den Himmel. Dort orderten wir eine Flasche guten Whiskey, redeten und redeten, tranken und tranken und fielen irgendwann todmüde ins Bett. Ohne erklären zu können, was mich geritten hatte, wusste ich am nächsten Morgen, als ich aus dem Fenster sah: Das ist meine Stadt! Das ist mein Land! Hier werde ich Millionen verdienen! Ein Tag in China hat mir gereicht, um von dem Riesenland so fasziniert zu sein, dass ich es zu meiner Wahlheimat machte.
Ich hatte keine Probleme, mich auf all das Neue einzulassen, nur das Essen empfand ich als gewöhnungsbedürftig. Wir wohnten in Tophotels mit sauberen und – vor allem – schnell erreichbaren Toiletten. So, wie Zwangsneurotiker immer zuerst nach Notausgängen und Fluchtmöglichkeiten suchen, wenn sie einen Raum betreten, schaute ich mich reflexartig nach dem nächsterreichbaren Klo um.
Gunther zeigte mir einen der Großhandelsmärkte. Mir verschlug es den Atem. Das KaDeWe in Berlin wirkte dagegen wie ein Tante-Emma-Laden. Man konnte sich in den Katakomben verlaufen. Nirgendwo gab es Fenster. Brandschutz? Existierte genauso wenig wie Notausgänge. Markenschutz? Ein Thema der westlichen Welt, das in China keinen interessierte. Es wimmelte nur so von Anbietern, Käufern und Dolmetschern. Keiner der Händler sprach Englisch, nicht mal ein paar Brocken. Aber meistens reichte sowieso ein simpler Taschenrechner, um einen Deal klarzumachen.
Die Großhandelsmärkte sind eine eigene ökonomische Kraft in China. Sie sind wie eine niemals endende Messe. Klamotten, Schuhe, Handtaschen, Elektronik, Haushaltswaren, Lebensmittel – es gibt nichts, was es dort nicht gibt. Einzelstücke oder kleine Mengen kann man sofort kaufen, größere Stückzahlen bestellen. Fünf maßgeschneiderte Anzüge bis übermorgen? Kein Problem. 200 Gucci-Taschen bis nächste Woche? Kein Problem. 3000 Nike-Turnschuhe bis nächsten Monat? Kein Problem. Der Kunde bezahlt und holt die Ware ab oder lässt sie anliefern.
In meinem Kopf ratterte es. Ich sah mich Schuhe nach Deutschland verkaufen oder Jogginghosen. Oder doch besser Schuhe? Ich war fix und fertig nach der Tour durch diesen unglaublichen Konsumtempel und sagte zu Gunther: »Ich brauche jetzt dringend einen Whiskey. Oder besser gleich eine Flasche.« Wir gingen in eine der schon am frühen Abend überfüllten Bars, tranken Whiskey, Cognac, Sekt, alles durcheinander, und bereiteten uns aufs Nachtleben vor. Exzess-Saufen ist bei uns verpönt, in China aber eine völlig angemessene Art zu zeigen, dass man das Leben genießt und Spaß hat. Wer aus der Bar sturzbesoffen hinausgetragen wurde, zog nicht etwa angewiderte, abschätzige Blicke auf sich, sondern wurde bewundert und gefeiert. Überall wimmelte es nur so von Frauen und Männern, die Unmengen an Schnaps, Wein und Champagner soffen, palaverten, lallten, kicherten und Würfel aus einem Becher auf Tische purzeln ließen. Sie spielten das, was in Deutschland als Mäxchen, Meier, Einundzwanzig oder Lügen bekannt ist.
Ich habe keinen einzigen Chinesen getroffen, der das Spiel nicht kannte und liebte. Es ist eine Art Volkssport. Es geht darum, mit zwei Würfeln in der Summe eine Augenzahl zu erreichen, die höher sein muss als die, die der Mitspieler, der vorher dran war, hatte. Wer gewürfelt hat, schaut – für alle anderen verdeckt – unter den Becher und teilt mit, wie viele Augen er hat, wobei das der Wahrheit entsprechen kann oder im Fall, dass die Summe zu gering ist, gelogen sein muss, um eine höhere Zahl zu haben. Der nächste Spieler glaubt entweder die Zahl und würfelt dann selbst – oder er bezweifelt die Ansage des vorherigen Mitspielers und schaut nach. Verloren hat entweder der, der des Schwindels überführt wurde, oder der, der den Vorgänger fälschlicherweise der Lüge bezichtigt hat.
Wir spielten mit und zeigten so, dass wir die Kultur der Chinesen respektierten. Das Würfelspiel war der beste Eisbrecher, um mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, zumal die Zahlen mit den Fingern angezeigt wurden und wir nicht reden brauchten. Nur saufen. Wichtig war, ein guter Verlierer zu sein, einen auszugeben und – auch wenn man gewonnen hatte – mitzutrinken.
Gunther und seine chinesische Partnerin nahmen mich überall mit hin. Sie waren meine Lehrer, sie zeigten mir, was man in China als Geschäftsmann wissen und machen musste. Vor allem brachten sie mir die für Ausländer überlebenswichtigen Tischregeln bei. Beim Mittag- und Abendessen geht es in China nicht einfach nur darum, in gemütlicher Runde zu speisen. Diese gemeinsamen Essen werden als gesellschaftliches Ereignis zelebriert, weshalb Einladung und Gegeneinladung mehr als nur ein Akt der Höflichkeit sind. Die gemeinsamen Mahlzeiten dienen dazu, Vertrauen zu schaffen, Freundschaften und Netzwerke zu aufzubauen und zu festigen. Nur Ausländer, die die Tischsitten ohne Wenn und Aber respektieren und beherrschen, werden als gleichwertig geachtet und behandelt. Wer sich nicht darauf einlässt, kriegt keinen Fuß, noch nicht mal einen Zeh in eine chinesische Tür – auch wenn er in seiner Heimat noch so reich und angesehen ist.
Man muss wissen, wer der Boss am Tisch ist, wie die Rangordnung aussieht. Der Esstisch ist immer rund – ein Zeichen der Verbundenheit aller Anwesenden. Die Stellung jedes Einzelnen in der Hierarchie spiegelt der jeweilige Sitzplatz wider. Die Gastgeber oder wichtige Gäste sitzen direkt gegenüber der Eingangstür, damit sie sofort sehen, wer hereinkommt. Wer mit dem Rücken zur Tür sitzt, steht in der Hierarchie unten. Die Ehefrauen, die oft nur schweigende Anhängsel ihrer Männer sind, fahren nach dem Essen heim. Die Kerle bleiben sitzen, reden über Geschäftliches oder gehen in die Karaokebar und betrinken sich.
Ich begriff schnell, wie wichtig es ist, die Einladung zu einem Schnaps auf keinen Fall abzulehnen – sonst war man unten durch. Ich lernte, bei wem ich mich prostend zu bedanken und bei wem ich mich wann zu revanchieren hatte. Jeder Schnaps musste auf ex getrunken werden. Da ein leeres Glas als eine Unhöflichkeit gegenüber dem Gast gilt, wurde rasch wieder aufgefüllt. Ein Teufelskreis, der Alkoholleichen produziert. Der Chef am Tisch zahlte immer das Essen. Ich wurde eingeladen und musste mich später revanchieren. Hätte ich das nicht getan, wäre die Beziehung damit zu Ende gewesen.
Geschmatzt wird, was das Zeug hält. Überhaupt stehen Geräusche, die aus dem Mund kommen können, hoch im Kurs. Rülpsen, Schlürfen, Rotzen, Knochenspucken und Mit-vollem-Mund-Reden sind völlig normal. Für die Chinesen zeigt man so, dass man sich wohl fühlt. Jeder soll hören, wie sehr es schmeckt und wie viel man verdrückt. Am liebsten wird in rauen Mengen bestellt. Denn auf gar keinen Fall soll man den Eindruck haben, der Gastgeber sei geizig oder habe keine Freude an der Völlerei. Dass die Hälfte der riesigen Portionen im Müll landet, spielt keine Rolle. Ein Bewusstsein für Verschwendung gibt es in China nicht, schon gar nicht in den höheren Kreisen, wo es immer darum geht, zu zeigen: Wir können es uns leisten. Eine Familie wie die Geissens würde in China bei niemandem ein Fremdschämen erzeugen. Das, was wir in der westlichen Welt Dekadenz nennen, gibt es in China schon deshalb nicht, weil Protz nicht wie in unseren Breitengraden geächtet, sondern bewundert wird. Verachtet oder verspottet wird nicht der, der hat und auf den Putz haut, sondern der, der hat, es aber nicht zeigt.
Dass den Chinesen jedes Problembewusstsein für ihr umweltzerstörendes und menschenverachtendes Verhalten fehlt, ist das Ergebnis der gesellschaftlichen Orientierungslosigkeit, die nicht zuletzt darin gründet, dass die Politik den kommunistischen Weg preist, in Wahrheit aber den amerikanischen Way of Life kopiert und dabei pervertiert. Die besondere Tragik ist, dass den Chinesen jedes Gespür für den eigenen Verfall abgeht.
Insofern bin ich während meiner Drachenjahre selbst zum Chinesen geworden. In meiner Gier habe ich nicht gerafft, selbst Teil dieser extrem egoistischen Gesellschaft geworden zu sein, die das Geldscheffeln zum einzig wahren Lebensinhalt erklärt hat. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern eine Erklärung für das, was noch folgen wird. Ich will kein Mitleid. Aber Verständnis wäre schön.