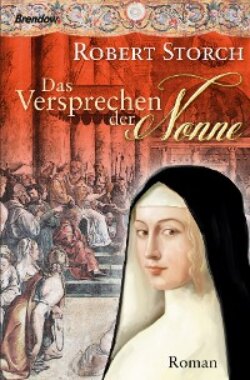Читать книгу Das Versprechen der Nonne - Robert Storch - Страница 8
Winter 3. KAPITEL
ОглавлениеMit jedem Baum, den Gerold auf dem Weg zum Grafenhof passierte, schlug sein Herz schneller. Er senkte den Blick, legte die Hände aneinander und murmelte Worte der Kirchensprache. Er verstand sie nicht, jedoch hoffte er, sie würden ihm bei dieser Prüfung helfen. „Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum.“ Gerold sah auf. Hundert Schritte vor ihm erblickte er das Licht am Ende des Waldes. „Adva…“ Er holte tief Luft. „Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua …“ Unter seinem linken Fuß knackte es. Er zuckte zusammen. Es war nur ein Zweig, beruhigte er sich. Nur ein Zweig. Er legte die zittrigen Hände aneinander. Er wollte die Kirchenformel weitersprechen, doch ihm fielen keine Worte mehr ein.
Angst.
Gerold schämte sich. Bevor Wulfhardt den Grafenhof heimgesucht hatte, hatte er nicht gewusst, was Angst war. Dann hatte Wulfhardt ihn in das Verlies gesperrt, ein Krug abgestandenes Wasser war seine einzige Gesellschaft gewesen. Die Schreie der Menschen, die im Großen Saal verbrannten, hatten ihm in den Ohren geklungen. Er hatte Adelheids hohes Kreischen gehört. Auch sie, seine Angebetete, hatte er im Stich gelassen.
Er hatte dort unten gesessen, hatte aber nichts tun können. Das war am schlimmsten gewesen. Aber dann − vielleicht nach zwei Tagen – bemerkte er, dass an einer Stelle durch die hölzerne Falltür ein kräftiger Lichtstrahl drang. Er kniff die Augen zusammen: Das Holz war dort ein wenig abgesplittert. Er kratzte Erde von den Wänden, baute damit einen Hügel und stellte den Krug darauf. Auf dem Krug hin- und herbalancierend, bekam er immer wieder das Holz der Falltür zu fassen, ab und an riss er einen Holzsplitter aus der Falltür heraus. Selbst als es dunkel wurde, machte er weiter. Als es wieder hell wurde, passte sein Arm durch das Loch. Mit der einen Hand zog er sich an der Falltür nach oben, mit der anderen griff er nach draußen. Ganz lang musste er seinen Arm machen, bis er endlich den Riegel zu fassen bekam und ihn zurückschieben konnte. Er hob die Falltür an und traute seinen Augen nicht: Vor ihm stand ein weißes Reh. Rote Augen, gekrönt von weißen Wimpern, sahen ihn ruhig an. Gerold war, als hätte das Reh die ganze Zeit dort oben gewartet. Mit einer Stange seines Geweihs schob das Reh ihm das Seil hin. Dann trabte es davon.
Ich träume, dachte er. Oder bin ich im Himmel?
Er stieß die Falltür auf, fasste das Seil und zog sich hinaus.
Hätte er gewusst, welcher Anblick ihn dort oben erwartete, er wäre im Verlies geblieben: seine Mutter, die Haare versengt, die Haut verbrannt, nur zu erkennen an der silbern funkelnden Halskette. Sein Vater, den Pfeil in der Brust, das Blut getrocknet, darüber süßer Geruch. Wulfhardt hatte jeden ausgelöscht, mit dem Gerold seine Jugend verbracht hatte, all die Menschen, die ihn bewundert und in ihm den zukünftigen Grafen gesehen hatten. Gerold musste sich hinknien und würgen. Er gewahrte den Siegelring seines Vaters, aus Kupfer geschmiedet, auf der Platte ein Eber eingraviert, das Wappentier der Familie.
Plötzlich hörte er es, das Donnern von Hufen − wie beim Überfall. Er schreckte hoch, entdeckte seine Franziska, drei Schritte vor ihm, ergriff sie. Sein Blick, auf der Suche nach Reitern, huschte bis zum Waldrand, fand aber keine, nur das Donnern in seinen Ohren wurde lauter. Er rannte davon, in den Wald, Baumstämme flogen an ihm vorbei, immer weiter, bis er, von hohen Buchen umstanden, auf den Waldboden sank.
Als er aufwachte, wusste er nicht, wo er war und wie er dorthin gekommen war. Dann fiel es ihm wieder ein, das Donnern der Hufe. War es Wirklichkeit oder Einbildung gewesen? Am Ringfinger steckte Vaters Siegelring. Er musste ihn mitgenommen haben bei seiner Flucht.
Jetzt starrte Gerold auf den Siegelring und begann wieder mit der Kirchenformel: „Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum.“ Er blieb stehen, den Blick gesenkt, und atmete zweimal tief ein. Einen Fuß setzte er vor den anderen. „Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.“ Er hielt an, Stück für Stück hob er den Kopf. Zwischen den Baumstämmen hindurch, hinter dem Waldrand, erspähte er das mit Holzschindeln gedeckte Dach des Wohnhauses der Grafenfamilie. Seiner Familie.
„Sie sind tot. Alle sind sie tot!“
Es kribbelte in Gesicht und Händen. Er öffnete den Mund, doch es gelang ihm nicht, die Luft einzusaugen. Die Baumstämme vor ihm setzten sich in Bewegung, sie drehten sich um ihn herum.
Hufgetrappel. Leise, wie aus weiter Ferne. Es schwoll an. Die donnernden Hufe dröhnten in den Ohren.
Gerold schrie. Er wirbelte herum und rannte.
Er wusste nicht wohin. Tag um Tag streifte er durch den Wald, mal hierhin, mal dorthin. Ab und zu erblickte er das geheimnisvolle weiße Reh. Doch hielt es Abstand von ihm, so wie er Abstand hielt von den Menschen. Immer, wenn er den Waldrand erreichte, wenn er in einigen hundert Schritten Entfernung ein Weizenfeld erahnte, begann sein Herz zu rasen.
Die Nächte waren noch schlimmer: Er lag auf dem Waldboden, die Hand am Griff der Franziska, seine Finger und Zehen froren ein, Blätter legten sich auf ihn wie auf sterbende Maiglöckchen und Farne, begleitet vom dumpfen Ruf des Uhus.
Woche um Woche wurden die Nächte kälter.
Eines Tages kam der Hunger. Viel zu lange hatte er sich nicht ums Essen gekümmert, hatte nur hier und da eine Beere gepflückt oder eine am Boden liegende Nuss aufgelesen. Doch jetzt, mit einem Mal, fühlte er sich schwach wie nach einem Fieber. Er durchpflügte das Unterholz und stopfte alles Essbare in sich hinein. Schließlich erlegte er einen Keiler mit seiner Franziska. Sein Fleisch stillte Gerolds Hunger.
Je kürzer die Tage wurden, umso mehr Blätter verloren die Bäume. Er wusste, dass er den Tod seiner Familie rächen musste, dass er um seine Grafschaft kämpfen musste. Doch allein der Gedanke daran ließ die schaurigen Bilder vom Überfall wieder in ihm aufsteigen. Er war unfähig, an seine Pflichten zu denken. Vor jeder Siedlung schreckte Gerold zurück, der Wald hielt ihn gefangen. Er konnte hier leben, denn er hatte früher viele Tage im Wald verbracht, hatte Hunger ertragen und Kälte getrotzt. Ein Griff an sein Wehrgehänge verriet ihm, dass er alles hatte, was er hier brauchte: Schwert und Dolch steckten in den Scheiden, die Franziska in der Schlaufe. Die Franziska hatte er einst von der Wand des Großen Saales geschnappt, wo sie als Erinnerungsstück gehangen hatte. Obwohl Vater ihm hatte ausreden wollen, mit dieser altmodischen Waffe umzugehen, hatte er tagaus, tagein geübt. Als er mit ihr aus zwanzig Schritten einen Ast vom Baum hatte schlagen können, war auch Vater beeindruckt gewesen.
Irgendwann begann die Einsamkeit ihn zu quälen. Er legte die Wange an die Rinde einer Eiche. Die Rinde war rau und kalt, doch meinte er, auch Wärme zu spüren, die aus dem Inneren des Stammes nach außen drang. Er umarmte den Stamm und erzählte der Eiche von seiner Schwester: wie er sie gefüttert hatte, wie er ihr die ersten Schritte beigebracht hatte, wie sie seine größte Bewunderin gewesen war, wenn er sich in einem Zweikampf geschlagen hatte. Der Eiche schienen seine Worte egal zu sein. Eine Böe rauschte durch ihre Krone und riss gelbe Blätter von den Ästen. Sie rieselten auf ihn herab, begleitet von der immer gleichen Melodie eines Waldlaubsängers. Langsam setzten die hohen, spitzen Töne ein. Sie verschnellerten sich rasch, um dann wieder abzufallen.
Plötzlich sprang das weiße Reh an ihm vorbei. Fast gleichzeitig berührten seine Vorder- und Hinterläufe den Boden, mit einem Sprung schaffte es vier Schritte.
Ein Wolf jagte ihm hinterher.
Gerold nahm die Verfolgung auf, zog die Franziska aus der Schlaufe und schleuderte sie. Am Abend briet Gerold Wolfsfleisch über seinem Feuer.
Von nun an folgte das weiße Reh − dem er den Namen „Flocke“ gab − seinen Spuren durch den Wald, wahrscheinlich fühlte es sich sicherer in seiner Nähe. Und abends, wenn Gerold sich am Stamm einer Buche niederlegte, rollte es sich neben ihm ein, und er erzählte Flocke von früher.
Er erzählte von den Honigplätzchen, die er oft aus der Küche des Grafenhofes stibitzt hatte. Und er erzählte von der Tafel am Abend im Großen Saal, dem Höhepunkt eines jeden Tages. Er hatte an der Stirnseite zwischen seinen Eltern sitzen dürfen, nachdem Mutter ihm den Schmutz aus dem Gesicht gewischt hatte. Eines Abends, als er noch keine zehn Jahre gezählt hatte, war ein fahrender Sänger zu Gast gewesen. Er hatte, begleitet von einer Fidel, das Epos von den Nibelungen vorgetragen, eine Geschichte aus alter Zeit. Viele Abende hatte Gerold an seinen Lippen gehangen, sich jedes Wort gemerkt und bald selbst Geschichten erfunden, natürlich mit sich selbst in der Rolle des Helden, der nie einen Kampf verlor, die Schwachen beschützte − und Adelheids Herz eroberte.
Auf dem Pfad zu ihrem Herzen war er damals tatsächlich weit vorangeschritten: Er pflückte den süß duftenden Goldwurz, verzierte ihn mit einigen Kuckucksblumen und umband sie mit einer roten Schleife. Des Nachts schlich er zu ihrer Kammer, überreichte ihr den Strauß und gestand sogleich, sie habe die schönsten Augen, in die er jemals geblickt habe. Ihre Wangen färbten sich rot, sie hielt die Hand vor den Mund und kicherte. Obgleich sie nur „danke“ hauchte und die Tür verschloss, wähnte Gerold den Augenblick nicht mehr fern, an dem sie ihm die Gunst eines Kusses gewähren würde.
Doch ein Tag hatte alles geändert.
Wulfhardt hatte alles geändert.
Gerold sprang auf. Längst war die Sonne untergegangen, der Buchenstamm vor ihm nur ein Schatten. Er schrie den Stamm an: „Warum meine Familie?“
Flocke sprang auf und davon.
Kurz vor Wulfhardts Überfall war Gerold selbst sterbenskrank darniedergelegen. Hat Walburga ihn nur geheilt, damit er das miterlebte? Er hackte mit der Franziska in den Stamm, immer wieder. Alle Strafen, die ihm in den Sinn kamen, beschwor er auf Wulfhardt herab, bis sein Arm schmerzte. Keuchend ließ er sich nieder.
Wulfhardt.
Fast nichts wusste er über ihn, obwohl er am Grafenhof gewohnt und an der Abendtafel wenige Stühle von ihm entfernt gegessen hatte. Ab und an hatte er sich am Tischgespräch beteiligt, doch an kein einziges seiner Worte konnte er sich erinnern. Wahrscheinlich, so erkannte Gerold, hatte er ihn einfach nicht beachtet. Schon jener missmutige Gesichtsausdruck, mit dem er für gewöhnlich über den Grafenhof gestiefelt war, hatte ihn abgestoßen. Wie viel schöner da die Erinnerungen waren an Vater, an die liebe Mutter, an seine wunderbare Schwester, an die schöne Adelheid, ja selbst an den Priester, der ihm mit viel Geduld die Kirchensprache beigebracht hatte. Mit jedem anderen Knecht am Grafenhof hatte er seine Zeit lieber verbracht als mit Wulfhardt.
Was hatte Wulfhardt dazu getrieben, seine Familie zu morden? Ja, da waren die Stockschläge nach einer Schlacht gegen die Baiern gewesen, ein alter Waffenknecht hatte ihm davon berichtet: Es war Wulfhardts erste Schlacht gewesen, und deshalb hatte ihm sein Vater befohlen, sich am Rande zu halten. Doch übereifrig hatte Wulfhardt sich ins Getümmel geworfen und alsbald von feindlichen Kämpfern umringt gesehen. Schließlich hatte ihn sein Bruder − Gerolds Vater − aus höchster Not gerettet. Vielleicht trug er seitdem Groll in sich? Er musste ein guter Mime sein, dass er den Hass all die Jahre vor seinem Bruder verborgen gehalten hatte, während es in ihm gebrodelt hatte wie in einem Kessel, randvoll gefüllt mit siedend heißem Wasser. Nur einmal war diesem Kessel heißer Wasserdampf entwichen − es war wenige Tage vor dem Überfall gewesen: Nach Gerolds Heilung durch Walburga hatte Graf Gebhard in seiner Grafschaft die Oberhoheit des Papstes anerkennen wollen. Dies hatte Wulfhardt abgelehnt, vor allem, weil er von seinen Pfründen nichts nach Rom abgeben wollte. Bei einem Abendgelage hatten sich die Brüder über diese Angelegenheit ereifert, bis Wulfhardt mit gotteslästerlichen Flüchen auf den Lippen aus dem Saal gestürmt war. Zwei Tage später hatte er den Grafenhof verlassen, um, wie er behauptet hatte, Pfarreien in der Grafschaft zu besuchen. Mit bewaffneten Reitern war er zurückgekehrt.
Als Schnee den Waldboden bestäubte, fand Gerold eine Höhle. Genauer: Flocke fand sie. Das Reh ging hinter ein Gebüsch und verschwand plötzlich, hatte sich durch den Spalt eines mit Moos bewachsenen Felsens in die Höhle gezwängt, ein niedriges Gewölbe, in dem Gerold nur gebückt gehen konnte. Aber hier war es warm, wenn er ein Feuer schürte, während draußen die jungen Fichten unter Schneebergen verschwanden und in den Bächen Eisplatten trieben. Nur zum Wasserholen und zum Wasserlassen ging er hinaus.
Dann, gegen Ende des überlangen Winters, kam der Hunger. Das Wolfs- und Eberfleisch war aufgebraucht, die Beeren sowieso, und unter dem Schnee fand er nichts Essbares mehr. Immer weiter trieb es ihn von der Höhle weg auf der Suche nach Beute. Nur einmal hatte er Glück: Eine Spur im Schnee führte ihn und seine Franziska zu einem Hasen. Doch von seinem Fleisch konnte er nur einige Tage zehren. Rastlos streunte er durch den Wald, es fiel immer mehr Schnee, das Wild schien sich vor ihm verkrochen zu haben.
Gerold merkte: Er hatte seine Kräfte überschätzt. Und er hatte vergessen, ausreichend Vorräte für den Winter anzulegen.
Er trottete zu seinem liebsten Ort im Wald: Aus sieben Quellen, die in einem Halbkreis angeordnet waren, sprudelte Wasser aus dem Waldboden hervor und sammelte sich in einem Teich, der selbst jetzt, im tiefsten Winter, nicht zufror. Er sah in verschneite Baumkronen, neben sich entdeckte er einen Abdruck im Schnee. Er stemmte die Hände auf die Knie und sah genauer hin: Neuschnee hatte die einst tiefen Spuren fast verdeckt, doch es waren eindeutig Spuren von riesigen Pfoten. Gerold starrte sie an. Ein Bär, erkannte er. Ein Bär, der aus der Winterruhe erwacht war. Tage musste es her sein, dass er hier gewesen war, aber Gerold wusste: Der Bär blieb hier in seinem Revier, er musste nur auf ihn warten.
Der Schnee schmolz, und Leberblümchen kündigten den Frühling an, bis es eines Morgens passierte: frische Spuren! Während Gerold sich, vom Hunger gepeinigt, in der Höhle hin- und hergewälzt hatte, war der Bär um die Höhle gestreunt. Er griff den Speer, den er aus Buchenholz geschnitzt hatte, steckte die Franziska, Schwert und Dolch in das Wehrgehänge und folgte den tiefen Spuren, bis er eine Lichtung erreichte, wo der Bär die Rinde vom Stamm einer Eiche kratzte.
Der Frühnebel stieg vom feuchten Boden auf und verfing sich in den Baumkronen. Die ersten Sonnenstrahlen, die auf der Lichtung durch den Nebel drangen, ließen den Frühling erahnen. Gerold legte die Handkante an die Stirn: Der Bär hatte braunes Fell, der Rücken war breit wie ein Heuwagen.
Dafür ist er nicht so wendig, redete Gerold sich ein. Er musste sich nur an ihn heranschleichen. Wie um ihn zur Eile zu drängen, grummelte sein Magen.
Er brauchte das Bärenfleisch. Jetzt.
Er setzte Fuß vor Fuß. Jetzt nur nicht auf einen Ast treten.
Er stand zehn Schritte hinter ihm, da stellte der Bär die halbrunden Ohren auf. Schwerfällig tapste er auf mächtigen Pranken zu ihm herum, schnaubte, eine weiße Atemwolke dampfte aus dem Maul, er fixierte Gerold mit schwarzen Äuglein.
Ein eisiger Finger legte sich auf Gerolds Halswirbel, wie damals, mit vierzehn Jahren, als er seinen ersten Auerochsen erlegt hatte. Und doch war jetzt alles anders: Heute kämpfte er ums Überleben, damals hatte er Ansehen errungen, zur Belohnung das erste Schwert aus den Händen seines Vaters erhalten.
Sie standen sich gegenüber, keiner bewegte sich. Der Bär legte die Ohren zurück, er zog die Lefzen hoch, die Eckzähne funkelten Gerold entgegen. Ein Muskelberg türmte sich auf den Schultern. Gerolds leerer Magen gab das Signal zum Angriff: Er schleuderte die Franziska. Im letzten Augenblick zuckte der Kopf des Bären aus der Flugbahn, das Beil grub sich hinter ihm in den Waldboden, der Bär stieß wütendes Gebrüll aus.
Gerold sprang auf ihn zu, den Speer voran.
Der Bär stellte sich auf die Hinterbeine, er knurrte tief und zeigte ihm die fingerlangen Krallen, die aus den behaarten Ballen hervorblitzten. Er überragte Gerold um mehrere Köpfe, doch für die Flucht war es zu spät. Gerold flog auf ihn zu. Er zielte mit der Speerspitze nach oben, er musste den Bären in die Gurgel treffen.
Mit den Vorderpranken schlug der Bär den Speer weg, als würde eine lästige Fliege vor seinem Gesicht schwirren.
Die Wucht warf Gerold auf den feuchten Boden, er rollte zur Seite, überall klebten feuchte Blätter am löchrigen Hemd, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er rappelte sich auf, schützend hielt er den Speer vor das Gesicht.
Wer war der Jäger, wer der Gejagte?
Der Bär stürmte, nein, er rollte auf Gerold zu wie ein riesiges Gebirge. Die Zähne zielten auf seinen Hals.
Im letzten Augenblick sprang Gerold zur Seite, der Bär stürmte ins Leere. Mit einem Satz stand Gerold hinter ihm und rammte den Speer in das zottelige Fell auf dem Rücken.
Der Bär brüllte, riss sich los und rannte davon. Gerold blieb zurück, in der Hand den Speer, besudelt mit Bärenblut. Er verfolgte den Bären, der Waldboden raste unter ihm hinweg, Baumwurzeln brachen aus ihm heraus. Sein ausgemergelter Körper ächzte, Schweiß tropfte ihm von der Stirn, dann – endlich – wurden die Schritte des Bären träger. Die Vorderpranken knickten ein, das Blut quoll aus dem Rücken, rann an der Seite hinab, tropfte auf den Boden.
Vorsicht, dachte Gerold. So sind sie am gefährlichsten!
Mit seinen letzten Bärenkräften stürzte sich das Tier auf Gerold.
Gerold sprang weg, der Bär schlug mit den Tatzen nach ihm. Gerold spürte den Windhauch im Gesicht. Blind stach er mit dem Speer zur Seite, er hatte Glück: Wieder bohrte er sich ins Bärenfleisch, wieder brüllte der Bär, dieses Mal brachte er die Äste zum Zittern. Dann wurde das Brüllen zu einem Röcheln, er fiel auf die Seite. Ein letzter Stich in die Gurgel, und seine Zuckungen erstarben.
Gerold ließ sich auf den Waldboden sinken, langsam beruhigte sich sein Atem.
Mit seinen letzten Kräften zog er den Bär zur Höhle, schürte ein Feuer, schnitt mit dem Dolch ein mächtiges Stück von der Schulter ab, briet es und schlang es herunter. Er schlief. Als er aufwachte, fühlte er sich wie neugeboren. „Ich habe einen Bären erlegt!“, rief er, zwischen den Baumstämmen tanzend. „Ich habe ihn besiegt! Einen Bären, groß wie zwei Ochsen!“
Er schlenderte durch den Wald zu seinem Lieblingsplatz: Vor ihm gluckerte das Wasser von sieben Quellen aus dem Waldboden hervor und floss zu dem in der Sonne glitzernden Teich zusammen. Von dort strudelte es leise plätschernd den Hang hinab, bis es hinter einer Biegung verschwand. Über ihm zwitscherte ein Buchfink.
Gerold trat an den Teich, sodass er sein Gesicht darin sehen konnte. Die blonde Strähne strahlte wie eh und je zwischen seinen braunen Haaren hervor, doch das Gesicht darunter hatte sich verändert in den letzten Monaten: Hager war es geworden, und ernster. Vielleicht trauriger. Der Überfall hatte ihn verändert. Seither hatte er nur Trauer, Wut und Verzweiflung gespürt. Und Hoffnungslosigkeit. Und Angst. Doch jetzt, mit gefülltem Magen, der Euphorie über seinen Sieg gegen den Bären in den Gliedern und den Sonnenstrahlen auf der Haut − da keimte in ihm zum ersten Mal wieder Hoffnung auf. Zum ersten Mal seit dem Überfall schlich sich der Gedanke in seinen Kopf, dass es wieder werden könnte wie früher. Dass er nicht machtlos war, sondern stark. Konnte jemand, der einen Bären erlegte, es nicht mit jedem aufnehmen?
Gerold starrte auf sein Ebenbild im Teich, doch vor seinem inneren Auge lief der Überfall ab: der Pfeil in der Brust seines Vaters, der Reiter hinter seiner Schwester, seine Machtlosigkeit im Verlies. Bisher hatten diese Erinnerungen ihn traurig und wütend werden lassen, jetzt spornten sie ihn an. Entschlossen verjagte er die Erinnerungen und krallte die Hand fest um den Griff der Franziska. Er würde seine Familie rächen, würde den Mörder seiner Familie zur Strecke bringen. Und er würde Graf sein, wie es seine Bestimmung war. Noch heute würde er das Werk beginnen, nahm er sich vor. Er würde an den Grafenhof zurückkehren. Er hielt inne. Nein, unmöglich! Allein der Gedanke an eine Rückkehr zum Grafenhof ließ sein Herz vor Panik schneller schlagen.
Ein Glitzern an seinem Finger lenkte den Blick auf den Siegelring, den einst sein Vater getragen hatte. Er fragte sich, was Vater sagen würde, sähe er ihn jetzt. Wie er sich seit einem halben Jahr im Wald versteckte. Würden seine Augen immer noch voller Stolz auf ihm ruhen? Er hielt den Siegelring in die Sonne. Nein, er konnte sich nicht länger verstecken. Er musste sein Erbe einfordern. Das wäre Vaters Wille.
Er zog den Dolch aus der Scheide und wanderte, gemächlich einen Fuß vor den anderen setzend, zum Waldrand, auf den Grafenhof zu, vor dem er in den letzten Monaten immer geflohen war. War der Grafenhof noch verwaist, nachdem alle Bewohner ermordet worden waren? Oder waren wieder Menschen in die Wirtschaftsgebäude eingezogen, vielleicht sogar in das Wohnhaus der Grafenfamilie? Auf einer Anhöhe endete der Wald, mit dem Rücken zum Grafenhof lehnte er sich gegen den Stamm einer Birke, das Herz raste. Flocke trabte heran.
„Soll ich es tun?“, fragte Gerold ihn.
Der Wind trug aufgeregte Stimmen vom Grafenhof zu ihm herauf.
Flocke entdeckte ein Hexenkraut und trabte dorthin.
Tief schnaufte Gerold durch. Er klemmte den Dolch zwischen die Zähne, fasste den Birkenast über sich und zog sich hoch, dann weiter zum nächsten Ast und wieder zum nächsten, bis er sich, zehn Schritte über dem Boden, setzte. Sich mit beiden Händen an den Ast klammernd, drehte er die Augen zum Grafenhof. Auf einem schwarzen Pferd ritt ein Mann hinein. Er trug einen schwarzen Mantel, der von einer goldenen Spange geschlossen wurde. Die Waffenknechte und Bediensteten verneigten sich vor ihm.
Vor ihm wurde die goldene Lanze des Grafen hergetragen.
Wulfhardt!
Für einen Augenblick wich jede Spannung aus Gerolds Muskeln, der Dolch rutschte aus dem Mund, die Hände lösten sich vom Ast. Hastig versuchte er, den Ast wieder zu fassen − zu spät: Der Waldboden flog auf ihn zu. Das Letzte, was Gerold wahrnahm, war sein eigener spitzer Schrei.