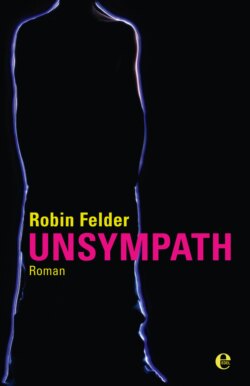Читать книгу Unsympath - Robin Felder - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 SCHAULUSTIGER
ОглавлениеWenn ich noch langsamer gehe, könnte es sein, dass mich ein Passant anspricht und fragt, ob er mir helfen kann. Oder ob er einen Notarzt verständigen soll. Hoffentlich passiert das nicht. Ich muss sonst höflich ›Nein danke‹ sagen und unnötig Energie verschwenden, wo ich ihm doch viel lieber ein freundliches ›Verpiss dich!‹ entgegnen möchte. Ich schlendere in Richtung Stadtmitte, beide Hände tief in meinen vorderen Hosentaschen versenkt. Es ist ein heißer Juliabend, kurz vor sechs. Ein leichter Schweißfilm liegt auf meiner Haut. Eilig hab ich’s nicht. Trotzdem fühle ich mich seltsam gehetzt. Taschencheck. Geldbeutel – kurzer Griff an rechte Gesäßtasche. Schlüssel – Griff an rechte vordere Hosentasche. Handy – spür ich so, linke vordere Hosentasche. Alles da.
Ich gehe an einem Starbucks-Coffeeshop vorbei. Ein Gebäude weiter dröhnt Rihannas »Umbrella« basslastig aus dem Palmers-Dessousladen. Die beiden alten Weiber, die mir vor dem Juwelier daneben im typischen Pinguingang entgegenkommen, tragen die für Rentnerinnen ab 70 gesetzlich vorgeschriebene Einheitsdauerwelle. Einmal in kastanien-rostrot und einmal in fleckig-grau natur. Stämmige Statur, gedrungen, klein, angestrengter Blick. Atmen durch geöffneten Mund. Dabei die Backen aufblähen. Ich schnappe einen Gesprächsfetzen auf: »Aber verrate das noch niemandem. Das ist topsecret!« Gesprochen: Dopp siekräht. Höchste Geheimhaltungsstufe. Wird bestimmt mörderwichtig sein. Vielleicht geht’s um Plastikhüftgelenke. Sind ja derzeit ziemlich gefragt. Noch nie waren mehr Krücken unterwegs. Oder es handelt sich um Zahnersatz. Oder einen Schlaganfall im Bekanntenkreis. Aber sonst?
Wie ein Zelt hängt das dunkelblaue Paillettenoberteil der einen über den beiden riesigen Ausbeulungen darunter und betont die Angelegenheit nur umso mehr. Die Dinger müssen im Laufe der Jahre wachsen, denke ich mir. Es lässt sich tatsächlich nicht leugnen, die Anzahl Dinosaurier-busiger Seniorinnen steht in keinerlei Verhältnis zur Anzahl vergleichbar proportionierter junger Frauen. Suspekt. Ich sehe wieder weg. Höre sie noch was mit »Reha« und »sechs Wochen« sagen.
Volltreffer.
Dumpfer weiblicher Intimgeruch, vermischt mit Old Spice aus der Literflasche des kürzlich verstorbenen Gatten, liegt in der Luft. Instinktiv atme ich flach, bis der Geruch, und damit ihre Existenz, verpufft ist.
Ich gehe weiter die Straße entlang, laufe vorbei an einem San-Francisco-Coffeeshop. Gesteckt voll. Daneben eine kleine Boutique. Niemand drin. Die Art von Miniladen, dessen wirtschaftliche Existenz sich nur mit Abschreibung, Geldwäsche oder Gönnerschaft erklären lässt. Nicht mit Rentabilität. Auf halber Strecke, zwischen einem Puma-Store und einer Segafredo-Coffee-Filiale kommt mir ein Pärchen entgegen. Beide Brillenträger. Ist der eine Brillenträger, trägt der Partner zu 80 Prozent auch eine Brille. Weiter. Ich bahne mir einen Weg durch die Wogen. Wogen aus Menschen. Eine etwa 25-Jährige, enges T-Shirt, stramm, sieht mich nett an. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ist schon wieder weg. Sofort sehe ich rechts in das erste verfügbare Schaufenster und nutze die Spiegelung, um zu prüfen, ob alles okay an mir ist. Geht so.
Ich kratze mich am Oberarm, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Weiter. More & More. Danach ein Schuhladen. Die Sonne teilt die Straße mittig. Ich gehe auf der schattigen Seite. Vorbei an einer Selbstbedienungsbäckerei mit »Coffee To Go«-Schild in der Auslage. »Coffee To Go« muss ich mir notieren. Möglicher Songtitel. Dann eine Douglas-Parfümerie. Riesiges Flakon im Fenster. Als Nächstes eine Auslage, vor der das Abstellen von Fahrrädern verboten ist, vor der zwei Fahrräder stehen. Direkt daneben ein Dönerladen. Zur Hälfte abgearbeiteter Lammfleischspieß, angelaufene Scheiben. Gammelig. Aus dem Radio dröhnt Don Henleys »Boys Of Summer«. Genial, aber gibt mir nichts. Früher wurden nicht so viele Oldies gespielt. Liegt womöglich daran, dass es noch nicht so viele gab. Blödsinn.
Ich zähle von einundfünfzig rückwärts. Nur die ungeraden Zahlen. Body-Shop, Ralph Lauren, 41, 39, 37, mehr Gebäude, noch mehr Fensteraugen, Strenesse-Store, ein Promi-Friseur, Schild: »Haarschnitt vorbehalten!«, 29, 27, roter Teppich davor, dann noch irgendein Schuhladen, ich habe Schuhgröße 46½, nicht so wichtig, 17, 15, 13. Ein RedCoffee-Shop, durch die offene Tür riecht es nach gerösteten Kaffeebohnen. Noch eine Boutique. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, mittenrein gepfercht eine Kirche. Schnörkelig. Gotik, Barock, Romantik? Eine Ahnung? Nicht im Ansatz. Weiter. Ein weiterer Gang durch einen weiteren Tag.
Ein junges Mädchen, halb so alt wie ich, H&M-Tüte, die sie in der Ellbogenbeuge trägt, tippt was in ihr Handy und nippt dabei an einer Plastikflasche mit einer roten Flüssigkeit. Das ist so üblich. Je niedriger die soziale Herkunft, desto farbiger das Getränk, das unterwegs konsumiert wird. Eine Gleichung. Gleich noch eine: Je mehr ASI, desto mehr SMS.
Ihre mittrampelnde Freundin ist nur ihre Freundin, weil die deutlich schlechter aussieht. Des Kontrastes wegen.
Sie hat ihre überdimensionierte Sonnenbrille ins Haar gesteckt. Nicht gerade ein Alleinstellungsmerkmal.
Weiter weiter. Ich komme mir vor, als liefe ich durch eine Parallelwelt. Wie ein Trabant.
Vorbei an einem Meyerbeer-Coffeeshop. Das darauf folgende Reformhausschaufenster informiert mich über eine neue Generation von Fencheltee. Trink ich am liebsten. Von irgendwoher versucht sich eine Mutter an der Drohung »Dann geh ich eben ohne dich, mach’s gut, Leon, Mama geht dann mal alleine heim«. Leon fällt drauf rein. Leon kommt schreiend angelaufen. Leon hat Schlupflider. Fünf Sekunden vergehen. Im Gehen. Ich schaue umher, alles an. Reize. Jeder optische Impuls.
Alles gibt mir zu denken.
»Yes, of course. No, no problem«, höre ich mich sagen.
Pluspunkte sammeln.
Ich spüre eine Hand am Ellbogen. Fass mich nicht an. Verdammt.
Ich, zu mir: ›Achtung Achtung! Dies ist keine Übung!‹
»Absolutely. No problem«, entgegne ich dem lieb dreinschauenden Touri, Nationalität ungewiss. Was Kaukasisches. Seine Augen, winzige schwarze Löcher, breiter Kopf, inselartiger Bartwuchs. Ich soll ein Foto von ihm und seiner dreiköpfigen Familie schießen. Diesem kuriosen Haufen, bestehend aus seiner Frau mit asymmetrischen Reiterhosen, seiner pubertierenden Tochter mit Spliss und einem schwammigen Bürschchen, das wahrscheinlich sein Sohn ist. Oder der seines Nachbarn. Ex und hopp. Er drückt mir eine sündhaft teure Nokia-Kamera in die Hand. Alte Schule. Noch mit Film. Es gibt eben wirklich alles. Die vier Idioten stellen sich auf. Das Urlaubsidyll. Lächeln, jaaah cheese! Käse. Ich halte die Kameralinse vor mein rechtes Auge. Fokussiere exakt so, dass nur ihre Oberkörper zu sehen sind. Und zwar bis zum Hals. Gürtellinie bis Kehlkopf. Vier T-Shirts in Reihe. Mittig und scharf. Humor mit Zündschnur. Da werden sie sich freuen, wenn sie die entwickelten Negative abholen. In irgendeinem Drugstore in Tiflis. Sieh mal, das sind wir in Munich. Wer trug gleich noch mal das grüne T-Shirt?
Ich teile mit, sie einzuzählen, damit keiner die Augen geschlossen hat. Haha. »I’ll count to four and then I shoot, okay?« Ich beginne zu zählen
eins
zwei
und drücke bei drei ab. Klick. »No really, it was a pleasure. Hope the picture is fine.« Er sagt was. Ich halte ihm die Kamera hin. Nimm. Jetzt geh schon. Ich nicke und antworte leutselig: »Yeah. You’re very welcome. Have a nice stay, good-bye.« Ich rutsche gleich aus. Ich setze meinen Weg fort. Vorbei an einem Coffee-Fellows-Shop. Weiter.
17:58
Ich schließe die Augen.
Und öffne sie wieder.
Ich schaue in den Himmel. Quellwolken. Dieses Jahr herrschen beinahe tropische Verhältnisse. Jeden Tag zwei kurze, heftige, regenwaldartige Schauer. Zehn Minuten. Im Anschluss saugt die Sonne die Feuchtigkeit ebenso schnell wieder aus dem Boden.
Pünktlich auf die Sekunde. Glockengeläut. 18 Uhr. Eine weiter entfernte Kirche setzt zusätzlich ein. Um eine Millisekunde zeitversetzt, oder zwei. Lautes Bing, leises Bong, lautes Bing, leises Bong, jeweils sechsmal. Nicht 18-mal. Da muss man schon mitdenken. Ich massiere mir die Schläfen. Alles rattert vorbei. Rechts gegenüber ein Optiker, Fielmann. Oder Apollo. Ich habe eine Kontaktlinse. Einseitig. Nur rechts. Minus 2,5 Dioptrien. Links sehe ich hundert Prozent. Bin wohl in der Pubertät zu schnell gewachsen. Das jedoch beidseitig. Schaue noch mal in den Himmel. Zwei langgezogene Kondensstreifen einer Düsenmaschine.
Was ist die Alternative?
Ein faltiger Kopf mit feuerrotem Haar gähnt mir ungeniert ins Gesicht. Mein Antwortgähnen bleibt aus. Kein Reflex. Außer dem Menschen lassen sich nur Schimpansen und Stummelschwanzmakaken vom Gähnen anstecken. Hab ich mal gelesen.
Die Luft ist sehr warm. Ich schleiche weiter. Mit höchstens einer vagen Vorstellung, wohin. Und mit noch geringerer Begeisterung als zuvor. Kurze Zeit später, gegen 18:03 Uhr, laufe ich beinah einer Sängerin über den Weg, die ich vor Jahren mal aufgenommen habe. Sie lutscht an einem Lolly, von dem nur der weiße Stiel aus ihrem Mund schaut. Kann mich nicht mehr erinnern, wie sie heißt. Irgendwas mit S. Nein P. Nein, doch S. Jetzt weiß ich’s: Mandy heißt sie. Schon der Name. Es ging damals um eine housige Dancenummer, für die ich Demo-Vocals brauchte. Ihre Stimme war nicht so besonders, aber wie alle Minderbegabten war sie äußerst überzeugt von sich. Versagertum und Selbstüberschätzung liegen dicht beieinander. Ich bemerke sie rechtzeitig und tue, als würde ich sie nicht sehen. Und zwar ganz offensichtlich. Hoffentlich bekommt sie’s mit. Ich möchte auf keinen Fall in ein Gespräch mit ihr verwickelt werden. Was interessiert mich ihr Geschwätz. Und schlimmer noch, ich müsste Bussi-Bussi machen. Diese sinnlose Zwangshandlung zur Vortäuschung von Vertrautheit. Egal auf welches soziale Event ich eingeladen werde – Geburtstag, Hochzeit, Beerdigung, alles das Gleiche –, jedes Mal fürchte ich mich schon vor diesem Wange-an-Wange-Gedrücke. Dabei halte ich immer die Luft an. Aus aktiven wie aus passiven Gründen. Ich will niemanden riechen und möchte auch nicht gerochen werden. Mit wem ist man denn schon so eng, dass es diesen Vorgang rechtfertigt!
Aus irgendeinem perversen Grund ist die Stadt heute voll von bekannten Gesichtern. Ist das zu fassen? Von wegen Millionenstadt. Mir wird ganz schlecht. Von rechts nähert sich Lenny (schon der Name), mit dem ich erst vergangene Woche geschäftlich telefonieren musste. Da dieses Gespräch noch frisch ist, habe ich keine Ahnung, was ich mit ihm reden soll, ohne mich zu wiederholen. Er hat nicht den Hauch einer Ausstrahlung. Leider hat er mich als Erster erspäht und kommt mir mit dem demonstrativen Wegschauen zuvor. Es gelingt ihm aber nicht so offensiv wie mir gerade eben bei Mandy, stelle ich befriedigt fest. Mein Kopfabwenden war – irgendwie runder. Verächtlicher. Außerdem hat er gezögert.
Einen ganz kurzen Augenblick lang entsteht nun zwischen Lenny, Mandy und mir ein magisches Dreieck gegenseitiger Ignoranz. Mit mir in der Mitte. Bis ich bemerke, dass ein Dreieck gar keine Mitte hat.
Als die beiden weg sind, blicke ich verloren auf den vor mir liegenden Platz. Ich bleibe kurz stehen und nehme all die kreuz und quer laufenden Menschen wahr. Wieso sind die auch alle da? Diese Wilden. Das ist der Durchschnitt, schätze ich. Durchschnitt kann so wehtun. Oder ist das nur ein Maskenball? Ein absurder Scherz?
Statistisch gesehen müsste alles dabei sein. An Denkbarem, an Machbarem, an Vorhandenem. Plus minus gut bös er sie rechts links Jäger Beute vorher nachher oben unten homo hetero schwarz weiß Täter Opfer groß klein grob fein Vergangenheit Zukunft normal pervers. Nur, wer ist was? Normal! Was war normal noch mal?
Mit einem nicht zu unterdrückenden Schaudern wird mir schlagartig klar, was für eine entsetzliche Sache der Sommer ist. Dermatologische Unreinheiten, verkrümmte Körperhaltung, offengelegt statt stillgelegt. Wieso kann ich das nicht ignorieren? Die allgemeine Selbstwahrnehmung scheint eine vollkommen andere zu sein als das, was man traurige Wahrheit nennt. Ich glaube, das muss schön sein.
Durch. Ich halte eine Krisensitzung mit mir selbst. Krise, was für eine Krise? Flucht ist keine Option. Niemand zwingt mich. Einfach durch. Ich laufe den Leuten aus dem Weg, in den Weg, aus dem Weg, in den Weg, um ihnen auszuweichen. Bis ich auf der Rolltreppe stehe, die in den ersten Stock der größten Buchhandlung der Stadt führt. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber, alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay.
Ich überblicke die riesige erste Etage und steuere zielstrebig einen Stapel mit Neuerscheinungen an. Ich kann nur in große Läden gehen. Tante-Emma-Butzen sind mir zu persönlich. Ein Buch, in dem der Preis liebevoll per Hand mit Bleistift auf Seite drei rechts unten eingetragen steht, würde ich niemals kaufen. Außerdem möchte ich nicht sofort von einer Verkäuferin angesprochen werden. Eine abgerungene Entgegnung wie »Danke, ich seh mich nur um« ist an Unnötigkeit kaum zu überbieten.
Ich nehme mir ein Buch und setze mich an den äußeren linken Rand einer Leseinsel. In letzter Zeit bin ich fast täglich hier, um abwechselnd zu lesen und Menschen zu beobachten. Ich muss aufpassen, dass dieses Rumhängen nicht zur Gewohnheit wird, zu einem zwanghaften Ritual als Sinnbild meiner Orientierungslosigkeit. ›Rumhängen‹ ist seit über einem halben Jahr meine bevorzugte Beschäftigung.
Neben mich setzt sich ein vielleicht achtzehnjähriges Mädchen. Ich spüre ihre Körperwärme. Sie schlägt die Beine auf die Art übereinander, von der man Krampfadern kriegt.
Ohne dass sie es bemerkt, mustere ich sie mit minimal gedrehtem Kopf aus meinen Augenwinkeln und arbeite meine Beurteilungsparameter der Reihe nach ab: Augen, Gesicht, Haut, Haare, Titten, Gesamtphysiognomie, Kleidung. Alles ansehnlich. Als ich die drei Bücher sehe, die sie der Reihe nach durchblättert, drei Liebesschnulzen mit knallbunten Covern und Titeln wie »Denn ich vermisse dich« und, was?, »Der Schluckauf der Begierde«, nein, »Der Ruf der Begierde«, sehe ich sie nicht mehr an. Bis sie wenig später aufsteht und ich ihren Arsch begutachten kann. Klein. Man kann gar keine Meinung zu ihm haben. Fast nicht vorhanden. Wie ihr verdammter Intellekt.
Die Klimaanlage ist zu stark eingestellt. Es ist so eisig, dass die Atemluft, die aus den Mündern und Nasen dringt, dampft. Ein Großteil der Verkäufer läuft in Poloshirts oder kurzärmligen Hemden, aber mit Schal oder übergehängter Wollweste rum.
Von meinem Platz aus habe ich einen hervorragenden Blick auf die Treppe, die zu den Kassen und zum Ausgang führt. Der Querschnitt der zahllosen Kunden bestätigt: Magersucht und Fettleibigkeit sind die bevorzugten Varianten des allgemeinen Erscheinungsbildes. Die Gesellschaft ist im Lot. Zahllose abgetakelte Fressbrecher mit dunkel umrandeten Augen und gierige Allesfresser. Ich will mich wieder meinem Buch zuwenden, da bemerke ich einen und auf der höher gelegenen Sitzempore noch einen Typen, die ebenso wie ich regelmäßig hier abhängen. Wenn man sich gegenseitig zufällig sieht und erkennt, schaut man sofort weg. Ist ein bisschen peinlich einzugestehen, dass man hier genauso nutzlos rumlungert. Man hat ja schließlich noch was vor im Leben. Ich eigentlich nicht.
Der eine hat die Augen geschlossen, sein Kopf sinkt ihm auf die Brust. Der andere, oh, er schaut her. Ich sehe weg.
Der senil wirkende Kinderschänder mit kariertem Seidenhalstuch und Ölhaar (zurückgekämmt, schwarz gefärbt, an den Wurzeln grau), der jetzt neben mir Platz genommen hat, spricht so laut in sein Handy, dass alle ringsherum peinlich berührt schauen und immer wieder in sich hinein mit dem Kopf schütteln. Manchen ist es nicht zu billig, sich untereinander durch verbrüdernde Blicke gegen den Störenfried zu solidarisieren. Ich hingegen verfolge das Gespräch mit gespannter Aufmerksamkeit.
»Hey, Dieterlein. Alles, alles Gute zum Geburtstag!«, röhrt er aufgedreht in sein Telefon. Die Herzenswärme eines Eiswürfels. Gekonnt, aber ungewollt macht er die ganze Feierlichkeit sofort wieder zunichte, indem er kurz darauf gedehnt »Bitte!« sagt. Perplex starre ich ihn ungläubig an. Ein leises Anzeichen von Erleuchtung huscht über mein Gesicht, als ich mir überlege, dass man die gleiche Wirkung auch nach einer Niesattacke erzielen könnte: »Hatschi!« – »Gesundheit!« – »Danke.« Und dann ein begeistertes »Bitte.« Das ist dermaßen absonderlich, dass ich es mir unbedingt merken muss.
Mr. Bitte verströmt den Geruch von Moschus. Den Mundwassergeruch von Odol.
Mit kräftigem, aber altem Organ redet er weiter und schaut dabei ständig geschäftig umher. Phrasendrescherei. Die Euphorie, mit der er von seinem Urlaub erzählt, wird umso unglaubwürdiger, je mehr Begeisterung er auffährt.
»Wir hatten so viel Spaß, ich sag dir. Was haben wir gelacht … der Wahnsinn!« Er reibt sich mit einer Hand am Hals. Als streiche er sich die Haut glatt. Eine weitverbreitete Geste.
Ständig webt er Modewörter ein, die bereits vor zehn Jahren keiner mehr verwendet hat. Ich kann nur grob schätzen, wann ich das letzte Mal »Holla, die Waldfee« gehört habe. Sein glitschiges Gesicht mit unzähligen Altersflecken passt nicht zu seiner Wortwahl. Sein Streben nach juveniler Wirkung verpufft erfolglos. Was aber eigentlich nicht stimmt, wenn er’s selbst nicht merkt. Alles ist subjektiv. Die eigene Wahrheit die einzige.
Ich höre die Antworten gedämpft und größtenteils unverständlich durch die Muschel seines Handys. Ich starre wiederholt zu diesem Kretin hinüber. Und je länger ich ihn betrachte, desto mehr sehe ich durch ihn hindurch anstatt in ihn hinein. Ich glaube, er ist gar nichts. Er ist niemand. Er merkt meinen Blick und sieht mich mit einem fast tadelnden Ausdruck an. Mein Mund verzieht sich sofort zu einem grellen, falschen Lächeln und ich tue so, als müsste ich meine Taschen nach etwas durchsuchen. Dabei lehne ich mich zurück, rolle innerlich mit den Augen und wende mit einem unterdrückten Stöhnen meinen Kopf ab.Als wäre ich unter Zugzwang. Er hustet kurz. Ich murmele einen lautlosen Fluch. Mein Buch fällt mir fast vom Schoß. Das Telefongespräch geht inzwischen unverändert lautstark weiter. Ich sitze wieder normal. Sage innerlich das Alphabet auf. Überspringe jeweils einen Buchstaben. A, C, E, G. Dann rückwärts. Jeweils einen Buchstaben überspringen. Z, X, V, T, R. Langsam wird’s wieder.
Ich werde schläfrig und lese weiter. Ich habe brutalen Hunger. Aber ich werde heute nichts mehr essen. Von nichts kommt nichts. Auf meinem rechten Knie klebt ein kleiner Fussel, den wegzuwischen ich zu müde bin. Stattdessen überprüfe ich meine Fingernägel. Picobello.
Wenig später beschließe ich, in das im obersten Stock gelegene Café auf einen erfahrungsgemäß stets tadellosen Espresso zu gehen, und bin entsetzt, als er nach Wischwasser schmeckt. Ich hab noch niemals Wischwasser getrunken und kann mir die Signale meiner Geschmacksnerven nicht erklären. (Erste Tasse nach Reinigung der Maschine?) Eine Kundin, harter Blick, schlaffe Mundwinkel, Studienrätin, ordert zischend einen Caramel »Mattschiatthoh« Meine Ohren hören das. Zwei Worte blinken in meinem Kopf auf. Heckenschere und Alibi. In dieser Reihenfolge. Ich presse die Hände zusammen.
Die Frage lautet nicht, hätte ich Schuldgefühle?
Die Frage lautet, hätte ich eine realistische Chance, nicht belangt zu werden?
Während ich mir noch ein Glas Wasser aus einer der beiden bereitstehenden Karaffen in einen Plastikbecher einschenke und das Mädchen hinter der Selbstbedienungstheke den Empfänger einer anderen Bestellung ausruft, »Einmal die große Latte zum Mitnehmen«, entdecke ich eine Frau, die einen Mann beobachtet, der eine Frau beobachtet, die sich selbst in ihrem Schminkspiegel betrachtet. Sie wirken wie eine Einheit. Ich komme mir wie ein Störenfried vor und lasse die drei wieder allein. Und sobald ich wegschaue, ist es kurz so, als würden auf einmal alle Gespräche im Café verstummen. Niemand sagt was. Keine Geräusche.
Morgen bestell ich auf jeden Fall einen Cappuccino.
Aus kurz nach sechs ist plötzlich kurz vor acht geworden. Genau genommen sieben vor acht. (Ich nehme es immer genau.) Ich sitze wieder und lese. Das mir vertraute, immergleiche Streichquartett ertönt aus den Lautsprechern. Eine Art musikalischer Rausschmeißer, um auf den kurz bevorstehenden Ladenschluss aufmerksam zu machen. Der scharfe Kontrast zwischen dieser romantischen Beschallung und der ameisenhaften Betriebsamkeit im Laden beschwört jedes Mal eine groteske Irrenhausszenevor meinem inneren Auge herauf. Eine Mischung aus »Einer flog übers Kuckucksnest« und »Twelve Monkeys«. Das im Hintergrund leise hörbare Quietschen der Rolltreppe, das wie Kinderweinen klingt, tut ein Übriges dazu. Ähnliche Assoziationen löst klassische Musik bei mir auch im Auto aus. Opern, Sonaten, Sinfonien, Klavierkonzerte. Ich wechsle dann sofort den Sender, sonst komme ich mir vor wie auf der Flucht aus der Anstalt. Fehlen nur noch die Wildlederhandschuhe fürs Lenkrad und der irre Blick. Klassik wird völlig überschätzt, die Zeit ist vorbei. Hören ausschließlich Wichtigtuer, die meinen, damit eine gewisse elitär-intellektuelle Haltung zu kultivieren. Und das, natürlich, »bei einem gepflegten Glas Wein«. Und der ganzen Kaminfeuerscheiße. Wer braucht schon die zigtausendste Aufführung eines zweihundert Jahre alten Stücks? Dabei fühlt keiner mehr was. Es sei denn, er bildet es sich ganz fest ein. Von Jazzfans will ich gar nicht erst reden. Musik für Menschen, die Musik nicht leiden können.
Ich blättere um. Bin in etwa im letzten Drittel der Seite. Unheimlicher Zufall. Ein Trio sie-er-er geht an mir vorbei. In dem Moment, in dem ich die Zeile »frage ich mich, ob wir hier wieder rauskommen« lese, sagt sie genervt zu einem ihrer Begleiter: »Jetzt, bitte, kannst du mal schaun, wo wir hier wieder rauskommen.« Wie oft passiert so was? Verdutzt sehe ich sie an. Ui. Kontrast Buchwelt/Wirklichkeit. Ui. Nicht schön.
Ich mache den obersten Knopf meiner Jeans zu, lege mein Buch zurück auf den Stapel, merke mir Seite 47, um morgen dort weiterzulesen, und verlasse den Laden. Ich weiß jetzt schon, dass ich die Seitenzahl bis morgen vergessen haben werde und mich wieder langsam rantasten muss.
Da das Gedränge vor dem Geschäft groß ist, ziehe ich mein Tempo an und gehe zügig vorbei an dem athletisch gebauten Bettler mit roter Baskenmütze, der täglich an derselben Ecke steht und auf sehbehindert macht. Vor wenigen Wochen habe ich ihn mal früh morgens joggen gesehen. Wie er dabei eine dicht befahrene Straße überquerte, formvollendet zwischen den Autos hindurch tänzelte, ließ mich eher an Adleraugen denken als an gelbe Armbinde mit schwarzen Punkten. Respekt. Den ganzen Tag hier herumstehen ist eigentlich viel anstrengender, als arbeiten zu gehen. Ich gebe ihm trotzdem nichts.
Raus aus dem Trubel. Ich werde wieder langsamer und biege an der nächsten Querstraße rechts ab. Damit nehme ich für den Heimweg bewusst einen kleinen Umweg in Kauf. Bei meiner momentanen Mindestgeschwindigkeit benötige ich auf meiner Route noch 7 Minuten und 48 Sekunden bis nach Hause. Nur einen Meter pro Stunde langsamer und ich kippe durch das Zusammenwirken von Schwer- und Fliehkraft um. Es pressiert nicht. Zu Hause gibt es nichts Aufregendes, was mich erwarten würde. Mein Schritttempo gibt Entspannung vor, doch meine Gedanken rasen. Wie immer. Meine eben gemachte Distanzberechnung basiert auf meinem mir unerklärlichen Talent, Strecken räumlich wie zeitlich bildhaft vor mir zu sehen. Wo ich auch bin, ich weiß nicht nur immer genau, wo Norden ist, ich nehme auch mein geografisches Umfeld so wahr, dass ich wie ein menschliches Navigationssystem funktioniere. Lediglich Staus kann ich nicht voraussehen. Ich sollte lieber niemandem von meiner Begabung erzählen. Womöglich komm ich dann ins Labor und werde für militärische Zwecke missbraucht. Und das wäre nicht fair. Dem Feind gegenüber.
Mein Handy klingelt. ›Bettina E. Handy‹ erscheint auf meinem Display. »Hi«, »Hi«, »Alles gut?«, »Ja, und bei dir?«, »Auch«, »Wolln wir uns heute Abend sehn?«, »Okay«, »Bei dir?«, »Ja, wunderbar«, »Um neun?«, »Ja gut, bis dann«, »Ja, bis dann, tschüss«. Kurz und bündig. Nur kein unnötiges Gelaber. Ein hundertfach erprobter Wortwechsel. Jetzt hab ich doch noch einen Termin reinbekommen. Schon fühle ich mich ein bisschen gestresst. Das bringt mich fast aus dem Gleichgewicht. Aus meinem Ungleichgewicht. Wenn man erst mal gar nichts mehr tut, ist jede Veränderung eine Belastung. Jetzt muss ich ein wenig umdisponieren: Wichsen wie geplant entfällt. Ressourcen sparen.
Noch 5 Minuten und 7 Sekunden bis zum Ziel. Als ich mir das leise vorsage, bemerke ich, wie ich dabei unbewusst die monotone Computerstimme eines echten Navis imitiere. Laut Digitalanzeige neben der Apothekenleuchtreklame hat es noch 29 Grad Celsius. Das wird sicher ein Rekordsommer.
An der nächsten Kreuzung ist offenbar vor wenigen Minuten ein schwerer Unfall passiert. Überall sich stumm drehende Blaulichter und hektisch wirkende Rettungskräfte. Dem galten also die ganzen Sirenen, die ich vorhin wahrgenommen habe.
Ein Motorradfahrer wurde von zwei Autos in die Mitte genommen. Der genaue Unfallhergang interessiert mich nicht. Unfälle interessieren mich überhaupt gar nicht. Ich sehe mir viel lieber die Schaulustigen an. In dicken Menschentrauben stehen sie an den Straßenseiten, ein einziges großes Glotzen. Zirkus, Eintritt frei. Wo die nur immer herkommen, so schnell und in diesen Mengen. Sachkundig mustere ich sie. Ich bin so etwas wie ein Schaulustigen-Schaulustiger. Die Schattierungen und Abstufungen des Verhaltens zu kategorisieren, ist eine Wissenschaft für sich. Das merkt man schnell, wenn man sich erst mal in die Materie eingearbeitet hat. Offene Münder, Mondkälberaugen, ein nicht enden wollendes Kopfschütteln, heuchlerisches Entsetzen und scheinheiliges Mitgefühl. Das erfordert der Ernst des Augenblicks. Entweder zur Vertuschung: Gott sei Dank nicht ich, aber gerne mehr davon. Oder als Vorbeugungsmaßnahme: Vorsicht, unterlassene Anteilnahme könnte zu eigenem Unglück führen.
In etwa die Pole, zwischen denen sich das Gesamtspektrum menschlichen Innenlebens bewegt – das monolithische Grundgerüst aus Missgunst, Schadenfreude und Angst. Dessen vierte tragende Säule, Neid, hier höchstens in Zusammenhang mit der Schadensersatzsumme der gegnerischen Unfallversicherung ins Spiel kommt.
Eine junge Schreckschraube mit vorstehenden Zähnen lispelt benommen »Schlimm, schlimm« in Richtung ihres Freundes oder Mannes mit Nilpferdkopf. Der legt seinen Zeigefinger auf den Mund. Ein Sanitäter ruft gerade etwas mit »Injektion« und »schnell ab dafür«. Das möchte er nicht verpassen.
Ich amüsiere mich über dieses Grauen und fühle mich sofort als etwas deutlich Besseres. Bis ich um die Ecke biege. Dann hat sich das auch wieder erledigt und meine Lethargie setzt erneut ein.
Ich ziehe das Tempo an, da ich noch ein Bad nehmen möchte, bevor Bettina kommt. Alles ist Arbeit. Ein leichtes Stöhnen entfährt mir, als ich daran denke, dass ich im Anschluss wieder die Armaturen und Keramikflächen der Wanne trocken wischen muss. Das mache ich immer und dadurch sieht mein Bad 1A aus. Keine Kalk- oder Schimmelflecken, das gibt’s bei mir nicht! Aber dieses Reinigungsprozedere, jedes Mal, mindert den Badekomfort doch erheblich. Bei entsprechender Gemütslage, wie jetzt zum Beispiel, mischt sich bei dem Gedanken daran auch eine Prise Verzweiflung in meine Emotionspalette. Es hat dann so etwas Universelles, im Sinne von ›Hört das denn nie auf?‹. Nein, tut es nicht. Zumindest nicht, bis alles aufhört.
Im Vorbeigehen sehe ich meine Silhouette in den Seitenfenstern eines parkenden Autos. Der dunkle Lack des Volvos ist komplett mit senkrecht verlaufenden Schlieren zugekleistert. Wohl unter einem Baum geparkt. Ich versuche mir vorzustellen, wie sehr mein Spiegelblick von meinem normalen Gesichtsausdruck abweicht. Wie ich wohl für andere Leute aussehe.
Meine übertriebene Aufmerksamkeit beim Überqueren der Straße – viermaliges Links- und Rechtsschauen in schnellem Takt – vergegenwärtigt mir meine Zerstreutheit. Ich gehe an einem Mann vorbei, Ende 30 in etwa, am Gürtel eine Handytasche aus schwarzem Kunstleder, in der ein Kuli steckt. Die hellbraunen Haare knapp neben der Mitte gescheitelt. Er und seine Kleider riechen nach selten gelüfteter Wohnung.
An der Stelle, unter einem Parkverbotsschild, an der ich vor zwei Jahren einen 100-Euro-Schein fand, sehe ich ganz genau hin. Tue ich jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme. Als würde ich erwarten, dort wieder Geld zu entdecken.
Ich glaube, es gibt Menschen, die ernsthaft in Erwägung ziehen, einen solchen Fund zu melden. Oder die zu viel erhaltenes Rückgeld reklamieren.
Wenn einem etwas zufliegt, muss man es behalten. Nur so ist sichergestellt, dass die Balance des Lebens gewahrt bleibt. Dann hat man nichts zu bereuen, wenn man selbst mal etwas verliert. Weiter.
Bettina ist immer ziemlich pünktlich. Ich habe jetzt noch 49 Minuten bis zu ihrer Ankunft. Das schaff ich locker. Wir treffen uns zwei-, dreimal im Monat und führen das, was ich eine Nicht-Beziehung nenne. Als wir uns vor ziemlich genau sechs Jahren kennenlernten, stellte sich schnell heraus, dass Bettina mich liebt und ich sie nicht. Doch sie blieb dran (an mir). Noch nie war mir eine Frau derart auf den Fersen gewesen und schließlich entwickelte sich dieser Turnus, den wir bis heute unverändert beibehalten und der mir sehr angenehm ist.
Bei durchschnittlich drei Verabredungen pro Monat über sechs Jahre hinweg heißt das, dass wir bisher ungefähr 216-mal Sex miteinander hatten. Sagen wir abgerundet 200-mal. Das ist hundertmal öfter, als ich normalerweise mit einer Frau zu schlafen imstande bin. Habe ich einen weiblichen Körper nämlich zwei- bis dreimal gevögelt, interessiert er mich nicht mehr. Und kann mich auch nicht mehr stimulieren. Abgearbeitet, erledigt, auf Wiedersehen. Das ist unabänderlich. Und sehr bedauerlich. Hauptsächlich für mich. Das bringt eine Unruhe in mein Leben, an der ich gar kein Interesse habe. Und zieht sich durch alle Bereiche. Alles hat ein Haltbarkeitsdatum, das lautet: »Benutze es zügig und entsorge es im Anschluss unverzüglich«. Ich kann nichts dagegen tun. Folglich ist mir Bettina wirklich ein unerklärliches Phänomen. Und so versuche ich konstant, mit zahllosen Nutten, Kurzaffären und sonstigen ausgleichenden Maßnahmen, aufkommender Eintönigkeit entgegenzuwirken.
Bettina ist 27, studiert Biochemie im letzten Semester und hat ein Stipendium für Hochbegabte. Von dem sie aber niemandem erzählt. Noch so ein Punkt, der die Existenz unserer Beziehung für mich schwer verständlich macht. Sie ist hoch intelligent, aber die Tatsache, dass sie mich mag, lässt mich eher an ihr zweifeln, als dass ich sie dafür schätzen würde. Sie hat dunkelbraune Haare und ein sehr edles Gesicht. Ihre ganz leicht zu dünn geratenen Lippen verleihen ihr einen Hauch von Strenge, die sie in ihrem Wesen aber nicht aufweist. Sie hat auffallend schöne Haut und riecht außerdem sehr gut.
Wir machen keine Dinge, die normale Paare tun, wie z. B. einen Tag zusammen verbringen, durch die Stadt bummeln oder sonst was unternehmen. Wir haben noch nie zusammen gefrühstückt, sind nie zusammen aufgewacht. Ich kann nicht schlafen, wenn jemand mit mir im Raum ist. Ist mir zu intim, zu verbindlich. Im klaren Morgenlicht sieht mir Zweisamkeit zu ernüchternd aus. Raspelnde Morgenstimme, müffelnde Körper, Mundgeruch, zerknautschte Gesichter, zerzauste Haare, unnötige Kommunikation. »Gut geschlafen?« Ja, genau. Das kommt für mich nicht infrage.
Ich ziehe das konsequent durch und mache mich nach dem Sex aus dem Staub. Oder schmeiße sie raus. Natürlich charmant. Mit der Bitte um Verständnis. Was mir zusammen mit meinen anderen Eigentümlichkeiten fast schon wieder eine Art Exotenbonus verleiht. Dass ich mich wegen des Ungleichgewichts unserer gegenseitigen Zuneigung manchmal unwohl fühle, vermag ich sowohl durch Gewohnheit als auch durch sukzessive Verrohung zunehmend besser zu ignorieren. Nie habe ich Bettina etwas vorgemacht oder Liebe geheuchelt. Vielleicht hat sie anfangs geglaubt, das Thema aussitzen zu können und meine Gefühle für sie würden sich dann schon noch entwickeln. Aber dem war nicht so und das wird, wie ich mich kenne, auch nie passieren. Warum ich nichts für sie empfinde, verstehe ich selbst nicht. Ich war noch nie in jemanden verliebt.
Ich öffne die Haustür und laufe in ein Blondchen aus dem zweiten oder was weiß ich wievielten Stock. Ich kenne sie vom Sehen und würde mir ihren Namen selbst dann nicht merken, wenn sie ihn mir zehnmal sagte. Mich interessiert auch nicht, dass sie schwanger ist (›Gratulation‹), das Kind im Januar kommt (›Spitze, toi, toi, toi‹), sie und ihr Mann sich darauf freuen (›Das glaub ich‹), Junge oder Mädchen, egal, Hauptsache gesund (ich könnte ihr doch mal versuchsweise auf ihre Schuhe kotzen), wenn’s feststeht, Junge oder Mädchen, wird’s nicht verraten, hihi (gibt’s diese Sprüche irgendwo zum Auswendiglernen?), und dass übrigens bei den Mülltonnen das Tor nicht mehr von alleine zugeht (what the fuck!), ob ich das auch schon bemerkt hätte (hä?), und sie jetzt zur Wurzelbehandlung geht (what the flying fuck!!!). ›Was erzählst du mir da? Laber mich nicht zu und lass dir auch gleich noch die Zahntaschen säubern, und zwar dringend, du stinkende Schnalle‹, möchte ich ihr nachrufen, als ich in den Aufzug steige. Stattdessen versuche ich mich an einem verständnisvollen Lächeln, das mein Wegdriften kaschieren soll. Die Lifttür schließt. Ich mache eine schwache wegwerfende Handbewegung und breche in mir zusammen, stehe mit geschlossenen Augen da und versuche, nicht in den Knien einzuknicken. Drücke die 5. Die Kraft des Frustes lässt mich schaudern. Mein Kopf nickt leicht, ich kann es nicht abstellen. Wackeldackel. Bleierne Schwere, gepaart mit nervöser Unruhe, erfüllt mich.
Die Stockwerkanzeige.
Rote Ziffern.
1, 2, 3, 4, 5.
Erst kurz bevor die Aufzugtür aufgeht, öffne ich die Augen und lade meinen Blick durch. Ich versuche so neutral wie möglich zu schauen, nur für den Fall, dass mir jemand begegnet. Wenn das passiert, setze ich ein dezentes Lächeln auf und sage mit entspannt klingender Stimme artig mein ›Hallo‹, bevor ich mich abwende und mein Gesicht wieder zusammenfällt.
Als ich damit begann, ein Bewusstsein für meine Außenwirkung zu entwickeln, musste ich die Performance meiner Höflichkeit erst feinjustieren. Ein langer Prozess. Anfangs war es manchmal der Freundlichkeit zu viel. Zu bemüht und überzogen wirkten meine Guten Tags, Entschuldigungs, Verzeihungs, Vielen Danks und sonstigen Standards. Man konnte unter Umständen merken, dass ich etwas zu verbergen hatte oder irgendwas schräg an mir war. Mittlerweile bilde ich mir jedoch ein, die richtige Intonation gefunden zu haben, um als höflicher und umgänglicher, zu Sanftmut und Überlegtheit neigender Mitmensch wahrgenommen zu werden. Denkt man sich aber hinter jedes ›Entschuldigung‹ ein ›Schwirr ab!‹, hinter jedes ›Verzeihung‹ ein ›Leck mich!‹ und hinter jedes ›Vielen Dank‹ ein ›Und bitte fall tot um‹, kommt man der Wahrheit bedeutend näher. Ich bin so arrogant wie verzweifelt. Gleichzeitig geladen und hilflos, und nur eiserne Selbstbeherrschung hält mich davon ab, mein Gegenüber nicht sofort umzubringen.
Ich ertrage es nicht, dass die anderen nicht so sind wie ich. Komme nicht damit zurecht.
Und ich ertrage es nicht, dass ich nicht so bin wie die anderen.
Aber ich bin ja nicht blöd. Also lasse ich es. Und bringe niemanden um. Führt ja doch zu nichts. Stattdessen schlage ich lediglich Zeit tot. Zeit totschlagen. Oder kurz: Leben.
Beim Betreten meiner Wohnung führe ich meine x-fach durchexerzierte Reihe von Automatismen aus: Schuhe ausziehen und exakt nebeneinander stellen (exakt!), Hände sorgfältig waschen, inklusive Unterarme, den Waschbeckenrand sofort abtrocknen und die Wanne einlaufen lassen. Spätestens wenn ich ins Arbeitszimmer gehe und den Computer einschalte, rede ich mit mir selbst. Ich führe seit ich denken kann Selbstgespräche und parliere oft darüber, dass ich mit mir darüber rede, dass ich mit mir rede. Häufig gebe ich auch imaginäre Interviews in von mir geschätzten Sendungen wie der NDR-Talkshow oder 3nach9 über meine Welthits, die ich gar nicht habe. Da erzähl ich einfach mal locker drauf los. Mir gehen nie die Themen aus. Ich bin mir ein dankbarer Gesprächspartner. Jedoch muss ich aufpassen, dass ich nicht auch auf der Straße mit mir rede. Manchmal gelingt mir das nicht und erst der entgeisterte Blick eines Passanten signalisiert mir, doch besser meine Klappe zu halten. Sehe ich selbst jemanden auf der Straße mit sich reden, ist der für mich komplett abgehakt. Irre. Gummizelle. Aber Lippenbeweger nehmen zu.
Beunruhigt mich das? Nicht im Geringsten.
Heute bin ich nicht so gesprächig. Bin etwas in Eile.
Die Wanne braucht 11 Minuten und 3 Sekunden, um vollzulaufen. Ich rufe in der Zwischenzeit meine E-Mails ab. Sitze in meinem großen schwarzen Schreibtischsessel. E-Mail-Check ist zwanghaft. Das erste am Morgen, das letzte in der Nacht. Und ungezählte Male zwischendurch. Wenn keine Nachricht in meinem Account liegt, bin ich mir nicht zu blöd, sofort noch einmal auf ›Senden/Empfangen‹ zu drücken. Nur mein Unterbewusstsein weiß, was ich mir davon verspreche.
Neun neue Messages, nehme ich erfreut zur Kenntnis. Darunter drei Penisverlängerungen und ein Potenzbeschleuniger. Aber auch andere Nachrichten, wie zum Beispiel die Anfrage eines bekannten DJs (»Top-Selling Dance Act« steht in seiner Signatur, Kniefall, Arschloch), ob ich einen Titel für ihn schreiben kann. Ich verdrehe die Augen. Klar, kann ich, aber Lust hab ich keine. Referenztitel als mp3-File anbei, mit der Bitte: »Schreib was, das genauso klingt, wie der beigefügte Song, aber ganz eigenständig ist, aber eben so wie die angehängte Nummer, aber in neu. Liebe Grüße.« So kenn ich das, ist meistens so. Mach ich. Aber nicht jetzt. Ich bestätige den Posteingang und versichere, mich dranzumachen und alsbald zu melden.
Ich öffne eine weitere Mail, eine Kompositionsanfrage für eine Schlagertante (verkauft sehr gut, muss ich also leider machen. Ich bin ziemlich geldgeil).
Jepp, nächste E-Mail. Die SonyBMG schickt eine Labelcopy, den Wisch, auf dem alle an der Produktion Beteiligten vermerkt sind, mit Bitte um Absegnung der Credits fürs CD-Booklet, bevor das Teil ins Presswerk geht.
»I Could Go On Forever« / Music and Lyrics: …
Jawoll, mein Name ist richtig geschrieben. Das ist das Allerallerwichtigste. Der Titel an sich? Meistens höre ich mir die Belegexemplare der CDs gar nicht mehr an, wenn ich sie zugeschickt bekomme.
Was zählt, sind einzig die CD-Covers. Je mehr, desto besser. Sie stellen so etwas wie Trophäen dar. Stabilisatoren meines Selbstvertrauens.
Diese und die anderen Nachrichten haben Zeit. Beantworte ich später.
Halt, diese E-Mail öffne ich noch. Abgeschickt vor einer Minute. Ganz aktuell. Mit Ausrufezeichen, high priority. Von Markus Limmland. Die Knalltüte vom F2P-Artist-Management. Sieht aus wie Mephisto nach einem Auffahrunfall. Nachnamen beginnend mit L oder J sind phonetisch wahnsinnig unsexy. Zu weich. Jablonsky, Lehmann, einfach schlaff. Limmland. Pff. Markus gratuliert mir zur Veröffentlichung der Glass-Gallery-CD. Eine Möchtegern-Emo-New-Prog-Rock-Band. Die von mir verfassten Titel, 3 und 5, gefallen ihm am besten und er spielt’s dauernd im Auto. Ja, so was schreib ich anderen auch immer. Du blödes Stück Scheiße. Schmier dir deine Freundlichkeit sonst wohin.
Komplimente sind mir verdächtig.
Er verfasst zudem E-Mails und SMS grundsätzlich in Großbuchstaben. Was für ein grober Klotz.
Was will man auch von jemandem erwarten, der sein eigenes Profil auf Wikipedia selbst verfasst und reingestellt hat.
Ich hätte Lust, ihm mal so richtig die Meinung zu geigen.
Ihm und seinen knallgelben Reebok-Turnschuhen und seiner zotteligen Gesichtsbehaarung. Er hat mir letztes Jahr eine Connection ziemlich versaut und eines meiner Projekte terminlich hängen gelassen.
Deshalb tippe ich folgende Antwort:
Hallo Markus,
vielen Dank für Dein nettes Feedback.
Hoffe, Dir geht’s gut und wir sehen uns bald mal wieder.
Beste Grüße,
Peter
Absenden.
Outlook schließen. Eigene Dateien doppelklicken. Jetzt zum momentan Wesentlichen. Zu dem, was mich seit vier Monaten in Beschlag nimmt.
Vier Monate sind 122 Tage.
Sozusagen mein neues Hobby. Ich öffne den Ordner »DAN«, was für »Die Annonce« steht. Was Blöderes ist mir damals nicht eingefallen, um den Inhalt zu verschleiern. Vielleicht habe ich tatsächlich geglaubt, der CIA wird den Ordner beim Filzen meines Computers übersehen, weil »DAN« so unverfänglich klingt. Wie das Erbinformationsmolekül, von einem Legastheniker im Suff buchstabiert. Als ich vergangenen März auf dem LifeCycle meines Fitnesscenters saß und mein Warm-up absolvierte (20 Minuten, Stufe 11, 363 Kalorien), las ich nebenbei die Süddeutsche. Oder FAZ. Oder taz. Oder Die Welt. Oder Yps. Zufällig stieß ich dabei auf die Seiten mit den Kontaktanzeigen. Komischerweise hatte ich sie davor noch nie bewusst wahrgenommen.
Horoskope, ja, kurz überflogen, wenn mal gar nichts anderes übrig blieb. Oder die Grobmotorikmetaphern der Todesanzeigen, deren Betroffenheitsgeschwafel fast schon wieder lustig ist. All diesen Zeitungsmüll hatte ich also schon mal näher in Augenschein genommen. Aber noch nie diese wundervollen Partnerschaftsannoncen. Und was ich da las, während ich schwitzend in die Pedale trat, faszinierte mich völlig. Absorbierte mich in seiner Absurdität.
»Adrette Venusianerin möchte Stopp auf dem Mars machen, um Dich kennenzulernen!«
Sie meint das nicht so, das kann niemand so meinen, wieso auch.
Eine Recherche in die Abgründe der Sehnsucht.
»Erste Geigerin im Orchester der Herzen sucht Dirigenten!«
Mir zog sich alles zusammen.
Irgendwas mit »Wolke 7«. Irgendwas mit »Glückselige Ewigkeit«. Irgendwas, das ich nicht mal für einen vertrottelten Text für eine verreckte Schnulze für eine verblödete österreichische Volksmusikkapelle mit roten Westen, blauen Hemden und grünen Lederhosen verwenden würde.
Ich glaube, bei Minute 16, Stufe 11, 284 Kalorien kam ich, schon völlig durchnässt, zu dem Schluss, dass nur ein Typus Mensch so was ernsthaft schreiben kann: Opfer. Ganz klar. Opfer.
Ich hatte nicht unbedingt einen Steifen, aber ich hatte auch keine Wahl.
Wer einen derart gequirlten Ausfluss verfasst, wird mühelos manipulierbar sein. Weil er sich selbst manipuliert. So jemanden muss man schon aus rein wissenschaftlichem Interesse benutzen. MUSS.
Zeit totschlagen.
Und ich würde es nicht irgendwie halbherzig tun oder nur so ein bisschen. Ich würde es, entsprechend meiner Art, systematisch verfolgen. Ausloten, wie weit ich gehen kann.
Zeit totschlagen.
Vier Monate.
122 Tage.
2928 Stunden.
Spar dir die Sekunden.
Ausloten. Wie weit kann ich gehen. Und das habe ich die vergangenen vier Monate reichlich getan.
In eineinhalb Minuten ist meine Wanne eingelaufen. Auf der »DAN«-Dateiseite vermerke ich mit heutigem Datum noch eben die beiden nachmittags getätigten Telefonate mit zwei Annoncieusen, die genauen Uhrzeiten, kurze Angabe über Inhalt der Gespräche und die weitere Terminierung. Alle persönlichen Details finden sich hier fein säuberlich geordnet. Ohne diese Informationen kann ich den Überblick nicht mehr behalten. Keine Chance. Die Frauendichte ist zu hoch. Daten über Familienverhältnisse, den Freundeskreis, die wichtigsten Namen und Besonderheiten aus dem Umfeld der Frau, Querverweise, kalendarische und biografische Fakten. So sortiert, dass ich schnell zugreifen und alle notwendigen Einzelheiten abrufen kann, falls mich mal ein Anruf überraschend erreicht. Ein Ding der Unmöglichkeit, das alles ohne Fehlschaltungen im Kopf zu behalten. (Susi, Gabi, Karin, wer zur Hölle bist du?) Verwechslungen oder offenbarte Wissenslücken könnte ich mir nicht verzeihen. Alles notiert. Speichern, schließen, PC runterfahren.
Mit ausgestrecktem linkem Arm, Handy in der Hand, Linse in meine Richtung, schieße ich ein Foto von mir. Seit drei Jahren mache ich jeden Tag ein Bild meines Gesichts. Und ich habe vor, dies zu tun, bis ich sterbe. Eine Dokumentation der Vergänglichkeit.
Dann ziehe ich mich aus (werfe meine Kleider in die nach Farb- und Weißwäsche sowie nach Waschtemperatur geordneten Wäschebehälter), checke meinen Körper im Spiegel und steige ins Wasser. Das hat exakt die richtige Temperatur: 37 Grad. Noch einundzwanzig Minuten, dann kommt Bettina.
1260 Sekunden.
Ich liege in der Wanne und lasse mich einweichen. Nicht zu lang, sonst trocknet die Haut aus. Von der Badewanne aus betrachte ich die heute früh aufgehängte Weißwäsche (60 Grad).
Eine 60-Grad-Wäsche ohne Vorwäsche hat eine Laufzeit von 121 Minuten.
Mit Vorwäsche 152 Minuten.
Das sind zwei Stunden und 32 Minuten.
Ich bin jedes Mal überrascht, dass eine Waschmaschinenladung exakt auf den Wäscheständer passt. Bis aufs letzte Stück. Ohne dass ich es forciert hätte. Hinter diesen beiden Erfindungen stecken große Köpfe.
Das Handy klingelt, aber es liegt auf dem Schreibtisch. Mein Festnetztelefon beginnt nun auch zu läuten und wahrscheinlich wird es nie wieder passieren, dass auf beiden Anschlüssen gleichzeitig angerufen wird. Obwohl das Handy früher begann, hört es erst später auf zu klingeln.
Am liebsten würde ich Bettina absagen.
Auf das Stereoklingeln konzentriert, stecke ich unbewusst die Zunge zwischen die Vorderzähne. Als ich es merke, ziehe ich sie sofort zurück. Anschließend mache ich kopfschüttelnd einen Schmollmund. Ebenfalls ungewollt. Eins führt zum anderen.
Ich stehe auf, um mich abzuduschen, und haue mir zum allerersten Mal den Kopf an der Dachschräge an. So richtig. Mein Gesicht verzerrt sich. Obwohl es einer dieser Stöße war, den man überhaupt nicht spürt. Laut und erschütternd, aber völlig schmerzfrei. Trotzdem schaue ich immer noch belämmert drein. Eigenartig, dass Erstaunen und Schmerz manchmal gleich aussehen.
Ich mag meine Dachschrägen. Kann nur ganz oben wohnen, weil ich ein Gefühl von Ausgeliefertsein habe, wenn noch jemand über mir ist.
Es wird langsam dunkel. Haare frottieren. Dabei schaue ich aus dem Fenster, der Himmel ist ganz leicht bedeckt. Eine Wolke ähnelt dem Aerosmith-Logo. In einer der Wohnungen unter mir muss gerade jemand kochen. Durch das gekippte Fenster dringt Essensgeruch. Ich betrachte das als persönliche Beleidigung.
Die Armaturen und Ränder der Wanne habe ich abgetrocknet. Ich creme meinen Oberkörper mit Körperlotion ein. Das Gesicht nicht, weil ich sonst zu sehr glänze – sogar dann, wenn ich noch einmal mit einem feuchten Handtuch drübergehe. Daher verwende ich für das Gesicht eine spezielle Tagescreme von Nivea, die schnell einzieht.
Dann trage ich sorgfältig das Bruno-Banani-Deo unter meinen Achseln auf.
Ich ziehe eine schwarze Unterhose an (35 Euro das Stück, habe 40 davon, dann lohnt die 60-Grad-Wäsche), die schwarzen Socken (31 Euro das Paar, habe davon ebenfalls 40, so lohnt die 30-Grad-Fein- mit Vorwäsche), mein schwarzes Joop-Hemd (das einzige, das mir wirklich steht. Habe drei identische Stück insgesamt, eins in der Reinigung, eins im Schrank, eins an) und meine dunkelblaue Hilfiger-Jeans (eine der wenigen, die mir steht, habe ebenfalls drei davon, momentan alle frisch im Schrank, bis auf die, die ich gerade vom Bügel genommen habe, natürlich). Nach nur fünf Sekunden schalte ich MTV hastig aus. Eine VJane mit zu breitem Becken moderiert gerade ein Linkin-Park-Video an, das ich gerne sehen würde. Ihr Gelaber wird aber leider etwas länger dauern, da sie noch ein einleitendes Geschichtchen erzählen will. Dabei verrenkt sie epileptisch ihren Körper, der deutlich weniger geil kommt, als sie glaubt. Die Ansageschlampen bei MTV sind überdreht wie Crackjunkies. Und sehen auch so aus. Aber wer braucht noch MTV, wenn es YouTube gibt?
Internet killed the video star.
Während ich meinen Gürtel schließe, schlüpfe ich in meine weißen Adidas-»Adi Racer«-Sneakers mit den schwarzen Streifen. Ich bin ein Turnschuhträger. Die Adidas und meine silbernen Nike Air werfe ich jeden Januar weg und ersetze sie durch ein neues Paar des jeweils gleichen Fabrikats. Einzig zu festlichen Anlässen trage ich ein Paar schwarze Kenzo-Schuhe. Aber ungern, fast widerwillig. Ich bin ein Sneakerstyp. Noch unterstreichen sie meine Jugendlichkeit. Der Tag wird kommen, an dem sie mein Bemühen um Jugendlichkeit betonen werden.
Ich ziehe mein Hemd noch einmal aus, weil ich vergessen habe, meine Haare zu kämmen. Bloß keine Haare oder Schuppen auf dem Kragen. Ich kämme durch. Dann ziehe ich das eng geschnittene schwarze Joop-Hemd mit dem mittelhohen Kragen, das mir gut steht, wieder an.
Ein Markenprodukt. Mein Schrank ist voll davon. Marken. Kein Diktat. Freier Wille! Die Freiheit zu glauben, es gäbe einen freien Willen.
Was wäre die Alternative?
Draußen fährt ein Wagen mit voll aufgedrehter Anlage vorbei. Beyoncé, »Crazy In Love«. Ich lege einen Streifen Klopapier über meinen Zeigefinger und fahre damit in mein Ohr, um es zu trocknen. Dann ins andere. Tut gut. Keine Ohrstäbchen, da ein solches das Ohrenschmalz nur verklumpt und Richtung Trommelfell drückt. Wie ein Schneepflug. Nur dass Schmalz nicht schmilzt.
In drei Minuten kommt Bettina.
Das sind 180 Sekunden.
Zeit totschlagen.
Ich werfe das Papier mit den gelben Abdrücken ins Klo.
Spülung. Der Freie Wille.
Was wäre die Alternative?
Nichts weiter als eine Gegenreaktion.
Die Klospülung tropft. Schon seit Tagen. Das Wasser läuft zu langsam nach. Muss jemanden kommen lassen. Mist.
Blick in den Spiegel. Mein Hemd steht mir gut. Mehr ist nicht drin.
Ich sehe jeden Tag gleich aus.
Es klingelt. Punkt 9 Uhr. Ich betätige, ohne mich über die Gegensprechanlage zu vergewissern, den Türöffner und warte. Von der Haustür bis zu meiner Wohnungstür dauert es durchschnittlich 1 Minute 18 Sekunden, vorausgesetzt, der Aufzug befindet sich im Erdgeschoss. Während ich wie bestellt dastehe, nehme ich mein Notizbuch und schreibe den Satz hinein, der mir heute Morgen einfiel:
Ich bin alles, was ich habe.
Gefällt mir. Nur für mich. Nicht dass ich ihn vergesse. Ich muss jede Idee sofort notieren, da die nächste die vorangegangene verloren macht.
Der Satz steht jetzt unter dem, der mir gestern einfiel:
Ich würde mit mir nichts zu tun haben wollen.
Die Zeit ist um, ich fahre mir noch einmal durch die Haare, ziehe mein Hemd gerade, luge durch den Spion und öffne die Wohnungstür exakt in dem Moment, in dem der Lift aufschwenkt.