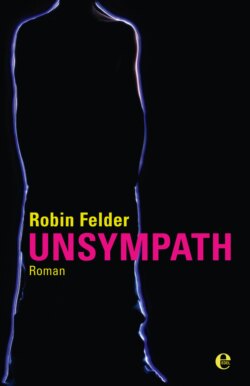Читать книгу Unsympath - Robin Felder - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 SCHWANKUNGEN
ОглавлениеSechs Tage später. Die vergangene Woche verlief ohne besondere Vorkommnisse. Ich habe fast jeden Tag eine andere Frau gedatet, habe zwei durchschnittliche Songs geschrieben und komme gerade aus meinem Fitnesscenter, in dem ich seit 15 Jahren viermal die Woche zwei Stunden trainiere. 180-mal im Jahr. 2.700-mal bis jetzt. Jede Trainingseinheit ein Kreuz in meinem Kalender. Einmal Auslassen kommt nicht infrage. Sonst habe ich das Gefühl, kläglich nachzulassen und meinen Biss zu verlieren. Meine frisch geduschte Haut riecht noch nach Duschgel. Im Kofferraum liegen die Tasche mit dem feuchten Sportzeug, Kleidung und Handtücher. Ich habe keine Zeit, das noch nach Hause zu bringen, sonst komme ich zu spät. Es verursacht mir ein schlechtes Gefühl zu wissen, dass die Sporttasche durchweicht. Im Wagen ist es heiß und ich spüre schon wieder einen leichten Schweißfilm auf meinem Körper. Das finde ich gar nicht gut.
Habe ich wirklich allen Ernstes geglaubt, ich würde dieses Jahr davonkommen? Als Bettina letzte Woche bei mir war, hat sie mich wieder rumgekriegt. Weichgekocht. Das ist das dritte Jahr in Folge, in dem sie mich auf diese dämliche Sommergrillparty ihrer Freunde – den beiden Vorzeigepärchen Peters (jung verheiratet) und Thalhammer /Michalskie (bald verheiratet) – mitschleppt. Ihre flehentliche Bitte, sie dorthin zu begleiten und meine Rolle eines normalen Freundes artig zu spielen, ist ihr ungemein wichtig. Sie hat meine kategorische Weigerung einfach nicht akzeptiert. Und obwohl ich normalerweise eigentlich keine Rücksicht auf ihre Gefühle nehme, sozusagen überhaupt kein Entgegenkommen zeige, mache ich jetzt also noch mal eine ausnahmsweise Ausnahme. Ich finde mich geradezu großartig großzügig – aber wen interessiert das?
Ich fahre noch zur Tankstelle, bevor ich sie gleich abhole. Es ist kurz nach drei. Ich bin verzweifelt. Ich verstehe nicht, warum sie bereit ist, ein solches Schauspiel zu inszenieren. Wesentlich einfacher wäre es, mit mir Schluss zu machen und sich einen richtigen Freund zu suchen. Dafür hätte ich vollstes Verständnis.
Wieder mal ärgere ich mich hauptsächlich über mich selbst. Habe mir doch vorgenommen, nie mehr etwas zu tun, was ich nicht möchte. Ganz oben auf meiner Prioritätenliste, Punkt eins. Noch vor: Scheiß auf alles. Selbst zu verantwortende Fehler verzeiht man am schwersten. Ich nehme einen letzten Schluck aus der Wasserflasche. Damit schließe ich meine Flüssigkeitsaufnahme für heute ab. Ich habe schon drei Liter intus und wenn ich jetzt weitermache, muss ich später ständig aufs Klo und das kommt nicht gut.
Mein Urin war beim letzten Wasserlassen ganz weiß. Das zu sehen tut jedes Mal wieder irgendwie gut.
Ich reibe mit dem Handballen an meinem rechten Auge. Der Radiomoderator fragt seinen Interviewpartner: »Was war das für ein Gefühl?« Ich schalte hastig um, spreize die linke Hand auf dem Steuerrad. Betrachte kurz den Handrücken, ein kleines Muttermal. Schade, hätte nicht sein müssen. Wundere mich, wie und wann und warum ein Muttermal entsteht. »To Love Somebody«, Bee Gees, läuft. Wieder mal ein Oldie. Dabei geht mir auf, dass der 70er-Jahre Barry Gibb dem 80er-Jahre George Michael optisch frappierend ähnelt. Es gibt Wichtigeres. Schon kommt »Feel«, Robbie Williams. Der ähnelt niemandem.
Während ich eine Kurve etwas zu sportlich nehme und trotzdem nicht vom Gas gehe, wird mir kurz schwindelig. Vielleicht hab ich Glück und ein Laster rammt mich ungebremst von der Seite. Dann komme ich auf der Stelle in die Hölle. Aber wenn man einen Lkw braucht, ist wie immer gerade keiner zur Stelle. An einer roten Ampel fahre ich alle vier Fenster runter. Frischluft. Am Fußgängerübergang steht ein Hosenträger-Träger mit ernst gemeinten Koteletten. Sein Haar sieht nass aus. Er wiegt sich mit auf dem Rücken verschränkten Armen vor und zurück und ruft dem Fahrer, der gerade seine Grünphase verschläft, »Grüner wird’s nicht!« zu. Was ungehört verhallt. Aber sein Blick bleibt versteinert in Habachtstellung. Er schüttelt streng den Kopf, wie er es wahrscheinlich auch beim Zeitunglesen tut, und verpasst dabei sein eigenes grünes Männlein. Ich denke einen Moment darüber nach, will es selbst nicht. Mir wird klar, dass ich den Armleuchter gern anfahren würde, wenn er über die Straße geht. Nur leicht anstupsen. So acht Wochen Krankenhaus.
500 Meter weiter biege ich in die Tankstelle ein, zu der ich immer fahre, weil ich eine Bonus-Chipkarte besitze, mit der ich alle drei Millionen Jahre eine Gutschrift von 20 Euro geltend machen kann. Ich bleibe vor der Nummer 5 stehen. Meiner Stammzapfsäule. Ich steige aus. Überfliege gewohnheitsgemäß die Autokennzeichen der anderen parkenden Wagen. Ein Nummernschild lautet »M-RL« und irgendeine vierstellige Zahl. Was einmal mehr meinen Verdacht nachdrücklich bestätigt, die Buchstabenkombination RL wird am häufigsten vergeben. Dicht gefolgt von CB. Vielleicht habe ich recht, vielleicht habe ich unrecht.
Griff nach dem Zapfhahn, umsichtiges Einführen in die Tanköffnung. Der Bügel des Feststellers springt zweimal raus. Beim dritten Mal rastet die Automatik endlich ein und ich singe eine Melodieidee auf mein Diktafon, während Super Bleifrei in den Tank rauscht. Danach stehe ich nutzlos rum und schaue auf die Rückbank meines Wagens. Dort liegt mein akkurat zusammengelegter Sportsweater von Armani, von dem ich annehme, dass er dem heutigen Event angemessen ist. Mit dem Ding sehe ich aus wie ein Börsenmakler in Freizeitkluft. Aus Verlegenheit öffne ich mit Druck auf die Wipptaste meines Autoschlüssels den Kofferraum und schaue, was meine Sporttasche so macht. Sie macht nichts besonderes, liegt nur da. In der Vertiefung rechts hinter dem Radkasten, neben der Schachtel mit den antistatischen Staubwischtüchern, liegt ein altes Armeemesser. Die geriffelte, achtzehn Zentimeter lange Klinge steckt in einem hellbraunen Lederfutteral, aus dem der dunkelgrüne Kunststoffgriff ragt. Wie neu. Ich glaube, von einem meiner Opas. Von denen ich keinen kennenlernte. Starben früh, wie alle Männer in meiner Familie. Mit Ende 50 ist spätestens Schluss. Aber davor, kerngesund. Ich habe das Messer irgendwann hier reingelegt. Falls ich es mal als Werkzeug oder vielleicht auch zur Abschreckung brauche. Möglicherweise ist es unter Zweiter-Weltkrieg-Fans sogar etwas wert.
Unverhältnismäßig schroff haue ich die Klappe wieder zu. Ich stehe weiter rum. Ich nage an meinen Lippen. Die Liter/Preis-Anzeige der Zapfsäule rast dahin und bleibt bei nur 58,78 Euro stehen. Ich aber strebe eine runde Summe an. Deswegen zuckle ich jetzt manuell mit leichten Stößen am Zapfhahn rum, halte kurz vor Erreichen der 60 Euro an und verlangsame gefühlvoll. Die Digitalanzeige bleibt trotzdem zu spät bei 60,01 hängen. Mist. Also weiter zu 61,00. Die Digitalanzeige wechselt in so großen Sprüngen, dass ich diesmal sogar erst bei 61,02 zu stehen komme. Das gibt’s doch nicht. Und als ich mich der glatten 62,00 nähern will, schnallt der Drücker des Zapfhahns dauernd zurück, weil der Tank schon übervoll ist. Schlussendlich gelingt mir ein unbefriedigendes 62,01 Euro. Ich hab keine Lust mehr und sehe sofort nach, ob ich ein 1-Cent-Stück im Portemonnaie habe. Abschließen. Warnblinkanlage bestätigt durch dreimaliges Aufleuchten.
Die junge Frau mit den Hasenzähnen an der Kasse sieht älter aus, als sie ist. Dabei verstehe ich nicht, warum ich glaube, dass sie älter aussieht, als sie ist, und ich nicht einfach annehme, dass sie älter ist. Aber ich täusche mich nicht. Sie ist vielleicht zwanzig. Und optisch knapp vorm Klimakterium. Als sie meine Bonuskarte ungelenk einscannt, nicht ohne sie zwischen Mars und Twix fallen zu lassen, schaut sie mich etwas verstört an. Ich hab sie die ganze Zeit angestarrt. Wie unhöflich. Aber ich bin fasziniert davon, in ihrem Gesicht ihre Mutter zu sehen, die ich gar nicht kenne, und festzustellen, wie gnadenlos unvorteilhaft ihr das Alter schon sehr bald zusetzen wird.
Ich nehme noch eine Medium-Komplettwäsche für unverschämte 9 Euro 80 und zahle mit einem Hunderter und dem 1-Cent-Stück. Und bekomme 28 Euro 20 zurück. Ich stecke 1 Euro 20 in das hässliche Trinkgeldschweinchen rechts neben der Kasse. Mein geriatrisches Bugs Bunny bedankt sich schwungvoll und wünscht »einen schönen Tag noch«. Komm, halt einfach dein Maul. Einen schönen Tag wünschen ist ätzend. Die reinste Anmaßung. Schlagartig erinnere ich mich an das, was mir jetzt bevorsteht. Meine ohnehin schon miserable Laune wird inzwischen durch einen Mordshunger noch verschlechtert. Doch vor der zu erwartenden Völlerei möchte ich nichts essen, was mich erst recht zu einem Nervenbündel macht. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich will mir den Appetit für das erlösende Abendessen aufsparen und bin bis dahin schon so abgefuckt vor Erschöpfung, dass ich die Kurve nicht mehr kriege, egal wie viel ich dann in mich hineinstopfe. Mich fröstelt.
Während ich vor der Waschanlage stehe und zusehe, wie die Bürsten über das nasse Blech des Wagens wischen, wird mir klar, dass ich doch tatsächlich an einem Sonnabend mein Auto waschen lasse. Jetzt will ich sofort Selbstmord begehen.
Jost geht nach einem Mal Klingeln ran, als ich ihn fünf Minuten später auf der Fahrt zu Bettinas Wohnung anrufe. Ich vereinbare einen Termin für eine ganztägige Session. Kommenden Mittwoch in seinem Studio. Ich war schon ewig nicht mehr dort und muss endlich die Nummer für den DJ als auch die Schlagerscheiße und noch zwei andere Kleinigkeiten aufnehmen.
Ich habe kein eigenes Studio. Besitz belastet.
Bettina sieht unglaublich aus, aber ich kann erkennen, dass ihr nicht ganz wohl ist bei dem, was sie mir da antut. Mit dem Öffnen der Beifahrertür ist mein heutiges Schicksal besiegelt.
In dem Moment, in dem wir die Ortseinfahrt des hübschen kleinen Münchner Mittelklassevorortes passieren und nur noch wenige Minuten vom Ziel entfernt sind, wünsche ich so intensiv, ich wäre tot, dass Bettina es an meinem Gesichtsausdruck abliest. Vorwurfsvoll sieht sie mich an.
›Nie wieder, nie wieder, nie verfickte Scheiße wieder‹, versuche ich mich selbst zu beruhigen, als ich Inga-Marie und Arnold Peters, die schon winkend in der Tür ihres idyllischen Häuschens warten, munter die Hand zur Begrüßung reiche. Mustermann und Musterfrau, wie aus dem Katalog. Zum Kotzen. Stattdessen erkundige ich mich artig nach dem allgemeinen Befinden, antworte brav auf ihre Fragen (»Ja, ganz prima!«, »Echt? Toll!«) und versuche – zum Ausgleich und um mich nicht vollends selbst zu verleugnen –, an die vorangegangene Nacht zu denken, in der ich Martina Held zum ersten Mal gefickt habe. (Martina Held. Nr. 26, ich nummeriere alle Kontaktanzeigenfrauen durch. Mein persönliches Köchelverzeichnis. 29 Jahre, Verwaltungsangestellte, drei Dates.) Leider muss ich auch sofort daran denken, von welch einfacher Natur sie ist (Lieblingssänger: Eros Ramazotti und James Blunt, Lieblingsfilm: Pretty Woman, Stofftier am Rückspiegel, Selbstbeschreibung am Telefon: »Ich sehe jünger aus!« – klar, das tun wir alle), was mich schnell wieder aus meinen Gedanken zurück ins Pärchenparadies holt. Ich habe mein Soll erfüllt. Dreimal ist genug. Der Hattrick des Grauens.
Wir sitzen zu sechst am perfekt gedeckten Tisch auf der Terrasse. Fünf gut gelaunte, erwartungsfrohe Menschen und ein Häuflein Elend, das nichts mit den anderen gemein zu haben fühlt und sich weit weg wünscht. Konversation. Die Selbstgefälligkeit der gemeinsamen Meinungen und Ansichten, die eingespielte Paare ausstrahlen, lässt mich das ganze Ausmaß der Trostlosigkeit erkennen, welches ich mit ihren Leben verbinde. Oder mit meinem. Und dann dieses lächerliche Schmierentheater, das Bettina und ich hier abziehen. Es ist auf gewisse Weise das Abseitigste, was ich je gemacht habe. Mir schläft ein Bein ein und ich verändere meine Position.
Ohne den geringsten Anflug von Durst setze ich mein Glas an den Mund und es beschlägt von innen. Erschrocken stelle ich es wieder auf den Tisch. Hat niemand bemerkt.
Die ganze Zeit über exerziere ich meinen Langzeitversuch durch, bei jeder einzelnen Antwort, die ich gebe, nämlich: Beim Lügen nicht zu blinzeln. Nicht ein einziges Mal die Augenlider bewegen. Die gesprochene Sprache von der Körpersprache abkoppeln. Klingt leichter, als es ist.
Ich werde immer besser. Am Anfang ist das noch ein wenig so wie Ja-sagen und den Kopf schütteln, oder Nein-sagen und nicken. Aber mit etwas Übung …
Gleich habe ich wieder Gelegenheit, mich zu schulen.
Arnold, … Alfred Albert Adolf Achim Albrecht …, nein, schon Arnold deutet gerade was an. Will aber mit der Sache noch nicht rausrücken. Er will gebeten werden, es zu verraten. Mit nach oben gewendeten Handflächen zuckt er listig mit den Augenbrauen und fragt: »Das wüsstet ihr wohl gern, hm?« Nö, nicht so unbedingt. Ich spiele mit: »Na sag doch mal, wie das gehen soll. Jetzt wollen wir’s aber wissen.« Bei mir: kein Blinzeln. Nicht ein einziges. Mein Lächeln gerät nicht mal ins Flackern. Es hilft, dass ich mir währenddessen überlege, warum elf nicht einzehn und zwölf nicht zweizehn heißt. So wie dreizehn und vierzehn logischerweise auch.
Arnold, … Alfred Albert Adolf Achim Albrecht …, nein, schon Arnold weiht uns in sein Geheimnis ein. Ich starre ihn an. Weil ich nicht zugehört habe, sage ich im Anschluss – ohne zu blinzeln: »Ach, so wird das gemacht!«
Kein Wimpernschlag! Meine Augen trocknen fast aus. Übung macht den Meister.
Pit bekommt ein eigenes Hauptgericht serviert. Ein Vegetarier, wie er im Buche steht. Eine Frage der Ehre. Er könnte natürlich aus reiner Höflichkeit das Fleisch einfach kommentarlos stehen lassen und sich mit den Beilagen begnügen. Aber das wäre zu simpel gedacht. Vor allem aus Sicht der Gastgeber.
Pit hat eine runde Nase, merke ich gerade. Und Seezungenfilet. Also Fisch als Extrawurst. Ich stoße mir das Knie am Tisch.
»Noch etwas Salat?«, fragt Inga-Marie in meine Richtung. Ihre schrille Hyperbesorgtheit sengt mein Trommelfell an und macht es an den Rändern ganz fransig. »Oh ja, bitte«, sage ich echt und identisch grell und nicke nonchalant in ihre Richtung. Und hättest du vielleicht noch ’ne Packung Valium, Inga-Marie?
Inga-Marie.
Ist doch wahr, Doppelvornamen sind noch bescheuerter als Doppelnachnamen.
Für einen ganz kurzen Augenblick der Erleuchtung schaudert mir bei dem Gedanken, dass die verkrampfte Beflissenheit der Anwesenden vielleicht nur bedeutet, dass sie sich noch mehr verstellen als ich. Und plötzlich weiß ich: Ich habe recht! Der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass sie es nicht bemerken, weil sie sich mit ihrer gestelzten Heiterkeit erfolgreich selbst betrügen.
Meine Hände schließen sich fester um das Besteck.
Um mich aufzumuntern, klinke ich mich so oft wie möglich gedanklich aus. Dabei halte ich aber immer Blickkontakt und tue, als würde ich mich völlig auf die Unterhaltung konzentrieren. Ich versuche mir vorzustellen, wie sich die drei Frauen gegenseitig mit Schlamm einreiben und in den Schwitzkasten nehmen. Nackt. Und sehe sie dabei lächelnd an. Dann stelle ich mir die Frage, ob die geleckt aussehende Kim Michalskie, eine adoptierte asiatische Muschimaus (obligatorische O-Beine inklusive), wohl gut abgeht im Bett. Und sehe sie dabei lächelnd an. Als sie zurücklächelt, wird mir klar: Nein, auf keinen Fall. Und dann stelle ich mir trotzdem vor, wie ich unanständige Sachen mit ihr mache. Und lächle dabei ihren erbärmlichen Freund Pit extra lieb an. Aber es hilft alles nichts. Ich bin immer noch da. In trauter Runde. Und dann sehe ich Bettina lächelnd an. Und werde ganz ernst. Weil es mir leid tut, dass ich so ein gefühlloser Wichser bin.
Nachdem sich die drei Frauen kurz ins Haus verziehen, bleiben wir Männer (wir Männer! Hilfe!) auf der Terrasse zurück. Handgeflochtene Korbsessel und violette Abenddämmerung. Das Gespräch mit Arnold (34, ein Jahr älter als ich) und Pit (zweieinhalb Jahre jünger) macht mir klar, dass es für sie keine Zukunft mehr gibt. Sie sprechen über den rabattoptimierten Kauf von Designerstühlen fürs Esszimmer, Hypotheken und Eigentumserwerb, Kinderwunsch, ihre Karriereaussichten in der Firma und und und. Und sie meinen das alles ernst und es macht ihnen sichtlich Spaß, darüber zu reden. Es erfüllt sie. Was sie sagen, klingt zwar nach Zukunft, wirkt aber wie ein längst ausgetretener Trampelpfad voll verbrauchter Worthülsen. Und ich komme mir vor wie ein kleiner Junge, der den Erwachsenen beim Tischgespräch zuhört. Ich verstehe kein Wort. (Ich will zum Kindertisch. Gibt’s nicht.) Höllen prallen aufeinander. Ich sage »Ja, absolut« in den verschiedensten Variationen. Mein einziger Trost, mir vor Verlorenheit nicht sofort in die Hosen zu pissen, ist, dass ich wahrscheinlich zehnmal mehr als diese beiden Arschgeigen verdiene. Was für mich zu wissen immer besonders wichtig ist, da sich mein Selbstwertgefühl sonst vollends aufzulösen droht.
Eine Uhr schlägt gedämpft neun. 21 Uhr. Erst! Ich drehe meinen Kopf suchend nach rechts, schaue durch die geöffnete Glastür ins Wohnzimmer. Da! Sie haben sogar eine Standuhr. Das ist zu viel.
Unmittelbar bevor mir auffällt, dass man sogar zu Selbstmitleid in der Lage ist, wenn man sich selbst nicht leiden kann, beiße ich mir in die Zunge. Ich muss weg hier. Mein mir vertrautes Außenseitergefühl schmerzt klaustrophobisch in der Nähe jener beiden Halbtoten so sehr, dass ich aufstehe, reingehe und Bettina dränge aufzubrechen. Sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Ich bin nicht mehr bereit, meine Lebenszeit für solch einen Unsinn verrinnen zu lassen. Mit diesen Zombies.
Wir stehen in der Küche. Sie ist gekränkt, beleidigt und aggressiv in einem. Ist mir egal. Sie sieht auf ihre Armbanduhr, verschränkt die Arme, nimmt sie wieder auseinander. Von draußen hört man die ausgelassenen Stimmen der anderen, jemand ruft lachend: »Das war ich nicht.« Gelächter. Bettina weiß, dass Überredungsversuche aussichtslos sind. Ich habe den gewissen Punkt überschritten und bringe den Abend zu seinem logischen Ende.
Schweigend fahren wir heim und ich setze sie bei ihr zu Hause ab. Ihr böser Blick in meine Richtung trifft nicht. Ich überlege, was ich mit dem angebrochenen Abend noch anstellen könnte, brauche dringend einen Ausgleich und rufe Dana an (Dana Wennland, Nr. 29, 33 Jahre, Bürokauffrau, fünf Dates, mag Anastacia, die Toscana, Bollywoodfilme, After-Work-Partys und faulenzen. Beeindruckend), treffe mich 22 Minuten 14 Sekunden später mit ihr, bin so zerstreut und abgelenkt, dass ich keinen hoch bekomme, was auch daran liegen kann, dass wir zu lange vorspielmäßig rumgeschmust haben, denn zu langes Zärteln vermindert den finalen Ständer, mache also kurz und knapp Schluss mit ihr, als mir klar wird, dass dies heute auch nichts mehr wird, verkneife mir, ihr die Schuld für meine misslungene Erektion in die Schuhe zu schieben, Frauen glauben so etwas ja manchmal tatsächlich, mache mich aus dem Staub und amüsiere mich bei dem Gedanken, dass sie sich nun wenigstens vormachen kann, meine Versagensscham wäre der Grund für mein schändliches Verhalten. Dabei hätte ich so oder so Schluss gemacht, da ich kein Interesse mehr an ihr habe. Und so wird sie zur Leidtragenden meines Wiederherstellungsprozesses, nachdem meine Widerstandsfähigkeit unter dem vorangegangenen Kurztrip in den Garten Eden der Normalen und Anständigen gerade so gelitten hat. (Einzig peinlich gegenüber Dana ist mir nur, dass in der Steaksoße vorhin Knoblauch war.)
Es ist mittlerweile halb eins, als ich aus Danas Wohnung komme und zu meinem Wagen gehe. Die Zeit, zu der ich fast jede Nacht ins Auto steige und einfach losfahre. Im Gehen, Taschencheck. Geldbeutel, Schlüssel, Handy, alles da. Nicht dass ich noch mal zurückkommen muss. Ich fahre ziellos durch die Stadt und steuere irgendwann in Richtung Autobahn. Endlich beruhige ich mich ein wenig. Gedankensplitter. Schwarzer Himmel. Das blaue Schild mit dem Autobahnsymbol fliegt vorbei. Langsam stellt sich Ruhe ein. Der Kontrast zwischen der Geschwindigkeit und der lautlosen Stille der Nacht erfüllt mich mit meiner chronischen Melancholie.
Sie schnürt mich ein.
Und im Wirrwarr der Leere nehme ich es ganz deutlich in meinem Inneren wahr. Das Nichts. Das Vakuum. Mein Unvermögen, irgendetwas zu spüren, was nicht wieder nur ich selbst bin.
Die Fliege, die an meinem Kopf vorbei summt, muss mit mir eingestiegen sein. Ziemlich schnell fliegt sie vom Armaturenbrett zum Beifahrersitz, zum Lenkrad und zurück. Ich versuche erst gar nicht, nach ihr zu schlagen. Ich fahre das Fenster etwas runter, in der unsinnigen Hoffnung, sie würde von allein durch den Schlitz verschwinden. Schwüle Luft weht herein. Rechts ist Nordnordwest.
Die wenigen vorbeiziehenden Lichter in der Dunkelheit rufen mir ins Bewusstsein, wie ausnahmslos die Einsamkeit der einzig wirklich entspannende Zustand für mich ist. Diese Momente selbst gewählter Isolation sind meine Batterie. Der Idealzustand. Auch wenn er mir gleichzeitig ständig den Eindruck vermittelt – selbst jetzt –, als würde ich was verpassen.
Alles andere ist nur die Rahmenhandlung. Die lästige Pflicht des Tages vor der nächtlichen Kür.
Nachdem ich eingeparkt und den Motor ausgeschaltet habe, bleibe ich noch sitzen und höre einen Song zu Ende. Zum zweiten Mal hintereinander Nr. 10. Den Namen kenne ich nicht, weil ich mir nur noch CD-Indexnummern merke und eine Titelzeile aus dem Refrain nicht zwingend hervorgeht. Eigentlich konzentriere ich mich auf die Stimmung, die die Musik umgibt, und versuche, etwas zu fühlen. Der Song selbst ist gar nicht so stark.
Abwesend bemerke ich, dass nur die Hälfte der Leuchtstoffröhren in der Tiefgarage automatisch angegangen sind. Die Luft im Wagen steht. Caruso, die nervtötende Fliege, summt in F-Dur an mir vorbei und landet auf der Fensterlehne. Ich kann nicht widerstehen und schlage nach ihr. Hab ich doch gesagt, chancenlos. Ich schalte die Anlage mit dem Schlussakkord aus. B-Dur. »So«, sage ich, um mich selbst zu hören. Und komme mir wie mein eigener Doppelgänger vor. Im Anschluss murmele ich: »Alles wirkt so … willkürlich.« Was mich auch nicht weiterbringt. Noch im Aussteigen kratze ich eine Stelle meines Rückens, die ich nicht ganz erreichen kann. Dann seufze ich äußerst sachlich. Gebe auf. Auch weil ich fürchte, ich könnte mir sonst die Schulter verrenken. Weil ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll, zucke ich elend mit den Achseln, als ob durch diese Bewegung mein Hemd den Juckreiz beseitigen könnte. Mir zwingt sich kurzzeitig das Bild von Balu dem Bären auf, wie er genüsslich seinen Rücken an einem Baum reibt.
In dem Moment, in dem die Tiefgaragenbeleuchtung erlischt, halte ich inne, und es formt sich in mir der Satz: Selbsthass wird gemeinhin unterschätzt. Aber da er etwas Unvollständiges hat, vergesse ich ihn sofort wieder. Weg ist er.
Dann nehme ich die Treppe und nicht den Aufzug,
121 Stufen,
weil ich wahnsinnig Pipi muss. Denn wenn ich gerade jetzt zum ersten Mal im Lift stecken bleibe …
Als ich den Fernseher einschalte und mich in den Sessel setze, ist es kurz nach zwei. Ich tippe Kanal 23 in die Fernbedienung. Noch bevor sich das Bild vollständig aufbaut, höre ich bereits den Ton, erkenne Melanies Stimme und bin beruhigt, dass sie heute tatsächlich moderiert – und nicht eine ihrer dauerbrüllenden »Money Quizz«-Kolleginnen mit Prollcharme. Die Wucht ihrer Anmut haut mich erwartungsgemäß um, während sie freundlich einen Anrufer (Kalle aus Köln) abfertigt, der das Worträtsel, das auch jeder geistig Minderbemittelte zügig als »Paderborn« auflösen könnte, mit »Pandabär« beantwortet. Gebannt starre ich Melanie an. Eine Göttin. Ihre Augen, ihr Gesicht, ihre Schultern, schalte den Ton nach einigen Sekunden ab und komme mir vor wie ein pubertierender Volltrottel. Nach nur zwei Minuten muss ich ausschalten. Das Ausmaß ihrer Schönheit erschüttert und erschöpft mich. Ich weiß nichts damit anzufangen. Ähnlich einem perfekten Song, einem architektonischen Meisterwerk, einem genialen Bild oder einem beeindruckenden Naturschauspiel vergegenwärtigt mir Schönheit (egal welcher Art) lediglich die Erkenntnis, dass ich nichts davon abbeißen kann. Dass sich ein Moment nicht festhalten lässt. Dass sich nichts festhalten lässt.
Und so verwandelt sich Schönheit schließlich unausweichlich in einen seelischen Abgrund, der mir die Endlichkeit aller Dinge vor Augen führt. Und sonst nichts.
Ich. Kann. Schönheit. Nicht. Ertragen. Weil sie mich erschlägt.
Und darum gehe ich ins Bett. Um beschissen zu schlafen.
Am Tag darauf. Meine Gemütslage tendiert zu nervöser Gleichmut. Nachdem ich heute aufgestanden bin und mit noch viel zu aufrechter Morgenlatte pinkeln ging, mich dazu hinsetzte und in so absurdem Winkel nach vorne beugen musste, um nicht vorne an der Keramik anzustoßen, darüber selbst lachen musste, dann zurück ins Schlafzimmer wankte, um zu lüften, und im Raum riechen konnte, dass ich schlecht geschlafen hatte, ebenso wie ich riechen kann, wenn ich gut geschlafen habe, ich mir mal wieder zustimmen musste, dass man viel schneller in die Gänge kommt und weit weniger verknautscht aussieht, wenn man wenig geschlafen hat, eine Stunde lang joggte, anschließend etwas unmotiviert Klavier spielte, vergeblich einen Song aus mir rauszuquetschen versuchte, zwei maue Verse (einen davon mit Bridge) ausspuckte, 20 Minuten Umkleide- und Schlafzimmerboden wischte, das grüne Schwammtuch für die Küche gegen ein neues, blaues austauschte, wieder nur wenige Sekunden auf MTV durchhielt (die Moderatorin mit unappetitlich seitlich abstehendem Haarwirbel brachte in nur einem Satz die Worte »Sekündchen«, »Oopsala« und »Schwuppdiwupp« unter und führte mit offenstehendem Mund eine bühnenreife Wyclef-Jean-Parodie auf; wo ich doch nur die Premiere des neuen Korn-Videos sehen wollte) und dann duschte – rief Bettina an und sagte, sie möchte mich heute Abend um acht treffen. Abgesehen von ihrem schwer zu durchschauenden Tonfall ist das ungewöhnlich. Normalerweise liegen mindestens eineinhalb Wochen zwischen unseren Verabredungen. Mindestens. Sie hat nichts angedeutet, ließ sich auch nichts anmerken, aber ich sehe es im Bereich des Möglichen, dass sie heute Abend mit mir Schluss macht. Was sehr für ihren Anstand sprechen würde, denn sie könnte mich ja auch telefonisch abservieren. Andererseits bin ich nicht sicher, ob das misslungene Grillfest gestern solche Konsequenzen nach sich zieht. Ich jedenfalls habe diese Aktion schon längst wieder verdrängt.
Ich sitze am Schreibtisch. Computer läuft. Der Bildschirmschoner schaltet sich gerade ein. Das Microsoft-Symbol knallt gegen den linken Bildschirmrand, prallt ab und gleitet weiter. Schwebt durch die schwarze Fläche nach oben.
Die Stimme von Judith Haas (Neu-Akquise, 28 Jahre, Nr. 38), die ich gerade am Telefon habe, klingt wie die der Riesen im Hörspiel »Gullivers Reisen«. Langsamer abgespielt, um diesen behäbigen Zeitlupeneffekt der Stimme zu erzielen. Was nicht unbedingt nahelegt, dass sie eine Schönheit ist. Aber (a.) kann man sich da irren und das will ich nicht riskieren und (b.) sollte sie tatsächlich nicht sonderlich attraktiv sein, greifen dann die Argumente ›dankbar‹ und ›schnell gepflückt‹. Kann man ja mal nebenbei durchziehen.
Die bisherigen Anzeigenbekanntschaften sind rein äußerlich (und nur das) eigentlich alle mehr oder weniger akzeptabel. Zumindest für meine Absichten.
Judith hat ganz schön schnell zurückgerufen, denke ich mir, während ich mit dem Kuli spiele, mit dem ich mir vereinzelte Notizen zu ihrem Geschwalle mache. Leise mitschreiben, damit man’s nicht hört. Was sie mir in Kurzform über sich und ihr gewöhnliches Dasein erzählt, ist von ausgesuchter Belanglosigkeit, dargebracht in einem Tonfall äußerster Temperamentlosigkeit. Die Lebendigkeit ihres Erzählstils macht mir das Wachbleiben schwer. Ihr zuzuhören hat was von Pfahlsitzen. Unfreiwillig schlucke ich die ganze Zeit.
Sie ist genauso unterbelichtet wie erwartet. Ich glaube, ich habe schon gewonnen und sie überzeugt, sich mit mir zu treffen. Womöglich deshalb lasse ich gerade konzentrationsmäßig etwas nach und mir fällt einfach so auf, dass Whoopie Goldberg eine verblüffende optische Ähnlichkeit mit Nile Rodgers von Chic aufweist. Weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf komme. Die ganze Welt besteht aus nichts als Replikationen.
Schrring. Ich nutze den Moment und schieße mein tägliches Handyfoto von mir. Das Motiv: Ich, mit Festnetzhörer am Ohr.
»Und was machst du in solchen Fällen?«, fragt sie nach irgendwas. Ich schrecke auf, versuche ihr Gerede zurückzuspulen und schlusszufolgern, um was es gerade geht, sage »Ja« und versuche, überzeugend zu klingen, als würde ich es wirklich meinen. Dann stelle ich fest, dass meine Antwort nicht unbedingt Sinn macht. Macht nichts. »Ja«, sage ich nochmals – mehr zu mir als zu Judith – und überlasse ihr die Deutung.
Erst vorgestern sprach ich ihr meinen üblichen Text auf die Mailbox. Ich haue diesen Standardspruch – mit minimalen Anpassungen an die individuellen Erfordernisse (Hobbys, Nichtraucher, Tierliebe, Vorleben, moralische Schwerpunkte) – jedem Opfer um die Ohren.
Ein sorgsam ausgeklügeltes Werk küchenpsychologischer Cleverness. Kurz, prägnant, mit gebildet klingenden Zwischenformulierungen (Stichwort: Niveau!) und die Kunstpausen und Atmer markiert, damit es so rüberkommt, als würde ich frei sprechen. Aus dem Stegreif. Funktioniert meistens.
Ich beackere hauptsächlich Telefonannoncen. Und wenn mir die ausgehen, dann greife ich auf die klassischen, brieflich zu beantwortenden Anzeigen zurück. Internetforen lasse ich komplett außen vor, da Kontakte dort zu bearbeiten zu zeitaufwendig und oft zu unverbindlich ist. Und somit deutlich weniger Erfolg versprechend. Der Anteil an indiskutablen Frauen für meine Versuchsreihe ist im Netz außerdem noch höher. Zu hoch. Und auf noch mehr Zeitverschwendung habe ich keine Lust.
»Ja, das würde mich sehr freuen«, sage ich gedehnt und beweise ihr damit, dass ich einfach nicht lügen kann. Das hätten wir, die Sache läuft. Sie hat angebissen. Judith und ich verabreden uns für nächste Woche. Sonntag, 19 Uhr. Blabla, ja bis dann, jaja, tschau. Meine Güte, dass niemand bemerkt, was für ein verlogener Heuchler ich bin.
Ich stupse kurz die Maus an, der Bildschirmschoner verschwindet, ich tippe meine eben gemachte Mitschrift in die »DAN«-Datei ein (45 Sekunden, speichern, schließen).
Kurz bevor ich aufbreche, beantworte ich noch die E-Mail eines Plattenfirmenheinis von gestern, der mir mitteilt, ich könne die gerahmte Goldene CD (nur Kleingeister hängen sich so was auf), die ich für einen Singlehit in Skandinavien verliehen bekomme (was bedeutet ›Gold‹ in Skandinavien? 250 verkaufte Einheiten? Und was bedeutet Skandinavien? Gehört das versoffene Finnland nun dazu oder nicht?), für 48 Euro über die Plattenfirma bestellen.
Versehentlich sende ich meinen schnell hingetippten Kommentar »Mein Gott, was für knauserige Wichser! Gruß, Peter« nicht als Weiterleitung an meinen im ›Cc‹ befindlichen Co-Producer-Kollegen, sondern direkt an ›Alle‹, bemerke meinen Fehler exakt im Moment des Absendens und erfreue mich an dem Gedanken, ab sofort von mindestens einer Person aus dem Musikbusiness nie mehr mit Anfragen belästigt zu werden.
Es ist 14 Uhr 47, brüllend heiß. Bin in sechseinhalb Minuten am Ziel. Mein Blinker klickt heute besonders laut. Zumindest kommt es mir so vor.
Ich befinde mich gerade in einer 50er-Zone, der Lieferwagen vor mir fährt dennoch konstante 30. Aber ich bleibe ruhig.
Die Firmenadresse auf der Heckklappe zeigt noch eine vierstellige Postleitzahl. Das ist alt. An die fünfstelligen Postleitzahlen habe ich mich damals extrem schnell gewöhnt – die neuen Bundesländer hingegen sind für mich immer noch DDR.
Jetzt schaltet die hundert Meter entfernte Ampel auf rot, aber der Lieferwagen fährt unbeirrt mit seinen stoischen 30 km/h weiter. Voll bei rot drüber. Roboterhaft, wie ferngesteuert. Fasziniert sehe ich ihm nach, während ich selbst an der Haltelinie stehen bleibe. Ich unterlasse es natürlich, ihn per Lichthupe auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Wer bin ich denn? Jesus? Womöglich hält er mich sonst auch noch für bevormundend.
Er hat Glück, dass kein Wagen von links oder rechts seinen Weg kreuzt und ihn aufspießt. Ich habe noch nie einen Unfall live gesehen. Dafür wurde ich als Kind Zeuge, wie ein kleines Privatflugzeug dreihundert Meter vor mir in einem Waldstück abstürzte. Mein Mund klaffte auf, eine nicht näher beschreibbare chemische Reaktion vernebelte mein System und ich fühlte etwas übermenschlich Elementares. Dann ging ich heim. Abendessen.
Der Lieferwagen fährt und fährt. Gleich hole ich ihn wieder ein. Er weiß wohl gar nicht, was gerade passierte. Beziehungsweise, was nicht passierte. Oft wundere ich mich sowieso darüber, dass nicht mehr passiert. Ein ganz schlimm überstrapazierter Spruch, der aber nichts an Wahrhaftigkeit verliert, auch wenn ich ihn mir noch tausendmal wiederholen würde.
Ich parke vor dem kleinen italienischen Restaurant, in das ich oft essen gehe. Ein »Durchgehend geöffnet«-Schild ist für mich das Schönste und lässt mich ein Lokal bedeutend leichter in mein Herz schließen, da sich meine Essenszeiten von denen des gemeinen Volkes unterscheiden. Ich nehme mein Mittag-Schrägstrich-Abendessen kombiniert meist zwischen 15 und 16 Uhr ein. Wenn ich nicht abends eine Frau klarmachen muss oder ein Geschäftsessen mit irgendwelchen Businesslachnummern habe.
Als ich wenig später die verglaste Holztür des heute unerwartet dunklen Lokals öffne, knarzt sie so laut, dass ich meinen Kopf schuldbewusst einziehe. Aber niemand nimmt von mir Notiz. Bei dem hochnäsigen Möchtegernmafioso – der einfach nicht freundlicher wird, egal wie oft ich auch hierher komme – bestelle ich eine Pizza des Hauses, wie immer zwei Salate (»Ja, zwei. Hmm, genau, zwei. Ja, also einen noch extra dazu. Ja, zwei.« Jedes Mal dasselbe Theater), Brot, eine Cola Light (ohne Eis, die Zitrone fische ich selbst raus und werde heute nicht darauf rumkauen) und einen doppelten Espresso.
Mein Handy liegt zu Hause. Habe es vergessen. Passiert höchstens einmal im Jahr. Dieses Gefühl, gerade nicht erreichbar und somit von der Welt abgeschnitten zu sein, ist mit Verzweiflung noch milde beschrieben.
Ich nippe an der Cola, ist das denn die Möglichkeit, ich bin niedergeschmettert, es ist eine Pepsi Light, keine Coca Cola Light, ich betrachte das als persönliche Beleidigung, schneide meine Pizza an, nehme mein auf die richtige Seite geknicktes Buch und rücke es zurecht, sehe mich noch einmal im Raum um, schaue rüber zu den beiden Verliebten am Tisch gegenüber, die nebeneinander und nicht sich gegenüber sitzen und die sich so ähnlich sehen wie Bruder und Schwester, was ich ekelhaft finde, dann auf die Kerze an meinem Tisch, die nervös flackert, obwohl kein Lüftchen weht, weiter zu einem anderen Pärchen, hinten in der Ecke, die Händchen halten und noch nicht wissen, dass sie nicht zueinander passen, sie flüstern sich dauernd Sachen zu, Flüstern ist noch schlimmer als Schmusen, ich schwenke rüber zu der alleinstehenden Südamerikanerin, die aussieht wie ein Model für abstoßende Postkarten und die am Handy zu laut erzählt, wie das Wetter hier ist (nur einen Satz solch nutzloser Information mehr und das europäische Mobilfunknetz implodiert auf der Stelle), beobachte, wie der Kellner unbedeckt in die Luft hustet, als er zwei Teller an einen Tisch bringt, bin froh, dass das nicht mein Essen ist, bemerke, dass die Tür jetzt nicht ächzt, als ein neuer Gast eintritt, dafür das Flackern meiner Kerze plötzlich komplett aufhört, führe die Gabel zum Mund, finde, dass die Pizza gut schmeckt, und beginne zu lesen. Mein Rückzug ins Ich.
Etwas Befremdliches liegt in der Luft, als Bettina um Punkt acht in die Wohnung tritt. Ich kann nicht ignorieren, dass sie anders als sonst ist. Ich hatte erwartet, sie wäre sauer wegen gestern, aber sie ist viel profunder anders. Sie trägt ein helles Sommerkleid und ihre Haare hochgesteckt, lächelt mich kurz an und geht wortlos durch ins Wohnzimmer. Was etwas übertrieben zu sachlich ist, obwohl wir uns nie mit Kuss begrüßen. Das hab ich gar nicht erst einreißen lassen, das liegt mir nicht. Alleingelassen mit der Klinke in der Hand schaue ich noch mal vom leeren Gang in den Wohnungsflur, fasse mich aber gleich wieder. Nachdem ich die Türe leise geschlossen habe (was ich mit allen Türen tue, da ich nicht von Nachbarn oder sonst jemandem wahrgenommen werden will), folge ich ihr, biege aber in die Küche ab, während sie geradeaus weitergeht und auf der weißen Couch im Wohnzimmer Platz nimmt. Beide Räume sind, leicht versetzt, nur durch einen Mauerbogen voneinander getrennt.
»Ist alles okay bei dir?«, frage ich bemüht locker um die Ecke, ohne direkten Blickkontakt, während ich einen Wandschrank mit der Spitze meines linken kleinen Fingers öffne, um keine Fettabdrücke zu hinterlassen. Ein verinnerlichter Bewegungsablauf. Auch Türklinken betätige ich nur so.
»Ja, bei mir ist alles in Ordnung«, antwortet sie mindestens ebenso bemüht. »Wieso?«, fährt sie bedauerlicherweise fort, was verrät, dass sie meinen Tonfall zu deuten weiß. Das klingt nicht gut. Eindeutig beleidigt oder nachtragend oder zickig oder vorwurfsvoll – alles könnte ich nachvollziehen. Aber das? Ich entscheide, eine Antwort durch die Frage, ob sie etwas trinken will, zu ersetzen. »Nein, danke, lass uns doch noch ein bisschen weggehen«, antwortet sie, jetzt etwas entspannter. »Okay, ich nehm mir nur noch ’ne Cola«, entgegne ich, meinen Kopf dabei in Richtung Wohnzimmer neigend – was wohl meine akustische Verständlichkeit verbessern soll (0,004 dB?) –, und nehme die Coca Cola Light (0,5 l) aus dem Regal. Zimmertemperatur. Kalt schmeckt alles nur nach kalt. Ich stelle dabei fest, dass ich gerade überhaupt keine Cola will (wäre heute schon meine dritte) und nur in der Küche stehe, weil ich mich nicht gleich zu ihr setzen möchte. Als ich in das Fach mit den Gläsern greife, um eins herauszunehmen, wundere ich mich, wofür ich all das Geschirr eigentlich besitze. Ich benutze immer nur das jeweils oben liegende Teil. Also nehme ich eigentlich gerade nicht ein Glas aus dem Schrank, sondern das Glas. Das, welches ich immer nehme und dann im Anschluss per Hand abspüle und sauber zurückstelle. Exakt so verhält es sich mit den Löffeln, klein wie groß, den beiden Messern (insgesamt habe ich allerdings zehn) und den beiden Gabeln (ebenfalls zehn), Tellern und so weiter. Was für eine Verschwendung. Daran, dass ich auch keine Töpfe oder Kochutensilien benötigte, da ich immer auswärts esse (ich gehöre zur Gruppe der Heavy-Gastronomy-User), aber alle in kompletter Ausführung besitze, darf ich gar nicht denken. Mit meinem kleinen Finger kratze ich mich kurz am Sack, was keine Konsequenzen haben dürfte, da sowohl Hose als auch Sack sauber sind. (Habe gerade eben zum zweiten Mal heute gebadet. Ich weiß ja nicht, ob Bettina vielleicht doch nicht mit mir Schluss macht. Und dann könnte es ja sein, dass …)
Mit dem Ansatz eines forschenden Lächelns lasse ich mich auf den Sessel links von Bettina fallen und finde bestätigt, dass sie eigenartig unsicher und gleichzeitig aufgedreht wirkt. Nur keinen verdammten Hauch so, wie ich es nach gestern erwarten dürfte. Eigentlich wollte ich majestätisch in den Sessel gleiten, aber schlagartig vergeht mir jegliche Lust auf Eleganz.
»Und, hast du dich von der Katastrophe schon erholt?«, fragt sie und spielt damit endlich auf gestern an. Der höhnische Unterton verleidet mir jetzt doch alles.
»Ja-ah, hab ich wohl. Diesmal war’s aber auch etwas ganz Besonderes.« Dabei nicke ich ohne Unterlass. Im Kontext der ungewohnt steifen Stimmung steht mir meine anklingende Ironie überhaupt nicht. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Vertrautheit damit unwiederbringlich dahin ist. Mit einem Schlag. Und die Wucht dieser Erkenntnis bestätigt sich zugleich. Wir schauen alles andere an außer uns.
›Nun sag schon endlich, das war’s! Sag schon, dass du das nicht länger aushältst. Dieses konkubinenhafte Dasein auf Abruf. Ich verstehe sowieso nicht, wie du das sechs Jahre ausgehalten hast.‹ Ich versuche zu erkennen, ob sie meine Gedanken gehört hat. Die Arme auf ihren Knien aufgestützt und wie um Anlauf für den nächsten Satz zu nehmen, schweifen ihre Augen durch das Zimmer. Über die Möbel und kurz durch die große Glasfront hinaus über die Dachterrasse, auf der keine Sitzgelegenheit steht, da meine innere Unruhe es nicht zulässt, in der Sonne rumzuliegen. Die clean wirkende Wohnung findet sie seit jeher unbehaglich. Spärliche Einrichtung, keine Accessoires, nur das Nötigste. Keine Bilder. Sie ist das Gegenteil von ihrer Wohnung. Ich brauche diese Kargheit als Kontrast zu meinem getriebenen Innenleben. Ich kriege sonst keine Luft. In einer üppig ausgestatteten, lauschigen Behausung würde ich ersticken. Womöglich noch mit Wänden in Apricot, Kanariengelb oder Mintgrün. Schon Eierschalenweiß ist mir nicht weiß genug. Es gibt auch keine Pflanzen. Ich möchte nichts gießen müssen. Darin sehe ich überhaupt keinen Sinn.
Die für uns unnatürliche Gesprächspause hält an. Noch nicht peinlich, aber nah dran. »Du«, sagt sie endlich und zieht dabei das ›u‹ in die Länge, wie man es macht, wenn etwas Gewichtiges kommt, das lockerleicht eingeleitet werden soll.
»Hmm?« Ich versuche es wie ein entspanntes ›Ja‹ klingen zu lassen, verschlucke aber die zweite Hälfte und muss mich kurz räuspern, was leider mein Unbehagen enttarnt. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht tatsächlich die ganze Zeit mit meinem Kopf nicke. Mein Gott, ist das zäh. Ich suche nach Worten. Irgendwas. Ein halbes Lächeln. Ich greife zur Cola, überlege es mir dann anders. Kümmere mich elegant nicht weiter darum. Der angedachte Locationwechsel könnte dieses Trauerspiel vorerst entschärfen. »Wollen wir jetzt nicht erst mal irgendwo hingehen? Runter ins Kranz vielleicht? Hast du Lust?«, schlage ich bemüht heiter vor. Bettina nickt erkennbar erleichtert. Eigenartig zügiges Aufstehen, meine Cola bleibt unangetastet auf dem Tisch zurück, einen saloppen Griff nach der Jacke in der Garderobe unterbreche ich auf halber Strecke, da nicht nötig (draußen sehr mild), im Aufzug abwärts, als ich sie im Lift ansehe, bemerke ich, wie außergewöhnlich attraktiv sie mir heute vorkommt. Wahrscheinlich die Masche ›Schau dir noch einmal genau an, was du nie mehr haben wirst‹. 3 Minuten 2 Sekunden Gehzeit und wir sitzen in dem kleinen Lokal, Zweiertisch links hinten. Und los geht’s.
»Dirk hat Leberzirrhose. Es geht ihm wirklich sehr schlecht«, eröffnet mir Bettina, noch während wir uns setzen. Ich überlege kurz, dass sie mit dieser unerwarteten Nachricht aus ihrer Sicht heute gleich zwei thematische Knaller auf der Pfanne hätte, sollte sie mich anschließend noch in den Wind schießen.
»Was? Er ist doch erst, ähm, sieben-, äh, siebenundzwanzig, oder?« Kann Stottern kalkuliert sein? Meins schon.
»Er hat sich schon die letzten Wochen über so schlecht gefühlt und ist neulich zum Arzt gegangen und das kam dabei jetzt raus. Ja, also 28 ist er.« Dirk ist Bettinas Mitbewohner und Jugendfreund. Sie haben eine gemeinsame Wohnung, seit sie mit 19 von zu Hause auszog, und bilden bis heute eine Mini-WG. Dirk ist vollepulle schwul und arbeitet als Stricher. Und das aus Berufung. Ich kenne niemanden, der es so krachen lässt wie er. Er säuft wie ein Loch, nimmt Drogen aller Art und vögelt sich seinen Weg auch nach Dienstschluss durch die Welt, als gäb’s kein Morgen. Es gibt keinen Darkroom im Umkreis von hundert Kilometern, in dem er nicht Stammgast ist. Mir gegenüber hat er sich immer sehr freundlich, aber mit erkennbarem Vorbehalt verhalten, da er in mir wohl den Rohling sieht, der Bettina nur wehtut.
»Was darf ich euch bringen?« Die Bedienung, Ende fünfzig, passt überhaupt nicht in diesen stylischen Laden. Trotz herber Ausstrahlung verkörpert sie noch gut erkennbar eine Form von Schönheit, die früher auffallend gewesen sein muss. Ich kann nicht ausmachen, ob es sich bei ihrem schwer identifizierbaren Dialekt vielleicht um einen Akzent handelt. Mit zehn Zentimetern Abstand zwischen meinem Kopf und ihren Lenden steht sie eindeutig etwas zu nah neben mir. Ich sehe mit angestrengter Kopfhaltung zu ihr hoch, komme mir dabei blöd vor und bestelle, ohne bestätigenden Blickabgleich mit Bettina, einfach das Übliche. »Bitte einen Merlot, null Komma zwo, und für mich ein Wasser ohne Gas und ohne Eis.« Wow, stilles Wasser, lauwarm. Früher habe ich wenigstens Mineralwasser mit Kohlensäure genommen. Es wird immer toller. Ich bin eine Stimmungskanone. »Gern«, bestätigt die ehemalige Beauty-Bedienung und rauscht ab. Dabei knallt ihr schwerer Geldbeutel, der vertikal an ihrem Gürtel befestigt ist, im Schrittrhythmus gegen ihre Hüfte. Mit jedem Meter, den sie an Entfernung hinlegt, nimmt sie an Attraktivität zu. Die Zeit ist erbarmungslos, doch der Raum ist gnädig.
›Gern!‹ Das kann ich auch nicht mehr hören. Plötzlich war’s da. Jeder Bestellvorgang im Lokal oder beim Bäcker oder an der Fleischtheke wird mit ›gern‹ bestätigt.
»Dirk ist schon seit vorgestern im Krankenhaus. Du solltest ihn mal besuchen«, sagt Bettina.
»Ja klar.« Ja klar. Logo. Jetzt warten wir mal ab, ob du mich gleich abservierst, und dann sehen wir weiter. Ich entschuldige mich fahrig und gehe zur Toilette, ziehe dort mein Diktiergerät aus der Hosentasche und singe eine kurze Refrainidee auf. Wie meistens, ungeachtet der Umstände, kam sie einfach ungefragt daher. In diesem Fall zwischen den Worten Leber und Zirrhose. Jedes Mal wenn ich einen Melodieeinfall habe, während ich mit Menschen zusammen bin, muss ich darauf achten, dies geheim zu halten und meine Demoaufnahme unbeobachtet zu machen, da sonst zu Recht der Eindruck entstünde, dass ich gedanklich woanders bin. Oder nur halb bei der Sache. Als ich zum Tisch zurückkehre, merke ich, dass das Thema ›Dirk‹ durch ist.
Nach kurzem Geplänkel, in dem sie mir unter anderem von einem Kinofilm vorschwärmt, den ich unbedingt sehen muss und der durch ihre Begeisterung schon verloren hat, da er ihrer überschwänglichen Vorankündigung niemals entsprechen kann, folgt die kommenden eineinhalb Stunden die zu erwartende Auseinandersetzung mit unserem Ende. Eine sorgsam von Bettina durchdachte Vergangenheitsbewältigung unseres Verhältnisses. Während dieser Tour de Force teilt sie mir behutsam und liebevoll mit, dass es aus ist, sie an mir gelitten hat und es einfach nicht mehr geht mit uns. Es fällt mir schwer, zwischen zwei in mir konkurrierenden Gefühlsregungen zu wählen: (1.) Ich müsste eigentlich dafür sorgen, dass jemand, der so mit mir Schluss macht, niemals mit mir Schluss macht, und (2.) Tatsächlich, ich hätte vorhin nicht noch mal baden müssen. Ich entscheide mich für Nummer zwei.
Meine Kraft geht hauptsächlich dafür drauf, mich auf Bettina zu konzentrieren und nicht ständig dem Idioten am Nebentisch zuzuhören, der aussieht wie jemand, der eine Bombendrohung mit einem Herzsymbol unterschreiben würde und China wie Schiena ausspricht. ›Isch hab in Schiena Schemie studiert und mir dabei ne schronische Bronschieties geholt.‹
Ich sehe Bettina permanent in die Augen und bemühe mich, betroffen dreinzuschauen (ich möchte sie wirklich nicht durch meine Gleichgültigkeit verletzen). Ich bin innerlich so kaputt, dass ich mir nicht mal vormachen kann, erschüttert darüber zu sein, dass wir nie wieder das tun werden, was wir sechs Jahre lang getan haben (und dass ich nie wieder jemanden wie sie finden werde, der mir so ergeben ist). Und da Bettina auch noch den schönsten Busen hat, den ich kenne, hat sich das ja dann wohl auch erledigt. Bei diesem Gedanken allerdings merke ich, dass doch noch so etwas wie Traurigkeit aufkommt. Ich bin das Letzte.
Mittlerweile ein wenig durcheinander, gebe ich ihr bei unserer Verabschiedung vor dem Lokal noch einen Kuss auf die Wange, weil ich wahnsinnige Lust verspüre, ihre Haut zu berühren. Ein allerletztes Mal. Es trifft sie sichtlich unerwartet und ihr überraschter Blick beleidigt mich fast. Unpassende Aktionen sind meine Spezialität. Ebenso, wie alle Verbindungen mit meiner Vergangenheit zu kappen. Auf einmal bin ich mir nicht sicher, ob wir uns überhaupt je sympathisch waren.
Ich gehe die paar Meter zu meiner Wohnung und überlege, ob ich mich noch einmal nach Bettina umdrehen soll, lasse es aber. Frauen drehen sich nach Verabschiedungen komischerweise nie um, dabei hat so ein Winke-Winke etwas rückwirkend Entspannendes. Gut, vielleicht nicht unbedingt, wenn man sich gerade voneinander getrennt hat. Ich werfe einen prüfenden Blick auf meine linke Ferse, ob meine Jeans nicht versehentlich in den Schuh gerutscht ist. Zwischen Socken und Schaftkante. Das sieht unmöglich aus. Aber, alles gut. Sie hängt drüber. Dann selbe Prozedur mit dem rechten Fuß. Auch okay.
Meine Gesichtsmuskulatur ist vom kontrolliert Gucken total erschöpft. Alle 50 Adduktoren und Abduktoren hängen nur noch so in der Gegend rum. Ich schließe die Haustür auf, rufe den Lift und prüfe, während er kommt, zum heute vielleicht fünften Mal meinen Briefkasten. Das tue ich immer, wenn ich an ihm vorbeigehe. Ist ähnlich zwanghaft wie mein Abrufen von E-Mails. Er ist natürlich leer. Wenig verwunderlich, es ist Sonntag. Zwei Parteien aus meinem Haus haben an ihren Einwurfschlitzklappen »Stopp! Bitte keine Werbung«-Aufkleber angebracht. Die mit dem roten Ausrufezeichen. Diese Wichtigtuer. Solche Versager haben auch Stofftaschentücher mit Monogramm und lassen sich ihre Namensinitialen auf ihrem Kfz-Kennzeichen eintragen. Und Spezialisten, die zum Beispiel Andreas Vogel oder Gottfried Vilshofer heißen, bemerken vor lauter Profilneurose gar nicht, dass das bei ihren Namen nicht so günstig kommt. So ein »Stopp! Bitte keine Werbung«-Aufkleber käme bei mir nicht infrage. Ich freue mich über jede noch so überflüssige Postwurfsendung. Dass Vodafone und Alfonsos Pizzabringdienst an mich denken, beruhigt.
Gerade habe ich das auf dem Wohnzimmertisch zurückgelassene Glas abgewaschen und dabei in das mp3-File eines vorhin erhaltenen Instrumentals reingehört. Das Gesangsmelodiegerüst hab ich in meinem Kopf gleich mitkomponiert. Ich war ganz gut in Fahrt. Eine Hookline für eine technoide Electro-House-Nummer. Nur vier Sätze. Vier Zeilen, die sich dauernd wiederholen. Ist genau das Richtige für die Hohlköpfe in den Clubs. Musste lachen, als ich fertig war und daran dachte, dass die Party-Ecstasy-Schwachmaten da draußen wieder zu einem Song abfeiern werden, den ein Typ geschrieben hat, der es in einem Club nie länger als zwei Minuten aushält. Als ich merkte, dass ich das eigentlich gar nicht lustig finde, habe ich auch noch die Cola-Flasche ausgespült. Mach ich sonst nie.
Jetzt stehe ich vor dem Badezimmerspiegel. Vor dem letzten Zähneputzen des Tages ist die Reinigung mit Zahnseide zwingend. Aber ich finde keine Lösung, wie ich die vom Blut abgeschnürten Zeigefingerspitzen, an denen die Seide aufgespannt ist, vermeiden kann. Das ist durchaus dramatisch. Sie pulsieren äußerst schmerzhaft in Blaurot. Ich putze meine Zähne, bemühe mich, mit der Bürste nicht zu hart aufzudrücken, um den Schmelzabrieb im Rahmen zu halten. Verfalle aber nach kurzer Zeit wieder in meine natürliche druckvolle Haltung.
Anstatt mich mit dem auseinanderzusetzen, was mir Bettina eben alles an den Kopf geworfen hat, stelle ich mir die Frage, wie viele Kilometer Zahnpasta ich in meinem Leben bereits verbraucht habe. Und stelle es mir bildlich vor. (In meiner Fantasie kommt dabei das Weltall vor – und die endlose Pastenspur ist hellblau.) Spülen mit Mundwasser, Lippen einfetten und die Mundregion ist betti-fertig. Fühle mich wie ein sauberer Junge. Dann creme ich Gesicht und Körper sorgfältig ein, was ganz schön anstrengend ist, und ziehe einen langen Schlafanzug an (trotz Hitze), um das Bettzeug nicht zu beschmutzen. Ich traue mich ab jetzt nicht mehr, in den Spiegel zu sehen, weil mir lange Schlafanzüge definitiv nicht stehen. Da ich ein hochfrequenter Händewascher bin (zu oft, zu intensiv), creme ich mir – schon im Bett liegend – meine Hände ein (inklusive Unterarme). Dabei sehe ich aus wie Mama Walton (»Gute Nacht, John-Boy«). Jeder Mann, der sich die Hände eincremt, kommt dabei so tuntig rüber, dass dieser Vorgang der obersten Geheimhaltungsstufe unterliegt.
Es gleicht einer Tragödie, als mir noch etwas einfällt und ich gezwungen bin, den Nachttischstift in meine jetzt glitschigen Finger zu nehmen. Dann schlage ich mein Nachttischnotizbuch auf, das gleich neben meinem Nachttischdiktafon und dem aktuellen Nachttischroman liegt, und notiere eine catchy englische Songtitelzeile. »Don’t Say I Didn’t Warn You.« Und dann vermerke ich noch, nur für mich: Ich wünschte, ich wäre nicht, wer ich bin. Langsam klappe ich das Notizheft zu, drehe den Dimmer umständlich runter und lehne mich zurück. Dann mache ich verärgert das Licht wieder an, wiederhole den exakt gleichen Fluch von gerade eben (»verwichste Ficke«, na ja) und ergänze: Ich wäre gern wie ihr. Und während ich mir denke, dass ich dann wenigstens an denselben Stellen im Kino lachen würde wie die ganzen anderen Ärsche, die sowieso nur über Witze lachen, die sie schon kennen, und nicht immer an den Stellen, an denen komplette Stille im Saal herrscht, sinke ich wieder in meine beiden Kissen. Ohne Bettina. Ich hätte nicht noch einmal baden müssen.