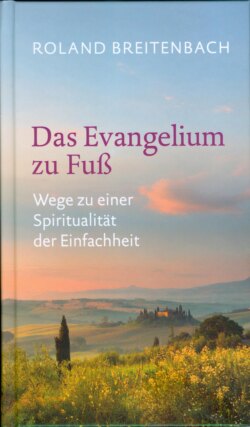Читать книгу Das Evangelium zu Fuß - Roland Breitenbach - Страница 7
1. Sprung in die Moderne
ОглавлениеDie Dogmatik ist nicht das Fundament des Glaubens. Sie gibt dem Glauben, je nach der Zeit, das passende Kleid.
Wenn unser Glaube an Jesus real sein soll, dann müssen wir uns auf den gleichen Weg machen wie seine Jüngerinnen und Jünger. Der Weg ist der erste Ort des Evangeliums, nicht die Kanzel, erst recht nicht der Lehrstuhl. Bringen wir es auf den kürzesten Nenner: Die Kirche – als die Gemeinschaft der Jesus-Gläubigen – lebt in einer Welt, die mit der Welt der meisten Menschen immer weniger zu tun hat. Die Kirche nennt das Glaubenskrise. Die Menschen in der Welt, die sich allein gelassen fühlen, nennen das Kirchenkrise. Beide Seiten finden so Schuldige. Für die Kirche ist es „die moderne Welt“. Für die Weltmenschen das sture Festhalten der Kirche an überholten Sätzen. Dazu kommt als weiteres Problem, dass bis in unsere Zeit hinein die Kirche an einer Sprache festhält, die kaum noch jemand versteht. Wir, die Älteren in der Kirche, tun uns noch relativ leicht mit den Formulierungen des Glaubensbekenntnisses, das wir von Kindesbeinen an kennen. Den Jungen können wir Sätze wie diese nicht mehr ohne weiteres auferlegen oder abverlangen, obwohl sie bestimmt auch wieder im Neuen Gotteslob abgedruckt sind:
Aus dem Himmel herabgekommen …
In den Himmel aufgefahren …
Sitzend zur Rechten Gottes …
Von dort wird er kommen …
Dass wir uns nicht falsch verstehen: Für mich ist die Frohe Botschaft durch Jesus von unschätzbarem Wert. Gerade deswegen muss diese Botschaft in den Worten unserer Zeit verkündigt werden, damit sie von allen, die hören wollen, verstanden werden kann.
Wäre Jesus in unsere Zeit gekommen, hätten wir für ihn aus unseren Erfahrungen andere Bilder verwendet. Also keinesfalls ‚Hoherpriester‘ oder ‚Lamm Gottes‘, nicht einmal ‚Sohn Gottes‘. Diese Bilder sind nicht falsch, aber nicht mehr sinnvoll. Sie sind überholt. Jedenfalls wären ‚Bruder‘, ‚Mitmensch‘ ‚Mensch für uns Menschen‘ viel griffiger, weil auch wir Menschen besser und heiliger werden, je mehr wir Mensch, Mitmensch werden.
Krise der Kirche oder des Glaubens
Die Krise
stellt die Weichen für das Leben.
Bis weit in unsere Zeit hinein hat sich die Kirche als „allein seligmachend“ verstanden. Mittlerweile muss sie sich damit abfinden, dass es eine Fülle von religiösen Erfahrungen und Bewegungen gibt. Einige Bischöfe sehen darin sogar schon Anzeichen für eine Kirchenverfolgung in Europa.
Diese vielfältigen religiösen Erfahrungen sollte man nicht abtun, auch wenn sich viele von denen, die sie machen, von der Kirche abwenden, da sie in ihr zu wenig vom Wort, vom Werk, vom Geist Jesu finden. Die Kirche ist zu oft vom Weg abgekommen und hat sich in ‚Gotteshäuser‘ zurückgezogen. Aber an die Erfahrungen am Rande der Kirche lässt sich, besonders wenn man keine Vorurteile hat, durchaus anknüpfen und darauf aufbauen. Dann vor allem, wenn aus der Kirchenkrise nicht gleich und leichtfertig eine Glaubenskrise konstruiert wird.
Wo wohnt Gott
Nach dem gemeinsamen Abendgebet
saßen die beiden Mönche im Garten
und betrachteten den klaren Sternenhimmel.
Der Ältere erklärte dem Jüngeren einige Sternbilder,
bis dieser fragte:
„Gibt es einen Gott hinter den Sternen?“
Der Ältere schwieg einige Zeit.
Dann fasste er den Jüngeren an der Hand und sagte:
„Wenn du Gott nicht in dir findest,
wirst du ihn hinter den Sternen vergeblich suchen.“
Auch wenn die Kirche immer noch an alten Gottesbildern hängen mag – Gott ist anderswo zu suchen als in einer jenseitigen Welt, von der aus er alles regelt und verordnet, sagten die Mystiker schon vor Zeiten. Gott ist in der Tiefe, also im Menschen selbst. Meister Eckhart wäre wegen dieser Aussage beinahe auf dem Scheiterhaufen gelandet. Gott sei „nicht die Antwort auf ein menschliches Bedürfnis. Gott so verstehen hieße, ihn verkleinern und damit verneinen“, so der Jesuitenpater George Coyne, der noch in unseren Tagen daraufhin seine Aufgabe als Hofastronom des Vatikans quittieren musste.
Der große Theologe Karl Rahner betont, dass Gott mit jedem Menschen seine Geschichte hat. Und, so fügen wir hinzu: Jeder Mensch hat auch seine Geschichte mit Gott. Es braucht viel Freiheit und Mut, sich das zuzugestehen.
Der tschechische Professor Tomas Halik, er wurde in den kommunistischen Zeiten heimlich zum Priester geweiht, sagt: „Viele, die mit Gott kämpfen, sind ihm näher als die Gleichgültigen.“ Menschen spüren es heute deutlicher als früher, wo alles seine vorgeschriebenen religiösen Bahnen ging, dass sie ohne Gottesbeziehung nicht ganz sind. Gott und die Menschen miteinander auf einzigartige Weise zu verbinden, das hat Jesus in unsere Welt gebracht. In dieser Nähe und Intensität lässt sich das außerhalb des Christentums kaum finden.
Zugegeben: Früher war alles viel einfacher, als man noch sagen konnte: Das hat Gott gesagt. Das ist der Wille Gottes. Das hat Gott so und nicht anders gemacht. Heute muss der Glaube die Unsicherheit und die Verborgenheit Gottes ertragen. Wieder Halik: „Glaube und Zweifel sind Geschwister. Sie brauchen einander. Wer sich seines Glaubens allzu sicher ist, kann leicht zum Fanatiker werden. Davon haben die Religionen derzeit mehr als genug.“
Du sollst Gott lieben, wie er ist:
ein Nichtgott, ein Nichtgeist,
eine Nichtperson, ein Nichtbild.
(Meister Eckhart)
Wir müssen uns von allen Äußerlichkeiten befreien. Deswegen ist es nicht mehr so leicht, von Gott zu reden. Früher ist uns dieses Wort zu einfach und zu schnell über die Lippen gekommen.
Für mich und meinen Glauben gilt ein wichtiger Satz: In der Menschlichkeit Jesu begegne ich Gott. In den Leiden wie in den Freuden der Menschen; selbst noch in ihrem Versagen. Gott lässt sich im Gesicht der Mitmenschen erkennen, und ich hoffe, dass auch auf meinem Gesicht das Göttliche erkannt werden kann. In der Gerichtsrede nach Matthäus lässt Jesus Gott in der Gestalt des Königs sagen: „Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Aber auch: Was ihr ihm verweigert, habt ihr mir verweigert. Das Menschliche wie das Allzumenschliche trifft Gott, so sagt es Jesus.
Das ist die Tür, dessen bin ich sicher, die zu Gott führt. Er wartet hinter dieser Tür. Auf der Tür steht das Wort Liebe nach der kurzen Formel, die uns Jesus gegeben hat: „Gott lieben, den Nächsten lieben und sich selbst“. Ein heiliger Dreiklang, auf den wir hören sollen und den wir anschlagen können, wo immer wir sind, um entschlossen durch diese Tür zu gehen. Allem Krisengerede zum Trotz.
Große Teile der Bibel enthalten Verbrauchtes, bestenfalls etwas, das dringend der Aufarbeitung bedarf. Der Beweis dafür lässt sich leicht auf den 54 eng bedruckten Spalten des Buches Leviticus antreten: Dieses biblische Buch strotzt nur so von fragwürdigen Reinheitsvorschriften, Nahrungsverboten, sexuellen Verurteilungen und Todesstrafen, selbst bei Vergehen, die wir heute als geringfügig oder vernachlässigenswert ansehen.
Dennoch gehört die Bibel zu unserem heiligen „Erbgut“, aber es ist eben ein Erbe, das 2000 bis 3000 Jahre alt ist, niedergeschrieben in der Denk- und Redeweise längst verflossener Generationen und einer überholten Weltanschauung.
Entscheidend für uns jedoch ist: Die Texte der Bibel sind der Niederschlag der Gotteserfahrung, die Menschen ihrer Zeit gemacht haben. In den Evangelien, der Apostelgeschichte, den Briefen ist es die besondere Gotteserfahrung, die durch Jesus Christus ausgelöst wurde und die so für die Menschheit jener Zeit, des ersten und zweiten Jahrhunderts, eine ganz neue, weil andere Bedeutung gewonnen hat. Auf einmal ist Gott für die Menschen da und nicht umgekehrt. Gott thront auch nicht mehr hoch über allen Himmeln; er nimmt unsere Gestalt an. Gott herrscht nicht unnahbar in weiter Ferne über die Welt und die Menschen, er begegnet uns in Menschlichkeit. Mit dem Neuen Testament lernen wir Jesus von Nazareth als den von Gott erfüllten Menschen kennen und lieben. Und zwar auf so nachhaltige Weise, dass wir den Weg, den er zeigt, mitgehen wollen. Denn erst mit der Nachfolge werden Worte auf Papier zum Wort Gottes, zur Weisung, zum Leben.
Deswegen können beispielsweise drei Worte aus dem 1. Johannesbrief – ‚Gott ist Liebe‘ – Menschen zutiefst berühren und sie dazu bewegen, in ihrem Leben die Liebe zu verwirklichen.
Das ist für mich zugleich das Eigentliche an den hl. Schriften: Sie wollen schöpferisch sein, in uns etwas auslösen. Das sagt uns, dass sie insoweit ‚Wort Gottes‘ sind, als sie eine Veränderung des Menschen zum Guten bewirken: Versöhnung schaffen, Gerechtigkeit durchsetzen, Frieden stiften, zur Verantwortung anregen. Wo die gleichen Schriften allerdings zu Gewalt, Terror und Blutvergießen anstiften – Stellen dafür gibt es genug –, haben sie das Prädikat ‚Wort Gottes‘ verwirkt.
Das neue Gottesbild
Man kann Gott totschweigen.
Man kann ihn auch totreden.
(Phil Bosmans)
„Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht.“ So wie ihn die Menschen denken oder beschreiben. Ansonsten wäre er in unserer Hand. „Sie schufen sich Gott nach ihrem Bild und Gleichnis“, müsste sonst im ersten Buch der Bibel stehen. Gott ist im Verlauf der Zeiten zu einem ganz Anderen geworden, als er uns in der kirchlichen Tradition überliefert wurde: Aus dem Gott-in-der-Höhe wurde ein Gott-mitten-unter-uns. Einer, der für uns da ist.
Die Vergangenheit hatte für Gott eine Fülle von Bildern zur Verfügung, die je nach „Sachlage“ als Froh- oder Drohbotschaft von den Predigern eingesetzt wurden. Wir Heutigen stellen fest: Es gibt keine Worte und Bilder mehr, die ohne weiteres „passen“. Denn je bunter und einander widersprechender die Vorstellungen von Gott waren, angefangen bei Vater über König, Allmächtiger, Herrscher, Richter und Rächer, umso mehr lenkten sie von dem ab, der letztlich unfassbar und unbeschreiblich ist; machten handsam, was nicht zu fassen und zu begreifen ist.
Gott
Auf Drängen seiner Schüler
erklärte sich der Weise bereit,
alles, was er von Gott wisse,
in einem Buch zusammenzufassen.
Wieder und wieder mussten die Schüler nachfragen,
bis sie endlich das fertige Exemplar in Händen hielten.
Doch die Enttäuschung war groß:
Nichts als leere Seiten.
„Nichts,
das ist alles, was wir von Gott sagen können“,
erklärte der Weise.
Unsere Worte über Gott sind „wie Finger, die auf etwas ganz anderes zeigen“ (Lenaers). Wurde in unseren Gebeten, in seinen Geboten Gott genannt, dann zeigte der Finger immer nach oben, in den Himmel, in eine unbegreifliche Ferne. Doch Gott ist nie draußen. Er ist immer schon drinnen. In uns, sagten die Mystiker schon vor fünf, sechs Jahrhunderten – und das ist auch die wichtigste und schönste Erfahrung, die wir Heutigen machen können: Gott ist der Kern, die Mitte eines jeden kosmischen Prozesses. Er ist auch unsere Mitte. In unserem Verständnis gibt es nur noch eine Welt, in der sich Gott wie ein großes Geheimnis offenbart, das vor Liebe überfließt und an dieser Liebe erkennbar ist. Je größer das Geheimnis unserer Welt wird, sagen nicht wenige anerkannte Wissenschaftler, desto tiefer wird unsere Ahnung von Gott in allem.
Diese Gotteserfahrung hat Konsequenzen für den Glauben, für die Lehre und die Ethik der Kirche wie für unser Beten. Mit dem Namen „Gott“ wird auf den tiefsten Grund unserer Wirklichkeit gezeigt. Die Mystiker ringen darum, wie sich diese Wirklichkeit für uns deuten lässt. Besonders drastisch tat das Meister Eckhart schon im 14. Jahrhundert:
Manche Menschen wollen Gott mit den Augen ansehen,
mit denen sie eine Kuh ansehen.
Sie wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben.
Die Kuh liebt man wegen der Milch,
des Käses, des eigenen Nutzens.
So halten es jene Leute mit Gott.
Sie lieben Gott nicht, sie lieben ihren Eigennutz.“
Fragt man Eckhart, wie man Gott begegnen soll, antwortet er: „Der wahrhaft Liebende liebt Gott in allem und findet Gott in allem.“ Und: „Wenn du Gott bei deiner Arbeit im Stall weniger nahe bist als im Hochamt, dann hast du ihn nicht.“
In diesen Worten erfahren wir zugleich, was heute beten heißt: sich bewusst in Freud und Leid, in Hoffnung und Trauer mit Gott verbinden und daraus leben und handeln, ohne etwas zu erwarten. So bleibt uns weniger das Bitten als mehr das Loben und Danken als die selbstverständliche Gebetsform, die wir in jedem Gottesdienst üben. Wir leben aus der Wirklichkeit Gottes, die sich an uns verschenkt. Und dann, so vertrauen wir, wird alles gut.
Lob und Dank haben viel mit Ehrfurcht, Staunen und Bewunderung zu tun. Das Staunen darüber, dass Gott uns annimmt, wie wir sind, und uns nicht, wie das unter überholten Vorstellungen gedacht wurde, ständig in die Zange nimmt. Bewunderung darüber, dass sich das große Weltgeheimnis uns zugewandt hat und zu uns sagt: Mein bist du. Ich hab dich lieb. Ehrfurcht vor uns selbst, weil Gott sich auch in uns zeigen und sichtbar machen will.
In der im Messbuch strikt vorgeschriebenen Form der gottesdienstlichen Feier kommt an mindestens zehn Stellen zum Ausdruck, dass wir uns gefälligst als sündige und nicht etwa als erlöste Menschen zu fühlen haben und Gott entsprechend um sein Erbarmen bitten müssen. Das Gottes- und Menschenbild des römischen Messbuchs entspricht schon lange nicht mehr dem Selbstverständnis der Menschen in unseren Gemeinden. Im wunderbaren schwedischen Film „Wie im Himmel“ sagt dagegen die Pfarrersfrau überzeugend: „Gott vergibt uns nicht, weil er uns erst gar nicht verurteilt.“
Ein befreiendes Wort, das wir gerne aus dem Mund derer hören möchten, die uns das Evangelium verkünden. Gott hat uns erst gar nicht verurteilt – das gehört zu meinem Glaubensbekenntnis. Es lässt mich aufrecht stehen und beten. Das gibt mir ein gesundes Selbstbewusstsein.
Wer betet, will schließlich Gott nicht begreifen, sondern ihm begegnen. Einem Du, das die Liebe ist, wie Johannes schreibt. Das Begreifen dessen, was göttliche Liebe ist, was sich in dieser Liebe alles verbirgt, erwarte ich für mich in einer neuen Welt.
Ein neues Jesusbild
Welcher Kirche
würde Jesus heute beitreten?
(Walter Ludin)
Die alten Bilder tragen nicht mehr. Sie sind weitgehend unverständlich geworden. Wenn wir uns also darüber austauschen, was wir glauben, brauchen wir neue Bilder, ein neues Jesusbild; wir brauchen verständliche Worte und wir brauchen verständliche Riten.
Jesus war wieder einmal auf die Erde gekommen.
Er wollte sehen, wie es mit seiner Botschaft stehe.
Schneller als gedacht
wurde er von einer kirchlichen Behörde gefragt,
welches die wahre Religion sei:
das Judentum, der Islam, das Christentum?
„Ich stelle mich auf die Seite der Menschen,
nicht der Religionen“,
gab Jesus zur Antwort.
„Du solltest vorsichtiger sein mit dem,
was du sagst!“
„Ich weiß!
Deswegen bin ich schon einmal gekreuzigt worden.“
Wir begegnen heute Gott vor allem und zuerst in der Menschlichkeit Jesu. Er selber bezeichnet sich als Weg zu Gott. Zugleich lehrt er durch sein Leben, dass wir Gott auch in der Mitmenschlichkeit eines jeden Menschen erfahren können. Damit wäre eigentlich doch alles gesagt. Doch wir müssen das noch ein wenig entfalten.
Christsein, das ist also die Lebenshaltung nach dem Wort und Beispiel Jesu von Nazareth, im Glauben an seine göttliche Sendung. Durch seinen Tod am Kreuz, mehr noch durch sein neues Leben sind die Gläubigen zu einer ganz besonderen Gemeinschaft zusammengewachsen. Diese nennen wir Kirche, die Gemeinschaft der durch das Evangelium Herausgerufenen.
Für unseren Glauben und damit für unsere Lebensgestaltung sind wir ganz auf das Zeugnis der ersten Christen, auf die Jüngerinnen und Jünger Jesu, angewiesen. Weit über ihr schlichtes Zeugnis hinaus gibt es spätestens mit dem Konzil von Nicäa (325) die Lehre der Kirche, dieser Mann aus Nazareth sei „wahrer Mensch und wahrer Gott“ gewesen.
Mit der Vorstellung von der ‚Gottheit Jesu‘ haben wir es mit einer Deutung zu tun, die sich erst allmählich in der Kirche entwickelte. Schon im Alten Testament, in der Hebräischen Bibel, war ‚Sohn Gottes‘ nicht wortwörtlich zu verstehen. Es war eine Auszeichnung. Ein Ehrentitel. Mit solchen und weiteren Titeln wie ‚Lamm Gottes‘ oder ‚der Gesalbte Gottes‘ suchte die Kirche für Jesus und seine Verehrung die passenden Worte und Bilder zu finden.
Jesus ‚Gott‘ zu nennen wäre weder dem Apostel Paulus noch den ersten drei Evangelisten Matthäus Markus und Lukas in den Sinn gekommen. Gott, das war und bleibt Gott allein. Der Glaube an diesen einen Gott hat das Volk Israel durch seine schwierige Geschichte getragen.
Im Heidentum, von dem die junge Christengemeinde ringsum umgeben war, wimmelte es nur so von menschlichen Halbgöttern und von Kaisern, die nach ihrem Tod in den Rang eines Gottes erhoben wurden. In der römisch-griechischen Religiosität bedeuteten solche Götter bestenfalls Bewohner einer höheren Welt, die mit ewiger Jugend ausgestattet waren. Keinesfalls war damit an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, gedacht.
Jesus, so die Überzeugung der ersten Christen, verdiene den Titel ‚Gott‘ oder ‚Gottes Sohn‘ weit mehr als diese Halbgötter ihrer Umgebung mit all ihren Schwächen. Für den Verfasser des vierten Evangeliums, er schreibt um die Jahrhundertwende, bleibt der Vater noch immer größer als der Sohn. Man glaubte an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und man glaubte an Jesus, den Mann aus Nazareth.
Für uns und unseren Glauben sagen wir dieses: Jesus ist für uns Weg und Wahrheit, Wort Gottes an uns und Licht der Welt. Es genügt also zu bekennen: Jesus ist der Christus, der Gesandte Gottes in unsere Welt, für uns Menschen, für alle Menschen.
Vom Glauben an diesen Jesus und seine Botschaft dürfen wir das Heil erwarten. In Jesus erkennen wir die Erlösung durch Gott. Nicht von ungefähr lautet eine frühchristliche Formel: „Wer Jesus sieht, sieht den Vater“. Und doch sagt Jesus selber klar und eindeutig: „Der Vater ist größer als ich“ (Joh 14,28).
Wenn wir in diesem Zusammenhang von Froher Botschaft sprechen, dann ist es die: In Jesus Christus offenbart sich Gott, der mit uns ist. So wie sich Gott schon einst Mose gegenüber geoffenbart hat: Ich bin der „ich bin da“. Ich bin für euch da.