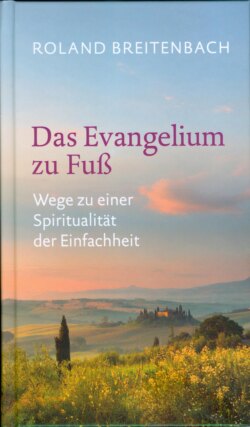Читать книгу Das Evangelium zu Fuß - Roland Breitenbach - Страница 8
2. Ein Segen sein
ОглавлениеGott ist das Gute und alles, was aus ihm hervorgeht, ist gut. (Hildegard von Bingen)
Das erste große Ereignis in der Geschichte des Alls wie unserer kleinen Welt ist der Segen. Der Segen ist sozusagen das Ur-Evangelium, das in die Schöpfung hineingelegt wurde. Seither ist die Frohe Botschaft Gottes ganz nahe bei den Menschen. Dieser Segen geht immer weiter, weil auch die Schöpfung immer weiter geht.
Wir können Raum und Zeit dieses ungeheuren und zugleich wundersamen Vorgangs nicht ermessen. Lichtjahr, das ist ja nur der bescheidene Versuch eines Maßes. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr in absolutem Vakuum zurücklegt. Das sind etwa 9,5 Billionen Kilometer. Schon bei dieser Zahl kommt uns der Gedanke: Wie können Menschen es dann wagen, Gott, der nach unserer Überzeugung hinter allem und über allem steht, so kleinzurechnen und ihn in ihre engen Bilder zu fangen.
Segen hat immer mit Beziehung zu tun. Man segnet nicht wirklich, wenn man beim Segnen nicht etwas von sich abgibt; man empfängt keinen Segen, ohne mit dem Segnenden verbunden zu sein. Deswegen ist die Spiritualität des Segens eine Spiritualität der Beziehung. Ohne Segen ist der Tank bald leer und (nicht nur) Beziehungen zerbrechen. Deswegen hat Jesus die Menschen durch einfache Berührungen an Augen, Ohren und Mund gesegnet und sie für das Evangelium geöffnet.
Der Segen geht von einer liebenden Quelle aus, wir nennen sie Gott. Damit ist die ganze Schöpfung gesegnet und sie wird selber zum Segen. Gottes Segen steht am Ursprung unseres Alls und unserer kleinen Welt und wurde vor vielleicht 20 Milliarden Jahren zum ersten Male gesprochen: Gott sah, heißt es in der Hebräischen Bibel, dass es gut war. Sehr gut sogar.
Gott wendet sich dem Menschen im Segen zu. Der Segen hängt mit dem Leben, dem Überleben und dem Genuss der grundlegenden Gaben des Lebens zusammen. Dafür bleiben zum Beispiel das Tischgebet oder das stille, gesammelte Schweigen vor dem Essen ein Zeichen.
Der große Segen, er geht der Schöpfung voraus, ist die Grundlage allen Vertrauens und Glaubens. Wer kann da noch die Meinung haben, Gott sei ein Krämer, ein Polizist, ein Automat?
Einfach zu sein ist ein Segen,
einfach zu leben ist heilig.
(Rabbi Heschel)
Im Buch Numeri wird der so genannte aaronitische Segen zum ersten Mal festgehalten. Am Ende eines evangelischen Gottesdienstes ist er oft zu hören:
Der Herr
segne dich und behüte dich;
Der Herr
lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig;
Der Herr
hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.
(Num 6,24–26)
Das hebräische Wort für Segen, ‚beraka‘, kann sowohl Erschaffung wie Rastplatz heißen. Bevor man Menschen dazu brachte, an so etwas wie ‚Sünde‘ zu denken, gab es schon den Segen. Damit sind unsere Erdhaftigkeit, unsere Sinnlichkeit und unsere Leidenschaft ein Segen. Allerdings, so Meister Eckhart, brauchen die drei das Zaumzeug der Liebe. „Liebe, und dann tu, was du willst“, das ist eines der wesentlichen Worte des Augustinus, hinter denen wir voll und ganz stehen können.
Unser (westliches) Problem, das seine Ursache in der griechischen Philosophie hat, ist es, dass wir alles unter der Vorgabe des Dualismus sehen: Alles hat seine zwei Seiten, sagen wir. Also gibt es Gut und Böse, Licht und Schatten, die einander widerstreiten. Dabei übersehen wir leicht, dass das Licht für den Schatten verantwortlich ist und es ohne Schatten kein Licht gibt. Das alles zeigt sich unter dem Segen. Er vereint, was getrennt scheint.
Gefährlicher noch ist, wenn eine Seite die andere ausgrenzt. Auch das will der Segen verhindern. Was gesegnet ist, kann zum Segen werden
Ochs und Esel
Im Garten des Klosters
dachte der eine Mönch halblaut nach,
warum eigentlich Gott den Menschen erst am sechsten Tag,
also ganz zuletzt, geschaffen habe.
Sein Mitbruder gab ihm zur Antwort:
„Damit wir uns immer dann,
wenn wir überheblich werden,
daran erinnern,
dass sogar Ochse und Esel uns voraus sind.“
Die jüdische Spiritualität, aus der Jesus kam, kannte die Wörter für ‚Körper‘ und ‚Seele‘ nicht, die in der kirchlichen Lehre oft genug als Gegensatz verstanden wurden – mit allem Negativen, was sich im Lauf der Zeit daraus entwickelt hat, zum Beispiel, die Seele sei im Körper gefangen und erst im Tode werde sie frei. Für die Bibel gibt es schlicht und einfach nur ‚Leben‘.
Der Bruch und damit die Trennung vom Leben kam, als die Kirchenväter im 4. und 5. Jahrhundert begannen, Jesus die Menschlichkeit, die Erdhaftigkeit, die Sexualität abzusprechen und damit seine wahre Demut, sein menschliches, leibhaftiges Leben, das sicher auch von Sexualität geprägt war, auch wenn die Schrift nicht davon spricht. Aus dem Jesus unseres Lebens wurde der von allem Irdischen enthobene und abgehobene Christus in der Herrlichkeit Gottes. Damit ging mehr und mehr die Bodenhaftung der Frohen Botschaft verloren. Das gilt es auch zu bedenken, wenn wir in einem Atemzug ‚Jesus Christus‘ sagen. Das Menschliche an dem Mann aus Nazareth: dass er allen Leuten zu Fuß und damit auf Augenhöhe begegnet ist, darf nicht verloren gehen.
Jesus war zeit seines Lebens ganz nahe bei den Menschen. Selbst noch am Kreuz sorgte er sich um seine Mutter. Jesus berührte zeit seines Lebens die Menschen mit seinem Segen und rührte sie an: „Man brachte Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als das aber Jesus sah, wurde er zornig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran; denn für solche wie sie ist das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und segnete sie, indem er ihnen die Hände auflegte“ (Mk 10,13–16).
Jesus gibt ein Zeichen von Demut, wie wir diese Haltung verstehen sollten. Das passende Wort dafür ist heute: Einfachheit. Demütig zu sein – das Wort humilitas kommt von ‚humus‘, Erde – bedeutet, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, in lebendiger Verbindung mit der Erde zu sein, den Segen des Irdischen zu feiern. So ist die ‚demütige Magd‘ Gottes zu verstehen und nicht als ein unterwürfiges, selbstverachtendes Leben. Es gilt für das Christentum in die Erde zu greifen, wie es die feministisch geprägte ‚Barfuß-Theologie‘ versucht.
Gott im Staub
Die Menschen wunderten sich,
wenn sie dem Alten begegneten.
Bevor sie ihm die Hand reichen konnten,
berührte er den Boden, als ob er dort etwas suche.
Sie fragten nach dem Grund seines seltsamen Verhaltens.
Er sagte: „Wenn zwei Menschen sich begegnen,
liegt Gott vor ihnen im Staub.
Je nachdem, wie die Begegnung ausgeht,
freundlich oder feindlich, kann er sich aufrichten
oder wird tiefer in den Staub getreten.“
Im Katakombenpakt haben während des Zweiten Vatikanischen Konzils rund 500 katholische Bischöfe gelobt, diese Bodenhaftung zu versuchen und zu den Menschen, vor allem zu den Armen, materiell und spirituell auf Augenhöhe zu gehen. Gerade die Armen und Ausgegrenzten sind die von Jesus Gesegneten.
Vielen Gläubigen ist die Theologie des Segens schon deshalb verloren gegangen, weil man sie dazu nicht ermächtigt hat. Der Segen wurde zu einer klerikalen Sonderaufgabe. Denken wir nur an die Segnungsautomatik unserer Bischöfe beim Einzug in die Kirche.
Wenn die ganze Schöpfung ein Segen ist, dann ist die Freude die angemessene Reaktion darauf. Freude ist eine der schönsten und tiefsten Erfahrungen unseres Lebens. Die Quelle aller echten Freude ist Gott. Wer aber die Freude nicht schon hier schmeckt, wie will er sie dann bei Gott genießen können? Es ist für das Christentum ganz wichtig, wieder zum Vorgeschmack des Himmels zu werden. Dann stimmt es auch wieder, wenn wir sagen: Das Reich Gottes ist mitten unter uns.
Bei den Propheten ist der Segen ein zentrales Motiv. Er ist für sie erlösend. Der Segen kann erlösen, weil er Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht auslöst, damit Freude und Glück.
Leider hat nicht der Segen, sondern die Sünde jahrhundertelang in der Kirche eine wichtigere Rolle gespielt. Man kann den Gott des Segens eine Zeit lang übertönen, aber er lässt sich nicht für immer zum Schweigen bringen.
Die Propheten predigen den Segen, weil es die Freude ist, die den Menschen zutiefst wandeln kann. Für viele wurde die Eucharistiefeier bedeutungs- und wirkungslos, als man begann, „die Messe zu lesen“, statt sie zu feiern. Das ist noch nicht überwunden. Man hat vielerorts wieder das dunkle Gefühl, dass das gedruckte Wort im Messbuch nicht nur zwischen dem, der es vorliest, und dem, der es hören und mitvollziehen soll, wie eine Mauer steht, sondern auch zwischen den Menschen und Gott. Die Liturgie wie der Segen leben aber von einer menschennahen Sprache.
Eine Rückkehr zum Ursprünglichen ist sehr schwierig geworden, weil sich die Menschen, vor allem die Jungen, andere Orte und Möglichkeiten des Feierns gesucht haben. Die Liturgiereform hat zu wenig an die Kunst des Feierns gedacht. Fröhlichkeit und Freude gehören immer zu einem Gottesdienst dazu. Und nicht in erster Linie die Genauigkeit der Worte und der Gesten.
Der irisch-keltische Theologe Johannes Scotus sagt: „Mit dem Universum meine ich Gott und die Schöpfung.“ Das Universum ist sakramental, von Gott erfüllt. In diesem Sinne ist auch ein Fels gesegnet. Er bewahrt in aller Ruhe den Schöpfungssegen des Anfangs in sich. Die Steinkreise und Steinreihen Irlands etwa können uns daran erinnern, wenn sie etwas von ihrer innewohnenden spirituellen Kraft erfahrbar machen. Oder ein Baum. Auch er ist gesegnet. Neunzig Prozent ist totes Holz, aber das Tote trägt das Leben, das sich in den aufsteigenden, und, das wird oft vergessen, auch in den absteigenden Säften zeigt. Ein wunderbares Symbol für den Segen.
Gebet und Segen
Ein Mensch, der seinen großen Reichtum
nicht allein seiner Hände Arbeit zu verdanken hatte,
kam zum Holzschnitzer,
um sich eine Decke aus Zirbenholz schnitzen zu lassen.
„Am liebsten wäre es mir“, sagte der Auftraggeber,
„wenn du ein Gebet für den frühen Morgen
und eine Gewissenserforschung für den Abend
in die Holzdecke schnitzen könntest!“
Als die Holzdecke nach einigen Wochen fertig war,
konnte der Hausherr im Sechseck folgenden Spruch lesen:
Wo Glaube, da Hoffnung.
Wo Hoffnung, da Liebe.
Wo Liebe, da Friede.
Wo Friede, da Segen.
Wo Segen, da Gott.
Wo Gott, da keine Not.
(Zirbelstube Hallerhof Brixen)
Auch das Spiel hat unendlich viel mit Segen zu tun. Jedes Ritual ist ein solches Spiel: „Gott segne dich vom Kopf bis zu den Füßen, von ganz oben bis unten, von links nach rechts.“ Wasser, Öl, Brot, Wein, Kerzenlicht, Blumen gehören zum Segen.
Für unsere Zeit müssen Rituale gefunden, neu erfunden werden. Dann tut sich ein breites Feld auf, auf dem sich die Erfahrungen der Menschheit sammeln und zum Ausdruck bringen, was das Leben trägt. Ein Blick in die Welt der jungen Leute könnte dabei helfen: wie sie sich begrüßen, welche Symbole sich in ihrer Sprache finden, welche Zeichen sie mit sich tragen.
Nicht unsere Sinne,
nicht das dankbare Genießen
bringen das Unrecht zur Welt.
Die Verächter der Freude
und der Leidenschaft
schaffen das Böse.
Aus der Freude an der Schöpfung
kommt Gottes Segen in Fülle,
verändert den Menschen,
macht ihn frei,
zu danken und zu loben.
Gott wohnt in unserer Freude.
Er erfüllt unsere Leidenschaft
über den Rand,
stillt unsere Sehnsucht,
weckt die Erwartung nach Neuem.
Für das Leben
gibt Gott
uns die Zügel der Liebe in die Hand:
Gutes und Schweres zu lenken
im rechten Maß.
Noch aus der tiefsten Schwärze
erblüht strahlend weiß der Lotus,
uns zum Zeichen.
Der Segen
ist alles in allem.
In allen Sinnen lebt Gott,
mit Glut erfüllt er unsere Sinnlichkeit.
Wer das Irdische willkommen heißt,
ist in sich
und in Gott geborgen.