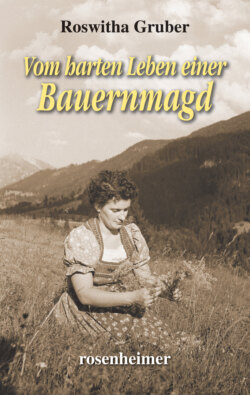Читать книгу Vom harten Leben einer Bauernmagd - Roswitha Gruber - Страница 7
ОглавлениеSchmerzliche Verluste
Wenn ich ganz weit zurückdenke, sehe ich zwei kleine Mädchen, die auf Omas Bauernhof vor dem Haus mit der Katze spielen. Auf einmal geht die Haustür auf. Unsere Mutter tritt heraus in ihrem dunklen Mantel mit einem schwarzen Hut auf dem Kopf. In einer Hand trägt sie eine Reisetasche, in der anderen ihre Handtasche. Wir laufen auf sie zu. »Mama, wo willst du hin?«, frage ich verwundert.
»Mama, willst du hin?«, echot meine kleine Schwester.
Mama antwortet: »Ich fahre in die Stadt.«
»Wann kommst du wieder?«, will ich wissen.
»Tommst du wieder?«, hängt meine kleine Schwester ihre Frage an.
»Das kann ich nicht sagen.«
Obwohl ich keine Ahnung habe, was eine Stadt ist, bettele ich: »Nimm uns mit.«
»Das geht nicht.«
Doch so schnell lasse ich mich nicht abwimmeln: »Warum nicht?«
»Das kann ich euch nicht erklären, das versteht ihr doch nicht.«
Ungerührt schreitet sie davon. Da sie die Hände nicht frei hat, hängen wir uns an ihre Taschen. Sie schüttelt uns ab wie lästige Insekten und setzt ihren Weg fort. Als wir ihr noch ein Stück nachlaufen, schimpft sie: »Was fällt euch ein? Kehrt sofort um! In der Stadt kann ich euch nicht brauchen. Seid brav und macht der Oma keine Scherereien.«
Wie geprügelte Hunde kehrten wir zum Haus zurück. Wir fassten uns an den Händen und liefen in die Küche. Die Oma schloss uns in die Arme. Schluchzend fragte ich: »Warum ist die Mama weggegangen?«
»Sie will nach Rosenheim.«
»Was macht sie da?«
»Sie will dort arbeiten.«
»Arbeiten kann sie auch hier.«
»Das stimmt. Aber sie will Geld verdienen. Sie will ein besseres Leben haben.«
Darunter konnte ich mir zwar nichts vorstellen, doch ich wiederholte den Satz meiner Großmutter: »Ich will auch ein besseres Leben haben.«
»Auch besseres Leben haben«, kam es von Klein-Anni.
»Ah geh, ihr Tschaperl! Was wollt ihr denn? Ihr habt doch ein gutes Leben. Ihr dürft bei der Oma sein und es fehlt euch an nichts.«
Dieses für uns Kinder erschütternde Ereignis hatte sich im Mai 1930 abgespielt. Ich erinnere mich deshalb so genau an den Zeitraum, weil wir kurz zuvor meinen vierten Geburtstag gefeiert hatten, nämlich am 30. April, und einige Tage später, am 4. Mai, war meine Schwester Anni drei geworden.
Minuten später wurden wir von unserer Trauer abgelenkt. Im Treppenhaus hörten wir nämlich ein Poltern. Das mussten Vroni und Toni sein, die fünfjährigen Zwillinge von Tante Heidi, die mit ihrer Familie im ersten Stock wohnte. Anni und ich waren Frühaufsteher, die Zwillinge dagegen waren Langschläfer. Wir gesellten uns zu ihnen und marschierten gemeinsam Richtung Wald, der nur zehn Minuten von unserem Hof entfernt lag.
Der Schnee war weitgehend verschwunden, nur einige Schneehaufen erinnerten daran, dass der Winter noch nicht wirklich vorbei war. Die hohen Berge rundum trugen noch ihre dicken weißen Hauben. Das war gut, dass sie nur ganz langsam abschmolzen, versorgte doch einer von ihnen unseren Brunnen, der mitten im Hof stand, das ganze Jahr über mit Wasser. Das hatte mir der Opa erklärt. Dieser Brunnen war ein Ziehbrunnen. Mit einer Winde, auf der ein dickes, langes Seil aufgerollt war, ließ man einen leeren Eimer hinab und zog ihn voll wieder herauf. Neugierig wie Kinder sind, interessierte uns dieser Vorgang sehr. Deshalb deckte man den Brunnen nach jedem Wasserschöpfen sorgfältig mit zwei schweren halbrunden Brettern ab, damit nur ja keines von uns hineinfiel.
An diesem Tag schien die Sonne warm vom Himmel, deshalb gingen wir unserer Lieblingsbeschäftigung nach. Im Wald sammelten wir kleine Stöckchen, die wir am Wegrand ordentlich aufeinanderlegten. Dann suchten wir Tannenzapfen. Toni stopfte seine Hosentaschen randvoll, und wir Mädchen gaben sie in unsere Schürzen, bis sie fast überquollen. Mit einer Hand musste man die Schürze hochhalten, mit der anderen nahm man so viele Stöckchen auf, wie die kleinen Hände umfassen konnten. Toni, der beide Hände frei hatte, konnte wesentlich mehr Stöckchen aufnehmen als wir. Dafür befanden sich in unseren Schürzen vermutlich mehr Zapfen. Mit unserer Beute kehrten wir glücklich auf den Hof zurück, wo unser eigentliches Spiel begann. Ich kann es nicht als Lieblingsspiel bezeichnen, denn es waren ja die einzigen Spielsachen, die wir hatten. Wir beschäftigten uns mit Hingabe an jedem sonnigen Tag damit und spielten »Bauernhof«. Manchmal bauten wir alle zusammen einen großen Hof aus unseren Stöckchen, mit vielen Ställen und vielen Tieren. Manchmal legten zwei von uns gemeinsam einen Hof an. Meist baute aber jeder seinen eigenen Hof. Jeder Bauernhof, ob groß oder klein, hatte immer eine ähnliche Einteilung: Es gab den großen Kuhstall, den kleineren Schweinestall und einen Schafstall. Der Hühnerstall war noch kleiner und der Rossstall war der kleinste. Denn darin stand nur ein Ross, genau wie auf dem Hof der Großeltern.
Waren alle Ställe fertig, wurden die Tiere hineingesetzt. Die großen Zapfen bildeten unsere Kühe und der größte das Pferd. Kleinere Zapfen waren die Schweine und die Schafe. Als Hühner nahmen wir kleine Steine. Danach war unsere wichtigste Beschäftigung, alle Tiere hinaus auf die Wiese zu lassen, damit sie fressen konnten. Waren sie satt, brachten wir sie wieder in die Ställe. Meist waren wir so vertieft in unser Spiel, dass wir rundum alles vergaßen, bis wir die Freudenschreie der beiden Großen bei ihrer Heimkehr vernahmen. Das waren Gregor, sieben Jahre alt, und Karl, sechs Jahre alt, die Brüder der Zwillinge, die bereits die Schule besuchten. Dann drängten wir alle zum Mittagessen ins Haus. Anni und ich aßen bei unserer Oma im Erdgeschoss, die vier Kinder der Tante dagegen stürmten nach oben und aßen mit ihren Eltern, die sie Mami und Dati nannten. Deshalb nannten Anni und ich sie meist auch so. In Wirklichkeit war Heidi unsere Tante, eine Schwester unserer Mutter. Ihr Mann war unser Onkel Sepp.
Nach dem Mittagessen spielten wir Kleinen weiterhin Bauernhof, und wenn die großen Brüder mit ihren Hausaufgaben fertig waren, spielten sie mit. Bald wurde ihnen das zu langweilig und sie spielten, was sie inzwischen auf dem Pausenhof gelernt hatten: Fangermandl oder Blindekuh. Dabei durften wir mitspielen.
Am Abend brachte uns die Oma einen Korb heraus, in den wir unsere Ställe und Tiere legten, bis auf die Hühner, die ja kleine Steine waren. Die Zapfen und Stöckchen bildeten für unsere Großmutter ein willkommenes Material zum Feuermachen. Es tat uns nicht weh, dass wir alles abbauen mussten. Am nächsten Tag zogen wir ja wieder los, um neues »Spielzeug« zu suchen. Dieses Suchen und Sammeln war ein wichtiger Bestandteil unseres Spiels und machte riesigen Spaß.
Ende Mai waren wir nach dem Mittagessen wieder einmal in unser Bauernhofspiel vertieft – jeder hatte seinen eigenen Hof –, während die Großen noch ihre Hausaufgaben erledigten. Deshalb bemerkten wir nicht gleich, dass Toni nicht mehr bei uns war. Erst als die Großen kamen und Gregor den Vorschlag machte, wir könnten Fangermandl spielen, fiel uns auf, dass Toni fehlte.
Wir riefen laut nach ihm und suchten überall. Aber es war keine Spur von ihm zu entdecken. »Vielleicht ist er wieder in den Wald gegangen, um mehr Kühe zu holen«, vermutete seine Zwillingsschwester. Bevor wir aber in den Wald zogen, um nach ihm zu suchen, fragten wir bei der Oma und bei seinen Eltern nach. Vielleicht hatte er sich ja dahin zurückgezogen. Unsere Nachfrage stürzte Mami und Dati in tiefe Besorgnis. Mit ihren beiden großen Buben zogen sie los, um nach Toni zu suchen. Uns drei Mädchen verdonnerten sie dazu, bei der Oma zu bleiben und den Hof nicht zu verlassen. Mit dem Fangenspiel wurde es nun nichts mehr. Also spielten wir mit unseren Bauernhöfen weiter, wenn auch lustlos. Unsere Gedanken weilten bei Toni. Obwohl wir noch so klein waren, machten wir uns Sorgen. Wo mochte er nur sein? Hätte er nur Zapfen suchen wollen, würde er längst zurück sein. Oma und Opa wirkten auch sehr besorgt und riefen uns schließlich ins Haus. Da schnappte ich von Opa auf: »Er wird doch nicht zum Bach gelaufen sein.«
»Mein Gott, ja«, antwortete die Oma. »Das ist ihm zuzutrauen.«
Den Bach kannten wir alle sehr gut. Von unserem Haus aus ging man etwa 15 Minuten, bis man ihn erreichte. Im Hochsommer war er ein schmales Rinnsal, das lustig vor sich hin plätscherte. Wenn es uns zu heiß wurde, streckten wir die Zehen ins Wasser, barfuß war man im Sommer ja eh. Blitzschnell zogen wir sie wieder heraus, denn der Bach war eiskalt. Er wurde schließlich vom Schneewasser gespeist. Etwas mutiger geworden, streckten wir dann einen ganzen Fuß hinein und wateten schließlich mit beiden Füßen ins Wasser, das uns bis zur halben Wadenhöhe reichte.
Im Sommer war der Bach, wie gesagt, nur ein harmloses Bächlein. Zur Zeit der Frühjahrsschneeschmelze aber verwandelte er sich in ein reißendes Ungeheuer.
Nach einigen Stunden kam die Mami mit ihren großen Buben zurück. Sie alle wirkten völlig verstört. Der Dati habe sich auf den Weg ins Dorf gemacht, erklärte Heidi ihren Eltern, um den Arzt, die Polizei und den Totengräber zu bestellen.
Wir waren zwar noch klein, dennoch begriffen wir, was das zu bedeuten hatte, und brachen in Tränen aus. Dann fingen auch die Erwachsenen und die Buben an zu weinen.
Es dauerte einige Zeit, bis Mami in der Lage war, zu erzählen: »Nachdem wir den ganzen Wald abgesucht hatten, kam Gregor auf die Idee, Toni könnte zum Bach gegangen sein. Er führte uns zu dem Platz, wo sie im Sommer immer gespielt hatten. Und richtig, als wir uns der Stelle näherten, sahen wir seine Strümpfe und Schuhe dort liegen. In dem Moment dachte ich, mir bleibe das Herz stehen. Wahrscheinlich hatte er, sich nichts Böses dabei denkend, nur seine Füße eintauchen wollen, als ihn ein Schwall mitriss. Wir liefen am Bach entlang talwärts. Das war gar nicht so einfach. An manchen Stellen versperrten uns Gestrüpp und überhängende Zweige den Weg. Obwohl der Bach wild schäumte und rauschte, hatten wir die unrealistische Hoffnung, dass wir Toni lebend wiederfinden würden. Vielleicht hatte er sich an einen Zweig klammern und sich aus dem Bachbett ziehen können. Durch Gestrüpp und Dornen hasteten wir weiter, schon völlig zerkratzt. Wir waren mittlerweile sehr weit nach unten gekommen, dahin, wo der Bach eine scharfe Biegung macht. Da entdeckten wir ihn. Sein Gesicht war nicht mehr zu erkennen. Im Bachbett muss es ihn immer wieder gegen dicke Steine geschleudert haben. Ihr könnt mir glauben, es war ein entsetzlicher Anblick! Wir haben ihn nur an der Kleidung wiedererkannt.«
Warum der Totengräber bestellt worden war, begriffen sogar wir Kinder, bis auf Anni vielleicht. Dann stellte Vroni eine Frage, deren Antwort uns alle interessierte: »Warum bestellt der Dati denn den Doktor, wenn der Toni schon tot ist?«
»Das ist Vorschrift«, antwortete der Opa anstelle seiner Tochter. »Der Arzt muss den Tod feststellen.«
»Und wozu bestellt der Dati die Polizei?«, schaltete sich nun auch Gregor ein. Diesmal antwortete die Oma: »Die Polizei muss untersuchen, ob nicht ein Verbrechen vorliegt.«
Auf diese Weise lernte ich schon als Vierjährige, wie der Ablauf nach einem Unglücksfall ist.
Den toten Toni durften wir nicht mehr anschauen. Aber wir durften alle hinter seinem kleinen weißen Sarg hergehen. Wir schluchzten entsetzlich, als der Sarg in die Erde hinabgelassen wurde. Danach haben wir tagelang nicht mehr unser Bauernhofspiel machen mögen. Und im Sommer sind wir auch nicht zum Bach gegangen zum Plantschen. Wie üblich sind die großen Buben am Morgen zur Schule marschiert und haben am Nachmittag mit uns Fangermandl oder Verstecken gespielt. So waren wir wenigstens am Nachmittag ein bisserl von unserem Schmerz abgelenkt. Die Oma konnte es aber bald nicht mehr mit ansehen, wie traurig wir kleinen Mädchen am Vormittag auf der Hausbank hockten und nichts mit uns anzufangen wussten. Deshalb suchte sie aus ihrem Flickkorb drei alte Wollsocken mit Löchern heraus. Auf die Löcher setzte sie bunte Flicken. Dann füllte sie die Spitzen mit Sägemehl und band sie so ab, dass Köpfe daraus entstanden. Sie nähte Knöpfe als Augen an und stickte Nase und Mund darauf. Den Sockenteil unterhalb des Kopfes füllte sie ebenfalls mit Sägemehl und formte den Leib der Puppe mit zwei Beinen. So waren drei wunderschöne Puppen entstanden, denen nichts fehlte außer Haaren und Armen. Vorerst kam die Großmutter gar nicht dazu, die fehlenden Teile zu ergänzen. Wir rissen ihr nämlich die unfertigen Puppen regelrecht aus den Händen, weil wir es nicht abwarten konnten, mit ihnen zu spielen. Vroni nannte ihre Strumpfpuppe Toni. Deshalb nannten wir die unseren ebenfalls so. Eine ganze Weile trugen wir unsere Tonis liebevoll herum. Bevor wir zum Mittagessen hineingerufen wurden, »bauten« wir Bettchen aus Gras und legten unsere Püppchen da hinein zum Mittagsschlaf. Am Abend nahm jede ihren Toni mit ins Bett. Manchmal setzten wir unsere drei Puppen nebeneinander auf die Hausbank und hielten ihnen einen Vortrag darüber, dass man nicht weglaufen darf, dass man nicht an den Bach gehen und vor allem, dass man nicht hineinsteigen darf. Wir schilderten unseren Tonis in den schlimmsten Farben, welch schreckliche Folgen das haben würde. Auf diese Weise verarbeiteten wir unsere Trauer. Und schon bald waren wir wieder die lebensfrohen kleinen Mädchen, die gerne Bauernhof spielten. Irgendwie wurden unsere Puppen mit in die Höfe eingebunden.
Im Herbst spielten wir mit bunten Blättern, die wir im Obstgarten fanden. Manchmal brachten uns die Buben Kastanien und Blätter von Kastanienbäumen aus dem Dorf mit. Damit ließ es sich ebenfalls herrlich spielen. Und ehe man sich versah, war wieder Advent. Diese Zeit liebten wir besonders. Vom ersten Tag an roch es im ganzen Haus nach Bratäpfeln, die bei Oma im Backrohr schmorten. Während jedes von uns einen Bratapfel verzehrte, erzählte Oma uns Märchen.
Noch schöner aber war es, wenn endlich der Nikolaustag kam. Vorher waren wir natürlich besonders brav, damit wir uns nicht vor der Rute des Krampus zu fürchten brauchten. Trotzdem zitterten wir, wenn der heilige Mann mit seinem Begleiter die Stube betrat. Noch heute sehe ich ihn deutlich vor mir. Er war gekleidet wie ein Bischof. Über einem weißen, schmalen Gewand, das mit einer weißen Kordel umgürtet war, trug er einen weiten, roten Umhang. Auf dem Kopf hatte er eine rote Mitra, die mit Goldrändern eingefasst war. Sein Gesicht war halb verdeckt von einem wallenden Bart. Hinter ihm schlurfte knurrend der furchterregende Krampus herein, mit schwarzem Gesicht, mit Hörnern auf dem Kopf und einem Sack über der Schulter. Der Heilige verwies ihn mit strengen Worten unter den Tisch: »Gib a Ruah, Krampus. Hier wohnen nur brave Kinder.«
In der Hand hielt Sankt Nikolaus ein großes, dickes Buch, in dem alle unsere Schandtaten, aber auch unsere guten Taten aufgeführt waren. Diese las er mit dunkler Stimme vor. Während wir leise vor uns hin bibberten und ergriffen lauschten, krähte Anni auf einmal dazwischen: »Kathi, Kathi!«
Die Erwachsenen traf fast der Schlag, und der »heilige Mann« hatte Mühe, Haltung zu bewahren. Zwar hatten die großen Buben von ihren Mitschülern längst erfahren, dass nicht der echte Nikolaus vom Himmel heruntersteigt, um den Kindern Äpfel und Nüsse zu bringen, dennoch zeigten sie großen Respekt. Wenn der heilige Mann bei uns in der Stube ihre Sünden vorlas, lauschten sie andächtig. Gewiss, seit ein, zwei Jahren hatten sie schon gerätselt, wer sich wohl unter der Verkleidung verbergen möge. Dass aber unsere Nachbarin Kathi im Gewand des Heiligen steckte, darauf waren sie nicht gekommen. Meinen Cousins war es sichtlich peinlich, dass nicht sie, sondern die kleine Anni die Nachbarin an der Stimme erkannt hatte. Dabei kannten sie die Kathi doch schon wesentlich länger. Auf ihrem Schulweg gingen sie ja täglich an deren Hof vorbei, und immer hatte diese freundliche Worte für sie übrig. Wir anderen kannten die Nachbarin natürlich auch. Wenn sie auf dem Weg zu ihrem Wald war, machte sie meist bei uns auf dem Hof eine kurze Rast, um mit Oma zu ratschen. Dabei schenkte sie schon mal jedem von uns einen Apfel, eine Birne oder ein paar Zwetschgen.
Nach dem Nikolausabend ging es mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Zumindest sahen das die Erwachsenen so. Uns Kindern dagegen ging es viel zu langsam. Jeden Abend fragten wir: »Wie oft müssen wir noch schlafen?«
Einige Tage vor Weihnachten waren plötzlich unsere Strumpfpuppen verschwunden. Als wir suchend durchs Haus irrten, erklärte unsere Großmutter: »Das Christkind hat die Puppen abgeholt, weil es gesehen hat, dass ihnen noch etwas fehlt. An Weihnachten bringt es sie wieder.«
Über diese Aussicht zeigten wir uns hocherfreut. Am Tag vor dem Heiligen Abend roch es im ganzen Haus nach Zimt und Honigkuchen. Auf unsere Frage erklärte uns die Oma: »Im Himmel hat das Christkind gar nicht so viel Platz, dass es für alle Kinder Platzerl backen kann. Deshalb schickt es kurz vor Weihnachten in jedes Haus einen Engel, der dort für die braven Kinder backt.«
Am Nachmittag des Heiligen Abends durften wir Kinder alle mit in den Stall zum Helfen. Das taten wir mit Begeisterung, damit Mami und Dati schneller fertig wurden, denn umso eher würde die Bescherung sein. Außerdem konnte das Christkind dann ungestört in der Stube alles für uns vorbereiten. Insgeheim hofften wir auch, dass die Gaben für uns reichlicher ausfallen würden, wenn wir recht fleißig wären. Zunächst hatte der Onkel ausgemistet und den Tieren frische Streu untergelegt. Dann stiegen die Buben auf den Heuboden und warfen durch ein quadratisches Loch Heu herab. Wir Dirndln nahmen davon so viel zwischen beide Arme, wie wir tragen konnten. Wir brachten es dem Dati, der es den Kühen in den Barn (Raufe) stopfte, während die Mami molk. Als die Buben fertig waren, stellten sie sich an die Stalltür, deren obere Hälfte geöffnet war, und schauten aufmerksam hinaus, während wir Mädchen noch mit Heutragen beschäftigt waren. Plötzlich rief Gregor ganz aufgeregt: »Da, da, schaut, da fliegt das Christkind!«
Wie auf Kommando ließen wir unser Heu fallen und sausten zur Tür. Wir waren noch zu klein, um über die Türhälfte schauen zu können. »Schnell, schnell, mach auf!«, rief Vroni ungeduldig. »Wir wollen das Christkind auch sehen.«
Die Buben kamen der Aufforderung sofort nach. Es war aber bereits zu spät. Vom Christkind war nichts mehr zu sehen. Wir erblickten nur den wolkenverhangenen Himmel. »Gerade ist es in den Wolken verschwunden«, erklärte Karl. Angespannt starrten wir nach oben, ob wir nicht vielleicht doch noch einen Zipfel seines Gewandes erspähen könnten. Weil wir es nicht selbst gesehen hatten, wollten wir von den beiden »Augenzeugen« wenigstens eine Beschreibung haben: »Was hatte es an? Wie hat es ausgesehen? Wie groß war es?«
Mit großen Augen und Ohren lauschten wir der Beschreibung der beiden Brüder, die sie abwechselnd von sich gaben: »Es war ungefähr so klein wie die Anni.« »Es hatte ein langes, weißes Gewand an.« »Es hatte silberne Flügel.« »Es hatte goldene Haare.«
Inzwischen waren Onkel und Tante mit der Arbeit fertig und tauschten ihre Stallkleidung gegen die normale Hauskleidung. Sie steuerten auf Omas Stube zu, und wir marschierten wie Orgelpfeifen hinterdrein. Uns strahlte ein Weihnachtsbaum entgegen, mit Kerzen und Lametta. Darunter stand ein Teller mit Lebkuchen und Platzerln. Ehe wir uns auf diese stürzten, stießen wir Jubelschreie aus. Unter dem Baum hatten wir unsere Puppen entdeckt. Alle drei saßen brav nebeneinander, sie sahen jedoch völlig verändert aus. Nur an den unterschiedlichen Knopfaugen waren sie noch zu erkennen. Die meine hatte Haare aus brauner Wolle, die von Vroni aus schwarzer Wolle und die von Anni aus heller Naturschafwolle. Und Arme hatten sie auch alle. Ja, sie waren sogar angezogen. Jeder Toni trug eine gestrickte Hose und eine gestrickte Weste, der eine in Blau, der andere in Rot und der dritte in Grün. Jetzt liebten wir unsere Puppenkinder noch mehr als zuvor. Dies war das schönste Weihnachtsfest, an das ich mich erinnern kann.
Erst Ende März, als der Schnee so langsam von Wiesen und Wegen verschwand, begannen wir wieder mit unserem Bauernhofspiel.
Im Jahr darauf an einem Vormittag – es muss im Juni gewesen sein, die Heuernte hatte nämlich noch nicht begonnen – geschah etwas Unerwartetes. Während ich mit Anni im Hof spielte – Vroni besuchte seit dem letzten Sommer ebenfalls die Schule –, tauchte plötzlich ein wildfremder Mann bei uns auf. Er wollte wissen, wo die Großmutter sei. Wir führten ihn in die Küche. Von der langen Unterhaltung, die er mit der Oma führte, bekamen wir leider nichts mit, denn sie hatte uns hinausgeschickt und die Tür zugemacht. Durch die offene Haustür konnten wir aber sehen, dass die Großmutter nach einer Weile in unserer Kammer verschwand und nach kurzer Zeit mit einem Bündel wieder herauskam. Dann rief sie die Anni zu sich, und neugierig wie ich war, blieb ich an ihrer Seite. Sie forderte Anni auf, ihre Schuhe anzuziehen. »Warum, Oma? Es regnet doch nicht.«
»Du hast eine weite Wanderung vor dir über einen steinigen Weg, da ist es besser, du hast Schuhe an.«
»Wieso das?«, wollte sie wissen, während sie brav in ihre Schuhe schlüpfte. Zugleich erklärte Oma dem erstaunten Kind: »Das ist dein Papa. Ab jetzt wirst du bei ihm wohnen.«
»Bei dem will ich aber nicht wohnen. Den kenne ich ja gar nicht.« Trotzig stampfte sie mit dem Fuß auf. »Ich will bei dir bleiben und bei der Fanni.«
»Jetzt red’ net lang ’rum«, mischte sich nun der Fremde ein, nahm der Oma das Bündel ab und packte meine Schwester mit der anderen Hand. Diese riss sich jedoch los, stürzte auf mich zu und klammerte sich an mir fest. Schützend legte ich beide Arme um meine kleine Schwester und versuchte sie festzuhalten. Doch was konnten zwei kleine Mädchen schon gegen zwei Erwachsene ausrichten? Die Oma hielt mich zurück, der Mann zerrte Anni von mir weg und verschwand mit ihr durch die Tür. Da halfen kein Strampeln und kein Schreien. Weinend rannte ich hinterher, aber der Eindringling war im Nu vom Hof verschwunden.
»Warum, Oma?«, schluchzte ich. »Warum hat der Mann die Anni mitgenommen?«
»Er hat das Recht dazu«, erklärte sie sachlich, aber ich sah, dass auch bei ihr Tränen in den Augen standen.
»Wieso hat er das Recht?«
»Er ist ihr Vater. Deine Mutter hat ihm schriftlich die Erlaubnis gegeben, dass er das Dirndl zu sich nehmen darf.«
Als die drei Großen von der Schule heimkamen, berichtete ich ihnen von der Ungeheuerlichkeit. Die Buben zuckten nur die Schultern. Vroni aber weinte auch, und wir trösteten uns gegenseitig. Von der Zeit an wurde unser Verhältnis noch enger. Da ihr klar war, dass ich nun an den Vormittagen allein war, überließ sie mir für die Morgenstunden großzügig ihren »Toni«. Nun hatte ich zwei »Kinder« zu betreuen und fühlte mich weniger einsam. Das half mir in der ersten Zeit wirklich über meine Traurigkeit hinweg. Bevor es zum Mittagessen ging, steckte ich beide Puppen in ein Doppelbett aus Gras, damit sie ihren Mittagsschlaf halten konnten. Wenn meine Cousine ihre Hausaufgaben erledigt hatte, weckten wir die Puppen auf und spielten Vater- Mutter-Kind. Mal war sie der Vater, mal ich.
Bald kam die Heuernte. Am Morgen ging ich schon mit aufs Feld, wo ich mithelfen durfte – oder musste? Die Kinder der Tante saßen während dieser Zeit ja in der Schule. Man drückte mir einen kleinen Rechen in die Hand, mit dem ich eifrig das Heu wendete und zusammenrechte.
Und dann rückte der Tag meiner Einschulung immer näher, darauf freute ich mich sehr. Die Oma war mit mir ins Dorf gewandert und hatte mir im Kramerladen einen Ranzen gekauft sowie eine Tafel, eine Griffeldose mit Inhalt und eine Fibel. Diese schaute ich mir immer wieder mal an. Es waren so schöne bunte Bilder darin und so komische Zeichen, die man Buchstaben nannte. Der erste war ein i, wie mir die Vroni verriet. Da ich immer wieder bettelte, nannte sie mir nach und nach auch die Namen der anderen. Daher kannte ich, bis ich in die Schule kam, alle Buchstaben. Da staunte die Lehrerin nur so. Doch noch mehr staunte sie, als wir die erste Singstunde hatten. Von vorne ging sie die ganze Reihe entlang, bis sie neben mir stehen blieb. »Ja, Fanni, du singst ja wie ein Engel! Du wirst bestimmt mal eine Sängerin.«
Das Wort Sängerin kannte ich aber nicht. Deshalb verstand ich »Sennerin« und antwortete: »Freilich, das werde ich ganz gewiss.« Meine Mutter war ja Sennerin gewesen, meine Großmutter ebenfalls und vermutlich auch schon die Urgroßmutter. Da war es doch logisch, dass ich auch Sennerin wurde. Und dass es für eine Sennerin von Vorteil war, wenn sie gut singen konnte, war mir auch klar. Die Oma hatte mir nämlich erzählt, dass sich die Sennerinnen von den umliegenden Almen immer wieder zu geselligen Abenden getroffen hatten, bei denen eifrig gesungen wurde.
Unsere Schule war eine zweiklassige. Es befanden sich also immer vier Jahrgänge in einem Klassenraum. Damit Vroni und ihre Brüder pünktlich um 8 Uhr in der Schule sein konnten, mussten sie bereits um 7 Uhr lostraben, im Winter meist noch etwas früher, weil sie sich durch den Schnee kämpfen mussten. Für die Erstklässler begann der Unterricht erst um neun, deshalb reichte es, wenn ich mich um kurz vor acht auf den Weg machte.
Meine Großmutter hielt etwa 25 Hühner, und da kam eine ansehnliche Menge an Eiern zusammen. Zwar gab es bei uns im Haus relativ häufig Eierspeisen, dennoch blieben viele Eier übrig. Davon packte meine Oma jede Woche zwei Dutzend in einen Korb, brachte sie ins Dorf und verkaufte sie an eine Gastwirtin. Dadurch verdiente sie sich ein paar Mark. Nachdem ich bereits einige Tage die Schule besucht hatte, meinte die Oma, ich könne doch auf meinem Schulweg die Eier bei der Wirtin abgeben, dann erspare sie sich den mühsamen Weg. Das Gehen fiel ihr nämlich zusehends schwerer. Die Aufgabe des Eierlieferanten übernahm ich gern. Weil meine Großmutter so viel für mich tat, war ich froh, auch mal was für sie tun zu können. Beim ersten Mal begleitete sie mich mit dem Eierkorb bis zum Gasthaus. Sie stellte mich der Wirtin vor und erklärte, dass ich künftig die Eier zu ihr bringen werde und dass sie mir unbesorgt das Geld mitgeben könne, denn ich sei nicht nur gescheit, sondern auch gewissenhaft.
Das mit der Eierlieferung klappte prima. Zu den zwei Dutzend Eiern legte die Oma meist noch vier oder fünf kleine Eier als Dreingabe. Darüber freute sich die Wirtin und schenkte mir manchmal ein Fünferl. Dieses Geld wanderte in meine Spardose.
Ende Oktober hatte es zwei Tage lang geregnet, sodass sich auf der Straße Pfützen gebildet hatten. Auch in unserem Hof gab es eine große Pfütze. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag kam überraschend ein Kälteeinbruch, weshalb sich auf allen Pfützen eine feste Eisschicht bildete. Nun hatten wir unser Sonntagsvergnügen. Mit Begeisterung und Schwung schlitterten die Buben auf der Eisfläche. Das beeindruckte uns Mädchen derart, dass wir es ihnen gleichtun wollten. Anfangs landeten wir mehrmals unsanft auf unseren Sitzflächen. Doch bald hatten wir den Dreh raus.
Am Montagmorgen sollte ich der Wirtin wieder Eier bringen. Da entdeckte ich auf einem ebenen Wegstück eine ansehnliche Pfütze, die mit Eis bedeckt war. Das war zu verlockend. Also nahm ich, mit dem Ranzen auf dem Rücken und dem Eierkorb in der Hand, Anlauf und schlitterte los. Entweder war mein Anlauf zu stark gewesen oder mit dem Korb in der Hand konnte ich nicht richtig balancieren, jedenfalls landete ich plötzlich auf meinem Allerwertesten. Schnell rappelte ich mich hoch und untersuchte den Inhalt meines Korbes. O weh, fünf Eier waren zu Bruch gegangen! Sie färbten nicht nur die untere Lage der Zeitung gelb, sondern auch die anderen Eier, die heil geblieben waren. So konnte ich den Korb keinesfalls abliefern. Doch ich wusste mir zu helfen. Auf meinem Weg führte ein paar hundert Meter weiter unten eine Brücke über einen Bach. Neben dieser Brücke gab es eine seichte Stelle, an der man ohne Gefahr ans Wasser konnte. Daneben breitete ich meine Jacke auf dem Boden aus, hob die Deckzeitung weg und gab sie beiseite. Dann legte ich vorsichtig die Eier der obersten Lage Stück für Stück auf meine Jacke. Ebenso verfuhr ich mit der zweiten Lage Eier. Die fünf kaputten Eier, die sich zuunterst im Korb befanden, sortierte ich aus und ließ sie als Schiffchen im Bach davonschwimmen. Die heilen Eier der untersten Schicht wusch ich sorgfältig ab und trocknete sie mit meinem Tafellappen. Die gelb gefärbte Zeitungslage knüllte ich zusammen und ließ sie ebenfalls im Bach schwimmen. Dann nahm ich von den sauberen Zeitungen jeweils die Hälfte, legte sie auf den Boden des Korbes und schichtete abwechselnd Eier und Zeitungspapier darauf. Da mir die Oma diesmal fünf kleine Zusatzeier mitgegeben hatte, die obenauf gelegen hatten und ganz geblieben waren, mischte ich sie unter die normalgroßen Eier. Mit der verdünnten oberen Zeitung deckte ich das Ganze ab und setzte meinen Weg frohgemut fort, mit dem guten Gefühl, der Wirtin werde nichts auffallen. Am Eingang zum Gasthaus drückte ich ihr – wie immer – den Korb in die Hand. »Heute bist aber spät dran«, stellte sie fest. »Ja, ja.« Schon rannte ich davon, damit ich noch pünktlich zur Schule kam. Nach dem Unterricht ging ich wieder an dem Gasthaus vorbei, um meinen leeren Korb abzuholen, der normalerweise auf der Hausbank stand und in dem das Geld abgezählt lag. Zu meiner Überraschung erwartete mich die Wirtin diesmal mit dem Korb in der Hand an der Haustür: »Fanni, sag deiner Oma einen schönen Gruß, das nächste Mal soll sie mir lauter große ordentliche Eier liefern und nicht so kleine ›Vogeleier‹ untermischen.«
»Ich werd’s ausrichten«, versicherte ich, schnappte meinen Korb und weg war ich. Diesmal gab es für mich keine Belohnung. Ehrlich gesagt, die hatte ich auch nicht verdient. Den Gruß an die Oma richtete ich wohlweislich nicht aus. Eines hatte ich bei der ganzen Geschichte gelernt: Man schlittert nicht mit einem Korb voll roher Eier.
In Zukunft lieferte ich wirklich nur einwandfreie Ware ab und zusätzlich vier oder fünf kleine Eier. Dann gab es für mich auch hin und wieder Trinkgeld.
Einige Wochen nach meinem siebten Geburtstag tauchte meine Mutter mal wieder auf. Sie sah sehr verändert aus. In meiner Erinnerung war sie eine schlanke Person gewesen, jetzt aber schob sie einen dicken Bauch vor sich her und kam schwer schnaufend den Berg herauf. Ehe sie mich entdecken konnte, versteckte ich mich unter der Treppe, die in den ersten Stock führte. Weil es ein warmer Tag war, stand die Küchentür offen. Daher bekam ich das Gespräch zwischen ihr und meiner Großmutter mit: »Grüß dich, Bärbel, sag bloß, du bist in anderen Umständen!«
Unter »anderen Umständen« konnte ich mir nichts vorstellen. An das, was meine Mutter geantwortet hat, erinnere ich mich nicht mehr. Was die Oma aber darauf erwidert hat, habe ich umso besser im Gedächtnis: »Bärbel, du musst nicht meinen, dass ich dir noch ein Kind aufziehe. Es muss mal Schluss sein. Indem ich die Fanni und die Anni aufgezogen habe, habe ich wirklich genug für dich getan.«
»Ja, aber die Anni ist doch schon über ein Jahr fort, und die Fanni ist alt genug, dass sie bei meinem neuen Kind die Kindsmagd spielen könnte. Dann ist die Belastung für dich doch nicht so groß.«
»Das stellst du dir so einfach vor. Die Fanni ist den ganzen Vormittag in der Schule, da müsste ich mich allein um dein Hascherl kümmern. Noch mal ein Kleines aufzuziehen, das pack ich nicht mehr, dazu bin ich zu alt.«
»Aber geh, Mutter, mit deinen 63 Jahren bist du doch noch nicht alt! Da kannst du leicht noch mal ein Kind aufziehen.«
»Bärbel, es sind nicht allein die Jahre, die zählen. Mein Herz macht nicht mehr mit. Außerdem geht es deinem Vater sehr schlecht. Ihn zu pflegen kostet mich viel Zeit und Kraft. Manchmal denke ich: Wer von uns beiden wird wohl als erster abberufen?«
»Ach, Mutter, so schlimm wird’s nicht sein.«
»Um uns beide steht es schlimmer, als du denkst. Glaub mir, wenn ich gesundheitlich besser beieinander wäre, würde ich dein Kind nehmen.«
Das schien meine Mutter nicht so recht zu glauben. Patzig antwortete sie: »Also gut, wenn du nicht willst, ich werde schon jemanden finden, der mir das Kind aufzieht.«
Mit beleidigter Miene rauschte sie ab.
Von diesem Augenblick an machte ich mir Sorgen um meine Großeltern, vor allem um die Oma. Was sollte aus mir werden, wenn sie nicht mehr da wäre? Den Großvater würde ich weniger vermissen, der hatte sich ohnehin nicht viel mit mir beschäftigt. In letzter Zeit blieb er immer öfter den ganzen Tag im Bett liegen, und wenn er mal aufstand, saß er nur still im Sessel und nahm am Leben nicht mehr teil. Der Oma sagte ich aber nichts von meiner Besorgnis. Sie brauchte nicht zu wissen, dass ich gelauscht hatte.
Es waren noch keine vier Wochen vergangen, da sahen wir Kinder, als wir von der Schule kamen, einen schwarzen Wagen auf unserem Hof, vor den ein schwarzes Pferd gespannt war. Zwei schwarzgekleidete Männer trugen gerade einen Sarg aus dem Haus und schoben ihn von hinten auf den Wagen. Oma stand neben der Haustür und tupfte sich mit ihrem Taschentuch die Augen. Mir wurde ganz bang ums Herz, weil mir bewusst wurde, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte. Auch meine Cousine und meine Cousins blieben betroffen stehen und schauten den Männern zu. Ängstlich klammerte ich mich an die Großmutter: »Warum sind die schwarzen Männer da? Warum tragen sie einen Sarg?«
Sie umarmte alle vier Enkel gleichzeitig und flüsterte uns zu: »Euer Opa liegt darin. Heute Nacht ist er für immer von uns gegangen. Für ihn war es eine Erlösung.«
Alles andere weiß ich nicht mehr, wann und wo die Beerdigung war und wo die anschließende Zehrung. Nur dunkel erinnere ich mich daran, dass meine Mutter auch anwesend war und dass ich mich bemühte, mich von ihr fernzuhalten.
Von dem Tag an, als die schwarzen Männer Opas Sarg auf den Totenwagen geladen hatten, war ich noch mehr in Sorge um meine Großmutter. Im Stall konnte sie schon lange nichts mehr tun, diese Arbeiten übernahmen Tante Heidi und ihr Mann. Auch wir Kinder wurden eingespannt. Die Buben mussten nun täglich vom Heuboden Futter herunterwerfen, sie mussten Holz hereintragen und für alle die Schuhe putzen. Die Schuhe waren oft sehr schmutzig, es gab ja noch keine geteerten Straßen, und wenn es regnete, waren die Schuhe voller Matsch.
Wir Dirndl mussten abspülen, Staub wischen, den Tisch decken und abräumen und die Hühner füttern. Bald kamen die großen Ferien und unsere kleinen Aufgaben wuchsen. Dennoch blieb uns eine angemessene Zeit zum Spielen. Nur an den Wildbach gingen wir nie wieder. Zu schmerzlich war in unserer Erinnerung, dass wir durch diesen Bach den kleinen Toni verloren hatten. Auch hatten wir Angst, uns könnte das gleiche Schicksal ereilen wie ihn.
Bald fiel mir auf, dass meine Großmutter ihre Wäsche nicht mehr waschen konnte. Diese Aufgabe übernahm Tochter Heidi für sie mit. Mich dagegen versorgte die Oma nach wie vor gut. Sie kochte für uns beide und achtete darauf, dass ich bei jeder Witterung passend gekleidet war.
Nach den Sommerferien kam ich in die zweite Klasse und verließ nun jeden Morgen mit den anderen Kindern das Haus. Natürlich hatte mir die Oma immer ein Pausenbrot in den Ranzen gepackt. Als wir davonsprangen, winkte sie uns nach, bis wir um die Biegung verschwunden waren.
Als am zweiten Schultag die neuen Erstklässler auftauchten, sah ich zu meiner Freude meine Schwester wieder. Sie war aber nicht mehr die Anni, die ich gekannt hatte. Ihre Lebhaftigkeit hatte sie verloren und sie verhielt sich mir gegenüber fremd. Selbst als ich einige Tage lang immer wieder auf sie zugegangen war, kam die alte Vertrautheit nicht mehr auf. Dann wagte ich einen letzten Versuch: »Anni, magst nicht mal die Oma besuchen? Die würde sich gewiss freuen.«
»Da muss ich erst mal daheim fragen, ob ich das darf.« Gespannt wartete ich auf ihre Antwort, die sie mir am nächsten Morgen in der Pause gab: »Der Papa erlaubt nicht, dass ich euch besuche. Und du darfst auch nicht zu mir kommen.«
Auch gut, dachte ich. Mir blieb ja meine Cousine Vroni, mit der ich mich gut verstand. Außerdem gab es in der Schule so viele Mädchen, mit denen man in der Pause spielen konnte. Die eine Hälfte des Schulhofes war für die Dirndl reserviert, die andere für die Buben. Ständig patrouillierte ein Lehrer an der gedachten Linie hin und her, damit es nur ja nicht zu Grenzverletzungen kommen sollte. Ja, damals herrschten noch strenge Sitten!
Wir Mädchen machten meist Kreisspiele oder Seilspringen. Der einen oder anderen war es gelungen, daheim einen Kälberstrick zu entwenden, der bereits schadhaft war. Band man zwei solcher Stricke aneinander, war das Seil lang genug, sodass es von zwei Mädchen geschlagen werden konnte. Die anderen versuchten hineinzulaufen und im gleichen Takt zu springen. Gelang das einer nicht, sodass sie das Seil zum Stillstand brachte, musste sie eine der Schlägerinnen ablösen und diese durfte dann springen.
Was die Buben in ihrer Ecke spielten, bekamen wir nicht mit, weil wir zu sehr mit unseren eigenen Spielen beschäftigt waren.
Eines Morgens Ende September schien die Sonne schon hell ins Zimmer, als ich aufwachte. Komisch, dachte ich, hat die Oma etwa vergessen, mich zu wecken? Schnell sprang ich aus dem Bett, schlüpfte in meine Kleidung und lief in die Küche. Keine Oma zu sehen, kein Frühstückstisch gedeckt. Vielleicht war die Oma krank. Mit einem unguten Gefühl betrat ich ihre Kammer, wo sie mit geschlossenen Augen im Bett lag und noch zu schlafen schien. »Oma! Oma!«, rief ich. Doch sie rührte sich nicht. Deshalb trat ich näher heran und versuchte sie wachzurütteln. Das nützte auch nichts. In Panik griff ich nach ihrer Hand. Diese, die sonst immer warm und weich gewesen war, war kalt und steif. Schreiend lief ich die Treppe hinauf: »Die Oma! Die Oma!«
Die Kinder der Tante kamen gerade ordentlich frisiert und mit ihren Ranzen auf dem Rücken aus der Küche, und ich stand da mit zerzausten Haaren.
»Was ist los, Fanni?«, fragte die Tante beunruhigt. »Die Oma! Die Oma!«, schrie ich abermals. Mehr brachte ich nicht heraus.
Tante Heidi lief nach unten. Sofort hatte sie begriffen, was geschehen war. Sie machte mir ein Pausenbrot und steckte es in meinen Ranzen. Zum Frühstücken blieb mir keine Zeit mehr. »Ihr geht jetzt wie immer in die Schule, das lenkt euch am besten ab.«
Ihren Söhnen trug die Heidi auf, den Doktor und den Totengräber zu bestellen und dem Herrn Pfarrer Bescheid zu sagen. Wir Mädchen sollten die Buben beim Lehrer entschuldigen, weil sie etwas zu spät kommen würden.
In der Schule konnte ich mich nicht konzentrieren. Immer wieder sah ich das Bild der Großmutter vor mir, wie sie leblos in ihrem Bett lag. »Was ist mit dir los?«, fragte die Lehrerin, der meine abwesende Haltung auffiel.
»Die Oma, meine Oma«, stieß ich hervor. »Ich glaube, sie ist tot.«
Endlich kamen die erlösenden Tränen und ich löste mich aus meiner Schockstarre. Auf dem Heimweg redeten wir Enkel unentwegt über die Großmutter. Als wir heimkamen, hatte der Leichenwagen sie bereits abgeholt. Von außen sah alles aus wie immer, nur drinnen in Omas Küche erwartete mich kein liebevoll gedeckter Tisch. Stattdessen fing mich Tante Heidi an der Haustür ab: »Zum Essen kommst du natürlich zu uns.« Sie hatte gewiss etwas Gutes gekocht, doch vor Kummer brachte ich kaum einen Bissen hinunter. Nach dem Mahl sagte sie: »Bei der Beerdigung muss ich mit deiner Mutter klären, was aus dir wird.«
Hoffentlich muss ich nicht zu meiner Mutter, war mein erster Gedanke. »Darf ich bei euch bleiben?«, flehte ich geradezu. »Ich will auch immer brav sein und dir helfen, so viel ich kann.« Sie fuhr mir mit der Hand liebevoll über den Kopf: »Ist schon recht, armes Hascherl. Ich würde dich schon gern nehmen. Das habe ich aber nicht allein zu entscheiden. In dieser Sache hat deine Mutter das letzte Wort.«
Nach einigen Tagen fand die Beerdigung statt, an der wir Kinder nicht teilnehmen durften. Das sei nichts für uns, wurde uns gesagt. Wir gingen an diesem Tag wie üblich zur Schule. Allerdings verließen Onkel und Tante, völlig in Schwarz gekleidet, am Morgen mit uns das Haus. Nach Unterrichtsschluss holten sie uns an der Schule ab und stiegen mit uns gemeinsam den Berg hinan. Zum Mittagessen wärmte Heidi für uns Kinder eine Suppe auf, die sie noch vom Vortag hatte. Sie und der Onkel hatten bereits im Gasthaus am Beerdigungsmahl teilgenommen.
Was meine Tante mit meiner Mutter besprochen hatte, erfuhr ich nicht. Das Gespräch muss aber zu meinen Gunsten ausgefallen sein, denn noch am selben Tag schaffte Heidi mit ihrem Mann mein Bett in Vronis Kammer und hängte meine Kleidung in deren Schrank. Onkel Sepp zeigte nicht gerade große Begeisterung, dass ich von nun an zur Familie gehörte. Er tat mir aber auch nichts und gab mir nie ein böses Wort.
Innerhalb des Hauses fand ein weiterer kleiner Umzug statt. Die Familie der Tante zog nach unten in Omas Küche und Stube. Dadurch wurde das Leben für uns alle wesentlich bequemer. Wir brauchten das Brennholz nicht mehr in den ersten Stock zu schleppen, und vor allem brauchte man das Wasser vom Brunnen nur noch ins Erdgeschoss zu tragen.
Bisher hatten wir vier Kinder unsere Freizeit ohnehin wie Geschwister verbracht. Nun wurde ich vollends in die Familie integriert. Von da an nannte ich Onkel und Tante auch Mami und Dati, wie ich das von deren Kindern gehört hatte. Dennoch fehlte mir die Großmutter sehr, und ich weinte mich oft in den Schlaf. Doch mit der Zeit heilte auch diese Wunde.
Eines Tages aber wurde sie durch ein Erlebnis in der Schule wieder aufgerissen.
Aus irgendeinem Grunde wurden in der Klasse die Vor- und Zunamen der Kinder verlesen. Wenn man seinen Namen hörte, musste man die Hand heben. Dabei fiel mir auf, dass Anni und ich den gleichen Familiennamen hatten, während Vroni, die bereits im dritten, und ihr Bruder Karl, der schon im vierten Schuljahr war, einen anderen Namen hatten. Das war nicht nur mir aufgefallen, sondern Vroni und Karl ebenfalls. Diese unterschiedlichen Namen bildeten nun das Gesprächsthema am Mittagstisch. »Warum hat die Fanni einen anderen Familiennamen als wir?«, wollte Karl wissen.
»Das ist ganz einfach zu erklären«, ergriff Dati, der sonst ein ziemlich Stiller war, das Wort. »Weil ihr unterschiedliche Mütter habt. Ihr drei«, er deutete mit dem Finger auf seine Sprösslinge, »seid die Kinder von Heidi, während die Fanni das Kind von deren Schwester Bärbel ist.«
Mit dieser Erklärung gab sich Gregor aber nicht zufrieden. »Wenn unsere Mütter Schwestern sind, dann müssten wir trotzdem den gleichen Namen haben.«
»Eben nicht«, erläuterte Dati. »Eure Mutter hat mich geheiratet und mit der Heirat meinen Namen angenommen. Fannis Mutter ist ledig, trägt daher noch ihren Mädchennamen und hat den an ihre Tochter weitergegeben.« Nun kannten wir uns einigermaßen aus.
Beim Spielen waren wir Geschwisterkinder meist ein Herz und eine Seele. Manchmal aber entstand aus nichtigem Anlass ein Streit. So kam es vor, wenn wir bei uns auf dem Hof mit Schussern spielten (in anderen Gegenden nennt man die kleinen Kugeln Klicker, Mürbel, Murmeln, Marbel oder Märbel), dass einer meinte, er sei übervorteilt worden. Andere Kinder besaßen schöne bunte Glaskugeln oder auch welche aus Metall. Doch wir waren mit unseren einfachen billigen Tonkugeln zufrieden und spielten so ernstlich damit, als seien sie etwas Wertvolles. Die Schusser galt es in eine Kuhle zu werfen, zu schnicken oder zu schießen.
Verlor einer der Cousins einige Tonschusser an mich, wurde er wütend und rief mir zu: »Du gehörst ja gar nicht zu uns! Du darfst unsere Eltern nicht mehr Mami und Dati nennen! Sie sind ja nicht deine Eltern.« So grausam können Kinder sein. Solche Äußerungen taten mir immer sehr weh, und ich zog mich weinend in eine Ecke zurück.
Einmal hat Tante Heidi solche gehässigen Bemerkungen von ihren Buben aufgeschnappt. Sogleich hat sie sich diese zur Brust genommen: »Ja, schämt ihr euch gar nicht? Wie könnt ihr nur so herzlos zur Fanni sein! Es ist schon schlimm genug, dass sie keinen Vater hat und dass ihre Mutter einfach davongegangen ist. Nun, da ihre Oma auch noch gestorben ist, steht sie mutterseelenallein auf der Welt. Wir sind jetzt ihre Familie. Euer Dati und ich versuchen, ihr die Eltern, so gut es geht, zu ersetzen. Und von euch erwarte ich, dass ihr dabei mithelft, dass sich die arme Fanni bei uns wohlfühlt. In Zukunft will ich also keine gehässigen Bemerkungen mehr gegen das arme Kind hören.«
Diese Gardinenpredigt hatte ich unabsichtlich in meiner »Trauerecke« mitbekommen. Da flossen meine Tränen erst recht. In dem Augenblick wurde ich mir erst richtig der Tatsache bewusst, wie allein ich auf der Welt stand. Ich hatte keinen Vater, meine Mutter hatte mich verlassen und meine Schwester war mir entrissen worden. Nach diesem Gedankengang gewann ich die Überzeugung, ich sei der bedauernswerteste Mensch auf der ganzen Welt.
Doch wenig später holte mich Vroni aus meinem Selbstmitleid heraus. Sie kam mit ihrem »Toni« auf mich zu und brachte den meinen gleich mit: »Komm, wir spielen ›Vater Mutter Kind‹.« Diesen Vorschlag brauchte sie mir nicht zweimal zu machen. Mal war sie der Vater, mal war ich es. Wir gingen mit unseren Puppen nicht nur spazieren, wir zogen sie auch immer wieder um. Aus Wollresten hatten wir ihnen einiges an Kleidungsstücken gehäkelt und gestrickt. Mami hatte uns nämlich vor einiger Zeit Häkeln und Stricken beigebracht.
Die Predigt meiner Tante an ihre Söhne zeigte Wirkung. Von ihnen bekam ich nie wieder ein böses Wort in dieser Richtung zu hören. Obwohl Onkel und Tante sich bemühten, mir Vater und Mutter zu ersetzen, und obwohl wir wie Geschwister aufgewachsen sind, wurden wir nicht gleichbehandelt. Das ist mir damals aber nicht so bewusst gewesen. Erst als ich im Erwachsenenalter zurückdachte, erkannte ich, dass ich eigentlich die Aschenputtel-Rolle in der Familie gespielt habe. Ich wurde immer mehr eingespannt als die anderen. Vor allem blieb alles, was die anderen nicht tun mochten, an mir hängen. So musste ich bereits im Alter von zehn Jahren melken lernen, während Vroni, obwohl sie ein Jahr älter war als ich, noch nicht dazu angehalten wurde. Auch musste ich schon früh bei den Hühnern ausmisten, was sehr unangenehm war. Immer wenn eine Arbeit anstand, die keiner machen wollte, dann hieß es: »Das kann die Fanni machen.«
Auch nach dem Tod von Oma erschien meine Mutter auf dem Hof, allerdings wesentlich seltener als zuvor. Sie kam, um ihre Schwester zu besuchen, vielleicht auch um mich zu sehen. Doch jedes Mal ergriff ich die Flucht. Sie ist von mir nie als Mutter anerkannt worden. Ich konnte es ihr nie vergessen, dass sie mich als Vierjährige im Stich gelassen hatte. Nach dem Tod meiner Großmutter hätte sie einiges wieder gutmachen können, indem sie mich zu sich genommen hätte. Zugegeben, damals war ich heilfroh, dass sie das nicht getan hat. Sie hätte mich aus meiner gewohnten Umgebung und aus meinem »Geschwisterkreis« herausgerissen. Bei ihr waren es aber mit Sicherheit nicht diese Überlegungen, die sie geleitet hatten. Meiner Überzeugung nach wäre ich ihr nur im Weg gewesen. Egoistisch hatte sie nur ihr eigenes Wohlergehen im Auge gehabt, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was aus ihren Kindern werde.
Der Januar und der Februar waren für uns Kinder wunderbare Monate. Dann ging’s zum Schlittenfahren. Das Gelände oberhalb unseres Hauses war dazu ideal. Nicht nur wir vom Mahrend-Hof tummelten uns dort, auch Kinder aus der Nachbarschaft kamen mit ihren Schlitten herüber, sodass immer eine Mordsgaudi war. Wir vier Kinder hatten zusammen nur zwei Schlitten, und bei anderen Familien sah es ähnlich aus. Also saßen immer zwei Kinder auf einem Schlitten. Meist rodelte ich mit Vroni ganz brav den Berg hinab, wobei sie hinter mir saß und lenkte. Weil bei meinen Cousins häufig Streit entbrannte, wer von beiden lenken dürfe, machten sie uns einen großherzigen Vorschlag: Vroni durfte mit Gregor fahren und ich mit Karl. Da ging es schon wesentlich rasanter zu als bei uns Dirndln. Von Jahr zu Jahr kamen die Buben auf verrücktere Ideen. Meine Cousins, wie auch die Nachbarsbuben, wollten gerne bäuchlings fahren, wodurch aber der ganze Schlitten belegt war. Sie hätten uns den Schlitten abgenommen, und wir Mädchen hätten in dieser Zeit dumm herumgestanden. Das akzeptierten wir aber nicht. Also erlaubten sie uns großzügig, uns auf ihre Rücken zu setzen. Das war ihnen aber noch nicht verrückt genug. Sie kamen auf die Idee, die beiden Schlitten aneinanderzuhängen. Bei der rasanten Talfahrt schlingerte der hintere Schlitten, auf dem wir Mädchen saßen, ganz schön hin und her. Das störte uns aber nicht, im Gegenteil, wir quietschten vor Vergnügen.
Jedes Jahr kam man zusätzlich auf noch ausgefallenere Ideen. Man hängte drei Schlitten aneinander, im Jahr darauf vier, und als ich zehn Jahre zählte, waren es gar fünf. Mit Vroni kam ich auf dem vorletzten Schlitten zu sitzen. Dann ging die Post ab, aber wie! Dem Hansi, unserem dreizehnjährigen »Steuermann«, der auf dem ersten Schlitten saß, genügte es nicht, einfach nur geradeaus ins Tal zu lenken. Unter der Fahrt wurde er immer mutiger und baute immer gewagtere Kurven ein. Dadurch schleuderten besonders die beiden letzten Schlitten hin und her. Plötzlich kippten sie um, ein Schrei und wir landeten im Schnee. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, aber die vorderen Schlitten sausten weiter und rissen die leeren Schlitten mit sich. Dabei erwischte mich der letzte Schlitten heftig an der Nase. Die kleine Platzwunde, die ein bisschen blutete, tupfte ich mit meinem Taschentuch ab. Nach dem ersten Schreck aber tat mir die Nase so weh, dass mir an diesem Tag die Lust am Rodeln vergangen war.
Der Mami erzählte ich nichts von meinem kleinen Unfall, ich befürchtete, sonst ließe sie mich nicht mehr mit zum Schneeberg. Vor allem aber war meine Sorge, die Buben würden mich für eine Tratschtante halten und mich nicht mehr mitnehmen. Heidi fiel zwar die kleine Macke an meiner Nase auf, doch ich erklärte ihr: »Das ist nichts Schlimmes. Ich habe mich am Küchenschrank gestoßen.«
Am folgenden Tag blieb ich freiwillig daheim und schützte vor, ich müsse viel für die Schule arbeiten. In den Tagen danach war ich zwar wieder mit von der Partie, rodelte aber nur ganz brav mit meiner Cousine auf dem Zweisitzer. Die Wunde auf meinem armen, geschundenen Riechorgan war bald verheilt, aber es tat mir noch wochenlang weh. Erst als ich 21 war, bemühte ich mich zum Arzt, weil ich seit dem Unfall schlecht Luft bekam. Dieser stellte fest, dass das Nasenbein gebrochen gewesen und falsch zusammengeheilt war. Das ließ sich zwar nicht mehr korrigieren, aber er konnte mir Linderung verschaffen.
Kaum, dass ich zehn Jahre alt war, musste ich 1936 Mitglied im Jungmädelbund werden, sonst hätte meine Familie erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Vroni gehörte auch schon dazu. Anfangs machte es mir sogar Spaß, einmal in der Woche an den nachmittäglichen Zusammenkünften teilzunehmen. Dort wurde gesungen, musiziert und gebastelt. Wir lernten Volkstänze und machten kleine Wanderungen in der Umgebung. Was mir allerdings weniger gefiel, waren die regelmäßigen politischen Vorträge. Da sie für mich stinklangweilig waren, ließ ich sie zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Die Treffen begannen um 15 Uhr. Mir wäre also nicht genug Zeit geblieben, nach dem Unterricht zum Mittagessen heimzugehen und pünktlich wieder im Dorf zu sein. Daher hatte meine Mutter mit einer Cousine, die im Dorf wohnte, ausgemacht, dass die Vroni und ich bei ihr zu Mittag essen durften. Natürlich zahlte die Mami eine kleine Entschädigung dafür.
Der Mahrend-Hof liegt auf etwa 850 Meter Meereshöhe. Einige Wiesen befinden sich auf gleicher Höhe, einige weiter unten, die meisten aber oberhalb. Zu diesem Hof gehört keine Alm. Für unser Weidevieh wurden die steileren Wiesen, die oberhalb lagen, mit Stacheldraht eingezäunt. Ab Mitte Mai trieben wir die Viecher am Morgen in eine solche Wiese, damit sie sich ihr Futter selbst suchten. Am Abend zur Melkzeit holten wir sie wieder heim. Alle anderen Wiesen wurden zweimal im Jahr gemäht. Die erste Mahd war im Juni, die zweite im August. Das Heu von diesen Wiesen, das im Hofstadl nicht Platz fand, wurde in Feldscheunen gelagert. Meist konnten wir unsere Rinder bis Anfang oder Mitte Oktober grasen lassen. Danach verfütterten wir, solange noch nicht viel Schnee lag, das Heu aus den Feldscheunen. Oft lag der Schnee ab November bereits so hoch, dass wir das Heu nicht mehr herholen konnten. Dann mussten wir von dem Vorrat aus dem Hofstadl nehmen. Dieser reichte meist bis Mitte März. Bis dahin war der Schnee schon so zusammengesackt, dass man zumindest mit einem großen Schlitten und einem Pferd davor Futter holen konnte. Man brachte gleich eine größere Menge und lagerte sie auf dem Heuboden über dem Kuhstall, auf dem ja mittlerweile Platz war. Dem Sonnenschein und der abnehmenden Schneehöhe war nämlich nicht zu trauen. Manchmal gab es Ende März oder gar in den ersten Aprilwochen noch mal so viel Schnee, dass man wieder für Wochen an keinen Feldstadl kam.
Je älter ich wurde, desto mehr wurde ich in die Landwirtschaft eingespannt, beim Heumachen, beim Füttern, beim Melken. Mit elf Jahren beherrschte ich diese Tätigkeit schon perfekt. Deshalb musste ich jeden Morgen, bevor ich mich auf den Schulweg machte, meine drei Kühe melken. Die Tante molk die anderen vier.
Für seine Tiere braucht man ja nicht nur Futter, sondern auch Streu, damit sie nicht auf dem blanken Boden liegen. Im Sommer benötigte man natürlich weniger, weil sie den ganzen Tag auf der Weide waren. Mir war bekannt, dass man im Flachland zum Einstreuen Stroh nahm. Bei uns aber fiel kein Stroh an, weil wir kein Getreide anbauten. Wieder woanders streute man Laub ein. An Laub mangelte es uns aber auch, weil zu unserem Hof nur Nadelwald gehörte. Doch erfinderisch, wie die Menschen schon zu allen Zeiten gewesen sind, hatten schon unsere Vorfahren ein anderes geeignetes Material gefunden, das in ausreichender Menge bei uns wuchs. Wie fast jeder Bauer in unserer Region besaßen wir unterhalb des Hofes ein Grundstück, das nahezu tischeben war. Wenn es regnete oder wenn die Schneeschmelze einsetzte, konnte das Wasser nicht abfließen. Also stand dieses Feld wochen- oder gar monatelang unter Wasser und entwickelte sich zu einem Sumpfgelände. Normales Gras konnte darauf nicht wachsen, somit war das Feld im Grunde genommen für die Viehwirtschaft unbrauchbar. Auf diesen Feuchtwiesen gediehen aber verschiedene Arten von Sumpfpflanzen prächtig. Diese waren zwar zum Verfüttern zu hart, aber sie ergaben eine vorzügliche Streu. Mit der Ernte musste man allerdings bis Ende August warten, bis man diese Felder betreten konnte ohne einzusinken. Bis dahin waren die Pflanzen, die zum Teil mehr als mannshoch wuchsen, dürr geworden und ließen sich gut mit der Sense mähen. Mit dem Wagen konnte man nicht in die Feuchtwiese fahren, der wäre womöglich stecken geblieben. Pferd und Wagen ließ man vorsichtshalber am Rand auf festem Grund stehen. Der Onkel mähte, und alle verfügbaren Hände nahmen von ihm jeweils einen Arm voll von dem Gemähten in Empfang, trugen es zum Wagen, und eine Person stapelte es vorschriftsmäßig. Wir arbeiteten wie am Fließband. Das klappte ganz gut. War der Wagen voll, lud man in der Scheune ab und machte sich auf zur nächsten Fuhre. War alles eingebracht, wurden die knochentrockenen Pflanzen mit der Gsotmaschine, so nannte man bei uns den handbetriebenen Häcksler, zerkleinert. Durch ein Loch im Boden fiel das Streugut in den Raum unterhalb, der durch eine Tür mit dem Stall verbunden war. So konnte man von dort das Material bequem in den Stall bringen und einstreuen.
Gregor, der vorgesehene Hoferbe, kam 1937 aus der Schule. Mein Onkel Sepp, sein Vater, hatte im Ersten Weltkrieg einen Schulterdurchschuss erlitten. Diese Verwundung machte ihm sein Leben lang zu schaffen. Nur mit Mühe hatte er die Landwirtschaft betreiben können. Nun war er glücklich, dass sein Sohn ihm nach und nach die schweren Arbeiten abnehmen konnte. Im Jahr darauf war auch für Karl die Schulzeit zu Ende. Seine Eltern waren froh, dass sie ihn beim staatlichen Forstamt unterbringen konnten, wo er eine Lehre als Holzknecht begann. Es konnte ja immer nur einer den Hof übernehmen, deshalb schätzte sich jeder Bauer glücklich, dessen Sohn im Staatsforst arbeiten konnte. In jener Zeit war Holzknecht ein angesehener und krisensicherer Beruf.
Schon bald sollte auch für mich und meine Cousine der Ernst des Lebens beginnen.