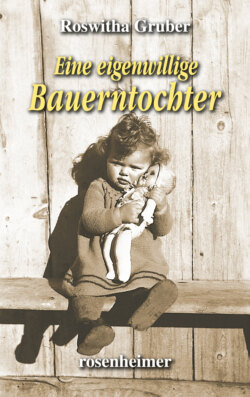Читать книгу Eine eigenwillige Bauerntochter - Roswitha Gruber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBei uns daheim
Die Felder, die zu Kaspers neu erworbenem Anwesen gehörten, lagen alle um die Gebäude herum. Die zögerlichen Erben waren wenigstens so gescheit gewesen, dass sie diese bisher verpachtet hatten. Das hatte ihnen nicht nur ein bisschen Pachtzins eingebracht, die Felder waren auch bearbeitet worden und deshalb nicht verwildert. Gleich nach Abschluss des Kaufvertrages hatte Kasper den Pächtern gekündigt. Daher konnte er die Felder nach einem Jahr selbst bewirtschaften. Bis dahin war das Haus auch bezugsfertig. Für das eine Jahr hatte Kasper noch Pacht kassiert, was ihm beim Kauf des Viehs dann zugute kam. Noch vor der Hochzeit hatte sich das Paar nach passenden Tieren umgeschaut. Einen Ochsen oder gar ein Pferd konnten sie sich nicht leisten, aber drei Kühe. Dabei achteten sie darauf, dass zwei davon zum Pflügen und zum Wagenziehen abgerichtet worden waren. Zwei Schweine kauften sie auch, Federvieh dagegen hatten sie von ihren Eltern bekommen, als Bestandteil des Heiratsgutes. Jedes bekam von daheim einige Hühner, ein Gänsepaar und etliche Tauben. Damit sich die Hühner vermehren konnten, bekam Kasper zusätzlich noch einen Gockel. Auch die Tauben waren kein Luxusgut. Sie vermehrten sich eifrig, und war der Bestand groß genug, landeten einige von ihnen als sonntäglicher Leckerbissen im Bratrohr.
Die alten Ackergeräte waren zwar stark verrostet, taten ihren Dienst aber noch einwandfrei. Für Möbel brauchten meine Eltern zunächst auch kein Geld auszugeben. Bescheiden, wie sie waren, begnügten sie sich jahrelang mit dem alten Mobiliar, das noch von den verstorbenen Bauersleuten stammte.
Soweit ich mich erinnere, war das Bauernhaus sehr klein. Eigentlich war es kein Haus, sondern eher ein Häuschen. Das Erdgeschoss bestand aus einer Küche mit Speisekammer, einer Stube und einem winzigen Raum, in dem zwei Betten standen. Das Obergeschoss befand sich direkt unter dem Dach. Außer einer kleinen Abstellkammer gab es dort zwei geräumige Schlafzimmer. In meiner Kindheit sah das so aus: Eines war die Bubenkammer, das andere die Dirndlkammer. In jeder standen unter der Dachschräge vier Betten. An der geraden Wand, den Betten gegenüber, stand ein Kleiderschrank. Bei der Heirat meiner Eltern muss das alles noch ganz anders ausgesehen haben. Als das Paar einzog, hatten in den Kammern unter jeder Dachschräge nur jeweils zwei Betten gestanden. Es gab auch keine Kleiderschränke. Meine Mutter erzählte mir, dass sie die Schränke erst wesentlich später angeschafft hatten. Das bisschen Gewand, das sie besaßen, hatten sie, genau wie es die Vorbesitzer gehandhabt hatten, viele Jahre lang an die Haken gehängt, die an den geraden Wänden angebracht gewesen waren.
Vor dem Haus hatten meine Eltern einen verwilderten Garten vorgefunden, dessen Lattenzaun total zusammengebrochen war. Eine der ersten »Amtshandlungen« meines Vaters war es gewesen, die Überreste des Zauns wegzuräumen und als Brennholz beiseitezulegen. Die Wildnis pflügte er kurzerhand um. Nachdem das Unkraut unter der Erde verschwunden und weitgehend vermodert war, ging er mit der Egge darüber. Dann grenzte er den Garten mit einem soliden Lattenzaun vom übrigen Hof ab, damit die Hühner nicht hineinlaufen und das Eingesäte wegpicken konnten. Einsäen konnte die Mutter aber erst im folgenden Frühjahr. Aus der anfänglichen Wildnis hatten beide schon bald einen fruchtbaren Nutzgarten gezaubert, der die Familie fast das ganze Jahr über mit allem versorgte, was damals in unserer Region wuchs: Zwiebeln, Lauch, Möhren, Kopfsalat, Gurken, Radieschen, Bohnen, Erbsen, Blaukraut und Weißkraut. Auch Petersilie und Schnittlauch fehlten nicht. Ja, sogar Frühkartoffeln erntete sie aus ihrem Garten.
Für die Winterkartoffeln hatte der Vater ein ganzes Feld angelegt. Hinter dem Haus standen noch einige Obstbäume, die allerdings recht verwahrlost wirkten. Von einem Nachbarn, der sich mit der Pflege von Obstbäumen auskannte, ließ er sie schneiden. Danach hatten wir von Juli bis Oktober unser frisches Obst. Auch im Winter profitierten wir davon. Äpfel wurden in dem kleinen Keller unter der Küche gelagert. Aus Zwetschgen und Birnen wurde Dörrobst gemacht, und viele Jahre später, als es Weckgläser gab, wurden Kirschen, Zwetschgen und Birnen eingemacht, sodass wir den ganzen Winter über Kompott hatten.
Im Hof neben dem Nutzgarten befand sich der Ziehbrunnen, aus dem wir unser Trink- und Brauchwasser schöpften. Dieses Wasser war aber zu kostbar, um damit den Nutzgarten zu gießen, falls es einmal längere Zeit nicht geregnet hatte. Zum Gießen benutzten wir Regenwasser. Beim Decken der Dächer hatte der Vater genügend Weitblick bewiesen und ordentliche Dachrinnen und solide Fallrohre an allen vier Ecken anbringen lassen. Unter jedem stand ein Regenfass, in dem das wertvolle Nass aufgefangen wurde. Zum Wäschewaschen benutzte die Mutter dieses Wasser auch gerne, weil es weich war, sodass man weniger Waschpulver benötigte.
Meine Eltern waren sehr glücklich, als sie endlich beisammen sein konnten. Dass ihr Leben nicht einfach werden würde, war ihnen von vorneherein klar gewesen. Dass sie sich von früh bis spät im Stall und auf den Feldern abrackern mussten, hatten sie ebenfalls gewusst. Dennoch waren beide selig, ihren Traum vom eigenen Bauernhof verwirklicht zu haben. Damit ein bisschen Bargeld einging und sie schneller von ihren Schulden herunterkommen würden, nahm mein Vater, nachdem die eigenen Gebäude und Felder instand gesetzt waren, wieder eine Tätigkeit als Zimmermann an. Er hatte das Glück, bei einem Meister angestellt zu werden, der seine Werkstatt in Maierklopfen hatte. So kam er jeden Abend heim und konnte seine Feldarbeiten erledigen. Meine Mutter kam mit dem Stall ganz gut allein zurecht.
Für beide bedeutete es ein weiteres Glück, als übers Jahr ein gesundes Kind in der Wiege lag. Die Wiege hatten sie in der Abstellkammer gefunden, auf dem Holz war die Jahreszahl 1754 zu lesen. Vermutlich hatten die Ahnen unserer Vorbesitzer diese voller Stolz über ihren Stammhalter aufmalen lassen. Meine Eltern waren nicht enttäuscht, dass ihr erstes Kind ein Mädchen war. Sie gaben ihm den Namen Maria, und die junge Mutter meinte: »Dann haben wir schon mal eine Kindsmagd für die anderen, die noch kommen werden.«
Kasper sah das ebenso positiv: »Ein Dirndl ist gut, so hast du bald eine Hilfe im Haushalt.«
Im Jahr darauf kam ein Bub zur Welt. Zur Enttäuschung seiner Eltern war er so schwächlich, dass er keine Überlebenschance hatte. In der Nottaufe durch die Hebamme bekam er den Verlegenheitsnamen Toni, denn seinen eigenen Namen wollte der Bauer aufheben für seinen Hoferben. Der kleine Toni starb nach einigen Stunden.
Als im Jahre 1911 Tochter Anna zur Welt kam, waren die jungen Eltern nicht allzu enttäuscht. Doch als 1913 mit Jung-Kasper endlich der Stammhalter in der alten Wiege lag, jubelten sie.
Ein Jahr später brachte Anna wieder ein Mädchen zur Welt. Es bekam den Namen Elisabeth. Im Sommer desselben Jahres brach leider der unselige Krieg aus. Anfangs hatte mein Vater noch Glück, aber nach dem ersten Kriegsjahr wurde auch er zu den Waffen gerufen. Nun stand meine Mutter allein da mit der Landwirtschaft und vier kleinen Kindern, von denen noch keines alt genug war, um mithelfen zu können. Für sie muss es eine schwere Zeit gewesen sein. Als sie mir davon erzählte, konnte sie sich selbst nicht mehr vorstellen, wie sie alles geschafft hatte. Nur für die schweren Feldarbeiten hatte sie Hilfe gehabt. Der Altbauer von einem Nachbarhof hatte für sie gepflügt, denn ihr fehlte es an Kraft, den Pflug tief genug in die Erde zu drücken.
Zur Heuernte bekam Kasper glücklicherweise Fronturlaub, und auch zur Getreideernte war er wieder da. Ende Oktober durfte er sogar noch mal für zwei Wochen nach Hause, um Brennholz zu schlagen. Im Winter 1916 erkrankte die kleine Elisabeth an Lungenentzündung und starb nach wenigen Tagen. Ihr Vater konnte noch nicht mal zur Beisetzung kommen.
Im vierten Kriegsjahr erlitt mein Vater eine Schussverletzung am Unterschenkel. Damit war für ihn der Krieg aus, und er wurde nach einem kurzen Lazarettaufenthalt nach Hause entlassen. Bis sein Bein wieder völlig genesen war, war der Krieg vorbei. Nach seiner Heimkehr wuchs die Kinderschar weiter an. Ende 1918 wurde Magdalena (Leni) geboren. Im Jahr darauf erblickte Josef (Sepp) das Licht der Welt. Im Jahre 1920 kam Johann (Hans) bei uns an und zwei Jahre später der Michael, von allen nur Mich genannt. Im Inflationsjahr 1923 tat ich meinen ersten Schrei in meinem Vaterhaus und zwar am 25. Mai.
Die Inflation konnte meinen Eltern nichts anhaben. Sie besaßen kein Geld, das sie hätten verlieren können. Und da wir unsere Lebensmittel selbst produzierten, berührte es uns auch nicht, dass die Preise in unermessliche Höhen schossen. Da Haus- und Grundbesitz restlos abbezahlt waren, profitierten wir aber auch nicht von der Inflation. Mein Vater hat mir später erzählt, dass einige Bauern kurz vor der Währungsreform mit dem wertlosen Geld ihre Schulden abbezahlt hätten und nachher gemachte Leute gewesen wären.
Bei meiner Geburt war meine Mutter bereits vierzig Jahre alt. Daher war ich das Schlusslicht der Familie. Als Jüngste der Kinderschar hatte ich immer das Gefühl, willkommen zu sein und besondere Privilegien zu genießen. Nicht nur meine Eltern, nicht nur meine großen Schwestern Maria und Anna umsorgten mich liebevoll, auch meine großen Brüder bemühten sich rührend um mich.
Für alle meine Geschwister war es selbstverständlich, dass sie schon früh in der Landwirtschaft mit anpacken mussten. Noch vor ihrem Schulweg nach Hörgersdorf, der eine Dreiviertelstunde dauerte, halfen sie im Stall mit. Die Buben mussten Rüben schneiden, Heu herunterwerfen und ausmisten. Die Mädchen mussten melken und die Milch durch die Zentrifuge geben.
Im Sommer wanderte man grundsätzlich barfuß zur Schule, über Stock und Stein, egal ob es regnete oder kalt war, was uns Kindern nichts ausmachte. Die Schuhe mussten ja für den Winter geschont werden.
Für mich selbst begann 1929 mit der Einschulung der Ernst des Lebens. Wohlbehütet tippelte ich mit meinen Geschwistern Leni, Sepp, Hans und Michl zur Schule. Auf dem Hinweg war immer Eile angesagt, doch auf dem Heimweg trödelten wir ein bisschen herum und hatten viel Spaß miteinander. Als Mitte November der erste Schnee lag, ging es auf dem Heimweg besonders lustig zu, zumal uns noch Kinder von Nachbarhöfen ein Stück des Weges begleiteten. Wenn im Dezember die Schneehöhe gewaltig zunahm, stapften die Buben voraus und spurten den Weg. Wir Dirndln trotteten hinterdrein.
Mitte Januar 1932 hatte es über Nacht besonders heftig geschneit, und meine Brüder lagen mit Masern darnieder. Da ich als erste diese Krankheit bekommen hatte, war ich schon wieder genesen und sollte also allein meinen Schulweg antreten. Zu dieser Zeit war ich noch immer klein und schmächtig und hätte es sicher nicht geschafft, mich durch den Schnee zu kämpfen. Leni war bereits im Jahr zuvor aus der Schule entlassen worden, da die Schulpflicht nach sieben Jahren endete. Sie hätte also nicht mehr zur Schule gehen müssen, mir zuliebe tat sie es aber doch. Auf ihren Schultern brachte sie mich sicher hin. Nach dem Unterricht holte sie mich wieder ab und trug mich nach Hause. Diesen Dienst erwies sie mir an mehreren Tagen.
Die Schule besuchte ich gern, lernte auch fleißig und brachte stets gute Noten nach Hause.
Unsere Schule bestand aus zwei Klassenräumen. In dem einen wurden die Schüler von der 5. bis zur 7. Klasse unterrichtet, und zwar von einem Lehrer. In dem anderen Raum unterrichtete eine Lehrerin die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse. Diese Lehrerin bereitete mir mal eine unschöne Szene. Damit man das verstehen kann, muss ich ein bisschen ausholen.
So armselig wie meine Eltern in ihre Ehe gestartet waren, so armselig blieb unser Leben über viele Jahre lang. Gewiss, wir hatten immer satt zu essen und mussten nicht in Lumpen gehen, dank des Fleißes unserer Eltern. Im Übrigen lebten wir aber äußerst bescheiden. Das war mir als Kind gar nicht aufgefallen. Vater und Mutter waren immer fröhlich und zufrieden, sie waren fromm und dankten Gott jeden Tag für ihre gesunden Kinder und dass ihre Äcker genug hergaben, um alle Mäuler zu stopfen. Diese positive Haltung übertrug sich auch auf uns Kinder.
Einmal im Jahr kam die Schneiderin ins Haus, meist im Januar oder im Februar. Dann flickte sie alles, was im Laufe des Jahres angefallen war – Leintücher, Bettbezüge, Kleider, Schürzen, Oberhemden und Hosen vom Vater und unseren Brüdern. Um diese Flickarbeiten selbst auszuführen, blieb der Mama absolut keine Zeit, abgesehen davon, dass sie nie Nähen gelernt hatte und auch keine Nähmaschine besaß. Die Näherin brachte ihre eigene Maschine mit, die sie auf einem Handwägelchen rumpelnd hinter sich herzog. Sie fertigte auch neue Kleidungsstücke an. Bruder Kasper bekam jedes Mal eine neue Hose und zwei neue Oberhemden, und Maria, unsere Älteste, bekam jedes Jahr ein neues Kleid. Ihre alten Kleider wurden nach unten weitervererbt. Bis sie bei mir landeten, waren sie schon ziemlich abgetragen, und so mancher Flicken zierte sie. Das störte mich aber nicht. Deutlich erinnere ich mich an ein blaues Samtkleid, das Maria und Anna noch vor meiner Zeit getragen haben mussten. Es muss einmal ein Bild von einem Kleid gewesen sein, denn als Leni es trug, die dritte von uns Töchtern, machte es noch etwas her. Deshalb freute ich mich schon auf die Zeit, bis ich endlich hineingewachsen sein würde. Als es soweit war, marschierte ich voller Stolz damit zur Schule, wo ich bereits die vierte Klasse besuchte. In meiner Vorstellung war es nämlich noch immer das schicke Kleidchen, in dem ich Leni bewundert hatte. In der Schule aber überrieselte es mich wie ein kalter Regenguss. Naserümpfend betrachtete mich die Lehrerin und äußerte spitz: »Dass du dich mit so einem Fetzen in die Schule traust! Das Kleid ist ja schon überall abgewetzt.«
Es fehlte nicht viel und ich hätte losgeheult. Doch ich war zu stolz, um ihr zu zeigen, wie sehr mich ihre Taktlosigkeit verletzt hatte. Erhobenen Hauptes setzte ich mich in meine Bank und versuchte so zu tun, als ob nichts gewesen wäre.
Wieder daheim zog ich das Kleid aus und betrachtete es von allen Seiten. Die Lehrerin hatte recht, an etlichen Stellen war der Samt total abgeschabt, und es war nur noch ein dünnes Gewebe sichtbar. Da ich von meinen Schwestern noch andere tragbare Kleider besaß, zog ich das Samtkleid nie wieder an. Von dem Tag an aber, an dem mich meine Lehrerin so gekränkt hatte, besuchte ich nur noch mit Widerwillen die Schule. Erst nach einem halben Jahr, als ich in die fünfte Klasse aufrückte, ging ich wieder gerne, und nicht nur, weil ich der unangenehmen Lehrerin entronnen war.
Der alte Lehrer, der die Oberstufe unterrichtet hatte, war mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger war ein junger, gutaussehender Mann. Er wurde von allen Mädchen angehimmelt, auch von mir. Um ihm zu imponieren, lernten wir besonders eifrig. Davon unabhängig muss er ein tüchtiger Pädagoge gewesen sein, denn viele Jahre später war er Rektor an der Schule, die meine Tochter besuchte. Wieder einige Jahre später wurde ich gewissermaßen mit ihm verwandt, er war nämlich der Onkel der Frau, die mein Sohn geheiratet hatte. Daher haben wir uns bei allen Familienfesten wiedergesehen und über alte Zeiten geredet.
Aber zurück in meine Kindheit. Meine Geschwister der »ersten Generation«, also diejenigen, die vor dem Krieg geboren worden waren, verließen schon bald das Elternhaus, selbst der Älteste, der den Hof übernehmen sollte. Unser Vater war der Ansicht, dass es dem Buben nicht schade, wenn er die Nase mal in einen anderen Betrieb steckte, in einen größeren, damit er zusätzliche Erfahrungen sammelte.
Nach alter Tradition trafen sich die Bauern nach dem Besuch der heiligen Messe zu einem Frühschoppen im Wirtshaus. Dort wurde über das »große Weltgeschehen« diskutiert, über Getreide- und Viehpreise. Die Frauen dagegen verweilten für einige Minuten auf dem Kirchplatz und sprachen das Ortsgeschehen durch. Man musste ja wissen, wer zu heiraten gedachte, wer Nachwuchs erwartete oder bekommen hatte und wer gestorben war. In beiden Gruppen war es aber das Wichtigste, dass man erfuhr, wer wo eine neue Dirn oder einen Knecht brauchte. So hatte mein Vater am Stammtisch mit dem Bauern eines ansehnlichen Hofes ausgemacht, dass unser Kasper dort einige Jahre als Knecht arbeiten sollte. Durch solche Gespräche, die nach dem Kirchbesuch geführt wurden, fanden auch meine Schwestern Maria und Anna ihre Stellen. Sie wurden Mägde auf Höfen, die um einiges größer waren als der unsere und die nicht allzu weit von daheim entfernt lagen. Da beide geschickt, fleißig und hübsch waren, eroberten sie bald das Herz des jeweiligen Hoferben und heirateten ein, obwohl sie kein üppiges Heiratsgut mitbrachten. Von Marias Schwiegermutter ist der Satz überliefert: »Eine Frau mit zwei fleißigen Händen bringt mit der Zeit mehr ein, als eine Frau mit einer großen Mitgift.«
Schon kurz nachdem sie aus der Schule entlassen worden waren, gingen auch die jüngeren Kinder meiner Eltern aus dem Haus. An Lichtmess 1932 begann Leni als Dirn bei einem Großbauern, Sepp trat im Jahr darauf in einer KFZ-Werkstatt als Lehrling ein, Hans machte ab 1934 eine Lehre als Werkzeugmacher. Nun war also nur noch ich zu Hause. Solange meine Geschwister daheim gewesen waren, hatte ich mich vor so mancher Arbeit drücken können. Gewiss, nach dem Unterricht hatte ich der Mutter im Haus und im Garten helfen müssen. Das waren aber Tätigkeiten, die mir gefielen, besonders wenn sie mich wegen meiner Geschicklichkeit lobte. Nun musste ich aber auch aufs Feld und in den Stall.
Die Feldarbeiten waren noch erträglich, zum Beispiel bei der Heuernte helfen, für das Getreide Garben binden und im Herbst Kartoffeln lesen. Die Arbeiten im Stall machten mir aber nicht den geringsten Spaß. Kühe und Schweine waren nicht so mein Ding. Allein der Geruch war mir zuwider, abgesehen von den ungeliebten Tätigkeiten wie Melken, Füttern, Ausmisten, weil man sich dabei schmutzig machte. Die Kühe waren mir gar unheimlich. Wie böswillig sie mich schon anglotzten! Ihre spitzen Hörner machten mir Angst, und auch vor ihren tretfreudigen Klauen hatte ich großen Respekt. Eine Kuh hatte mir nämlich mal einen solchen Tritt versetzt, dass ich mit dem halbvollen Milcheimer vom Schemel gefallen war.
Dass ich die Zeit, die ich als »Einzelkind« auf dem Hof verbrachte, dennoch genoss, lag daran, dass ich mit der Mutter viel allein war. Denn der Vater, wenn er nicht gerade auf dem Feld war, betätigte sich weiterhin gelegentlich als Zimmerer. Dies waren meine schönsten Jahre, denn zwischen der Mutter und mir entwickelte sich ein inniges Verhältnis. Vor allem die Winterabende gehörten ganz uns. Papa ging nämlich immer früh zu Bett, weil er äußerst ruhebedürftig war. Es schien, als habe er vom Krieg doch mehr zurückbehalten als nur die Verwundung am Bein. Welche Schäden der Krieg im Inneren der Menschen angerichtet hatte, war ja nicht sichtbar.
Beim Schein der Petroleumlampe brachte mir die Mutter Häkeln und Stricken bei sowie Stopfen und Sticken. Das Schönste dabei war, dass sie mir immer aus ihrer Kindheit erzählte, aus der Zeit, wie sie zu diesem Anwesen gekommen waren, von ihren ersten Ehejahren, von ihren Schwangerschaften und ihren Geburten.
Meine beiderseitigen Großeltern kannte ich kaum, weil sie so weit weg wohnten, nämlich 23 beziehungsweise 25 Kilometer. Aus heutiger Sicht eine lächerliche Entfernung, doch damals, als es noch keine öffentliche Verkehrsanbindung gab und man kein eigenes Fahrzeug besaß – noch nicht mal ein Fahrrad – hätte man die Wege zu Fuß zurücklegen müssen. Dazu fehlte einem einfach die Zeit.
Ab 1936 lebte mein großer Bruder wieder bei uns. Nachdem er sich einige Jahre den Wind hatte um die Ohren wehen lassen, hatte der Vater ihn zurückbeordert, damit er ihm die schweren Arbeiten abnehme, denn es ging ihm nicht so gut. An manchen Abenden, wenn Mutter und ich in der Stube miteinander handarbeiteten und ratschten, saßen Vater und Sohn in der Küche einträchtig zusammen, wo Vater Kasper dem Sohn Kasper gewiss einige Lebensweisheiten mit auf den Weg gab. Gleichzeitig regten sie dabei ihre Hände. Sie reparierten Rechen, Säcke und Körbe.
Die Sonntagabende verbrachten wir dann meist zu viert in der Stube. Dort ruhten wir wirklich von der Last der Woche aus, indem wir miteinander spielten. Mal war es »Mensch ärgere dich nicht«, mal war es ein Kartenspiel.
Inzwischen war die Schulpflicht auf acht Jahre verlängert worden. Dennoch rückte auch für mich unaufhaltsam das Ende der Schulzeit heran, und es erhob sich die Frage, was ich danach arbeiten sollte. Wie meine Schwestern sollte ich natürlich auch zu einem Großbauern in Dienst gehen. Gegen dieses Ansinnen meiner Eltern setzte ich mich heftig zur Wehr: »Nein, Bauernarbeit mache ich nicht. Es muss doch auch noch etwas anderes geben.«
»Freilich gibt es noch was anderes«, gaben die Eltern zu. »Aber nicht bei uns. Da müsstest du in die Stadt gehen. Aber so jung, wie du bist, können wir das nicht verantworten.«
Schließlich hatte ich meine Eltern so weit, dass sie mir noch ein Jahr daheim zugestanden. Zwar musste ich weiterhin landwirtschaftliche Arbeiten verrichten, aber meine Eltern waren nicht so streng mit mir, wie es vielleicht ein fremder Dienstherr gewesen wäre. Vor allem aber blieb ich weiterhin mit meiner geliebten Mutter zusammen und konnte die Feierabende mit ihr genießen. Für sie war es ebenfalls eine Freude, mich den ganzen Tag um sich zu haben. Dieses schöne Jahr näherte sich aber schneller seinem Ende, als ich erwartet hatte. Deshalb überlegte ich, wie ich meine Eltern dazu bringen könnte, mir noch ein weiteres Jahr »Freiheit« zu gönnen. Mein Jahr im Elternhaus war noch nicht ganz herum, da erledigte sich mein Problem von selbst. Im Jahre 1938 führte man das Pflichtjahr für Mädchen ein, das alle ledigen weiblichen Personen zwischen 14 und 25 Jahren ableisten mussten. Man hatte lediglich die Wahl zwischen einem kinderreichen Stadthaushalt und einem Bauernhof. Prima, dachte ich, dann kannst du das Pflichtjahr gleich daheim machen. Aber so ein Gütl wie das unsere, so belehrte man uns amtlicherseits bald, galt nicht. Wenn, dann musste es schon ein stattlicher Hof sein, mit viel Land und einem großen Viehbestand, auf dem man als Pflichtjahrmädchen eingesetzt werden konnte.
Deshalb tendierte ich mehr zu einem Pflichtjahr in der Stadt, wozu mir die Eltern jedoch die Erlaubnis verweigert hätten. Bevor es zu einer Auseinandersetzung kommen konnte, redete mir die Mutter die Sache in ihrer gütigen Art aus: »Aber Dirnei, dann bist ja so weit von uns weg. Dann hast du womöglich eine hochnäsige gnädige Frau, die dich von morgens bis abends schikaniert. Vielleicht ist da ein Stall frecher Kinder, die dich den ganzen Tag tratzen (ärgern), abgesehen von den Gefahren, die in der Stadt lauern. Dabei denke ich noch nicht mal an die Autos, die herumsausen und dich überfahren könnten, wenn du auf den Markt oder in ein Geschäft zum Einkaufen gehst. Vielmehr denke ich an die moralischen Gefahren. In der Stadt gibt es Sittenstrolche, die junge Mädchen verschleppen, vergewaltigen und umbringen.«
In meiner lebhaften Fantasie malte ich mir solche Szenen aus und nahm freiwillig Abstand von der Idee, in einem Stadthaushalt eingesetzt zu werden. Mein Vater gab bei der Behörde also an, dass ich bereit wäre, auf einen Bauernhof zu gehen.