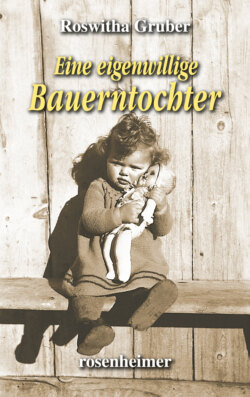Читать книгу Eine eigenwillige Bauerntochter - Roswitha Gruber - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIm Pflichtjahr
Am 1. April 1939 morgens kurz vor 8 Uhr marschierten mein Vater und ich los in Richtung Hamersdorf bei Walpertskirchen. Dort sollte ich mein Pflichtjahr auf einem Einödhof verbringen. Für die etwa zehn Kilometer benötigten wir drei Stunden. Zunächst kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Das war vielleicht ein Hof! So etwas hatte ich noch nie gesehen. Das Wohnhaus, hoch und breit und weiß gestrichen, leuchtete in der Sonne. In einigem Abstand davon befanden sich die Wirtschaftsgebäude, ebenfalls riesig für meine Begriffe, ebenfalls strahlend weiß gekalkt. Bei uns dagegen war alles grau in grau. Im Vergleich zu unserem Gütl erschien mir das geradezu als Gut. Doch das war es nicht, wie mich Sofie, die Bäuerin, bald belehrte. Das sei nur ein einfacher Bauernhof. Ein Gut habe ganz andere Ausmaße, einen größeren Viehbestand, einen umfangreicheren Landbesitz und wesentlich mehr Personal. Sie hätten nur 25 Milchkühe, 15 Stück Jungvieh, zwanzig Schweine, vier Pferde, drei Dutzend Hühner und fünfzig Gänse. Dazu gäbe es noch sechs Puten mit einem Truthahn, der seine kleine Schar stets stolz anführe. Damit hatte sie mir gleich verraten, mit wie viel Viehzeug ich es zu tun haben würde. Wie viele Hektar Land sie besaßen, das band sie mir allerdings nicht auf die Nase und es war für meine zukünftige Arbeit auch nicht wichtig.
Wenig später versammelten wir uns um den riesigen rechteckigen Tisch, der die halbe Küche einnahm. Die Hausherrin, sie mochte Ende zwanzig sein, nötigte meinen Vater dazu, zum Essen zu bleiben: »Du hast noch einen weiten Heimweg vor dir, deshalb musst du dich stärken.«
Bevor das Mahl begann, zählte ich heimlich, wie viele Personen da zusammenströmten, und kam auf 14. Außer der Bäuerin waren das ihr Mann Anton, ein großer, freundlicher Mensch mit vollem, braunem Haar, Mitte dreißig, sowie seine Eltern, unschwer als solche zu erkennen. Der Jungbauer ähnelte dem Altbauern wie aus dem Gesicht geschnitten. Der Alte hatte das gleiche volle Haar, das noch ebenso braun war wie das des Sohnes. Das Blondhaar der Altbäuerin dagegen war schon von zahlreichen Silberfäden durchzogen. Beide schätzte ich auf Mitte sechzig. Dann waren da noch die beiden Kinder des jungen Paares. Klein-Anton, der Stammhalter, zählte vier Lenze, und Klein-Sofie war zwei. Die Kinder machten einen wohlerzogenen Eindruck. Es gab einen Rossknecht, einen Schweineknecht, einen Großknecht, eine Kuhdirn, eine Küchendirn und eine Hausdirn. Neben mir gab es noch ein zweites Pflichtjahrmädchen.
Nach dem Essen bedankte sich mein Vater bei der Jungbäuerin und wechselte noch das eine oder andere Wort mit ihr. Danach machte er ein sehr zufriedenes Gesicht und verabschiedete sich von mir, wobei er mich ermahnte, brav und fleißig zu sein. Dann trat er den Heimweg an.
Brigitte, das andere Mädchen im Pflichtjahr, war bereits einen Tag vor mir angereist und hatte sich für die Rolle der Kindsmagd entschieden. Für mich blieb also nur die Stelle als Geflügelmagd. Das war mir auch recht, Hauptsache ich brauchte nicht in den Kuhstall.
Da man aber weder mit den Kindern noch mit dem Geflügel den ganzen Tag über ausgelastet war, mussten wir beide überall dort einspringen, wo gerade jemand gebraucht wurde, egal ob beim Waschen, beim Bügeln, beim Rübenhacken oder bei der Heuernte. Jede von uns bekam im Monat zehn Mark Lohn. Das war sehr großzügig, wie ich zu Weihnachten bei meinem Besuch daheim erfuhr. Nach der Christmette hatte mir eine ehemalige Mitschülerin anvertraut, dass sie nur fünf Mark im Monat bekomme und auch noch wesentlich schwerer arbeiten musste als ich. Von anderen Mitschülerinnen wusste sie zu berichten, dass diese ebenfalls nur fünf Mark Monatslohn bekamen.
Brigitte war ein Stadtmädchen. Sie kam aus Wasserburg, und ihr Vater war ein Kaufmann. Was die Landwirtschaft anging, so hatte sie von Tuten und Blasen keine Ahnung. Sie hatte auch nicht das geringste Interesse daran, etwas in dieser Richtung zu lernen. Trotzdem verstanden wir uns gut. Sie erfuhr viel über mich und ich über sie. Am Sonntagnachmittag, wenn wir beide frei hatten, machten wir lange Spaziergänge miteinander und erkundeten die Umgebung.
Als Herrin über das Federvieh gehörte es zu meinen Aufgaben, morgens die Ställe zu öffnen und die Tiere hinauszulassen. Mit Putt, Putt, Putt streute ich den Hühnern und Puten ihre Körner hin. Diese hätten sie gewiss auch ohne meine Aufmunterung aufgepickt. Mit meinen Putt-Rufen kam ich mir aber wichtiger vor.
Die Gänse marschierten, sobald der Stall geöffnet war, zielstrebig und schnatternd zum nahe gelegenen Weiher, wo sie sich den ganzen Tag amüsierten.
Danach wurde ich meist in der Küche eingesetzt. Das Pflichtjahr war ja nicht nur deshalb ins Leben gerufen worden, damit die Hausfrauen eine Hilfe hatten, sondern auch, damit die Mädchen Kochen und Haushaltsführung lernten, um später tüchtige Hausfrauen zu werden. In diesem Hause kochte die Bäuerin selbst. Da von allen Lebensmitteln reichlich vorhanden war, kochte sie gehaltvolle und wohlschmeckende Speisen. Das war schon ein enormer Unterschied zu der spärlichen Küche, die ich von daheim gewohnt war. Nicht zuletzt deshalb gefiel es mir so gut auf diesem Hof. Es gefiel mir auch sonst, weil die Bauersleute ausgesprochen nett waren und ihre Angestellten ebenfalls.
Am Spätnachmittag musste ich die Eier aus den Hühnernestern sammeln und sie in der geräumigen Speisekammer in ein Regal einordnen. Dies war mir von allen Arbeiten die angenehmste, die unangenehmste dagegen war das Ausmisten. Das musste halt jede Woche ein Mal sein. Alle Geflügelställe mussten sorgfältig gereinigt werden, damit sich keine Krankheitskeime ausbreiten konnten.
Vor Einbruch der Dunkelheit musste ich meine Tiere – sofern sie nicht schon freiwillig zurückgekehrt waren – in ihre Ställe treiben und diese dann sorgfältig verschließen, damit der Fuchs nicht hineinkam. Einmal aber, ich lebte bereits ein halbes Jahr auf dem Hof, hatte ich vergessen, die Puten in den Stall zu scheuchen, vermutlich, weil ich sie nirgends gesehen hatte. Beim Nachtessen fiel mir das plötzlich ein. Also sauste ich aus dem Haus und suchte den ganzen Hof ab mit verzweifelten Putt-Putt-Rufen. Im Stadl suchte ich ebenfalls, schaute in alle Ställe, hinter jeden Busch und jeden Strauch. Nirgends waren die Biester zu entdecken, sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Als es zu dunkel wurde, gab ich die Suche auf, in der Hoffnung, dass sie am nächsten Morgen wieder auftauchen würden. Noch bevor ich zu Bett ging, musste ich meiner Bäuerin das Versäumnis eingestehen.
»Die werden sich in den Wald verzogen haben«, vermutete sie. »Die Urahnen der Puten stammen aus Mexiko und leben im Wald. Zum Schutz vor Raubtieren verbringen sie die Nächte auf Bäumen.«
In mir keimte etwas Hoffnung auf. Der Wald, der zum Hof gehörte, lag nur wenige Minuten vom Haus entfernt. Also schlief ich einigermaßen beruhigt ein. Am folgenden Morgen war ich schon früher als sonst auf dem Hühnerhof und blickte mich suchend um. Plötzlich entdeckte ich einige dunkle Punkte, die vom Wald her auf das Haus zuzukommen schienen. Sie wurden zusehends größer und waren bald als Puten und Puter auszumachen. Leider waren es aber nur vier Tiere, die am Hof eintrafen. So sehr ich meine Augen auch anstrengte, es wurden nicht mehr.
»Die anderen hat bestimmt der Fuchs gefressen«, stellte die Bäuerin lapidar fest, als ich ihr vom Eintreffen von nur vier Putentieren berichtete. Diese Befürchtung hegte ich auch. Der Fuchs muss unsere armen Puten erwischt haben, noch bevor sie sich auf einem Baum in Sicherheit bringen konnten. Doch so viele Tiere konnte er nicht allein verspeist haben. Wahrscheinlich hatte sich eine ganze Fuchsfamilie über die reichhaltige Mahlzeit gefreut. Das war doch mal was anderes als immer nur Mäuse.
Vielleicht aber, dachte ich wider alle Vernunft, halten sich die anderen Puten noch im Wald auf, weil es ihnen dort so gut gefällt. In der Hoffnung, sie dort lebend zu finden, schlich ich am Nachmittag in den Wald. Dass nichts mehr zu machen war, wurde mir schnell klar, denn gleich am Waldrand entdeckte ich eine Menge schwarzer Federn.
Zur Strafe, weil ich die Puten nicht rechtzeitig in den Stall geführt hatte, und für den Verlust, den der Hof dadurch erlitten hatte, zahlte mir Sofie drei Monate lang keinen Lohn. Das war hart für mich und warf meinen Plan gehörig zurück. Seit ich auf dem Hof war, hatte ich nämlich eisern gespart in der Absicht, mir bald ein eigenes Fahrrad kaufen zu können. Auf dem Hof gab es zwei davon, ein Herrenrad und ein Damenrad. Diese wurden von den Dienstboten benutzt, wenn sie im Dorf etwas erledigen mussten. Damit ich auch in der Lage war, ins Dorf zu radeln, brachte mir der Schweineknecht das Radfahren bei. Das war eine feine Sache. Mit dem Radl kam man schnell und mit wenig Mühe von einem Ort zum anderen.
Im Übrigen war mir die Bäuerin eine gute Lehrmeisterin. Wie man Hühner füttert und deren Ställe ausmistet, hatte ich bereits daheim gelernt. Von ihr lernte ich aber auch Hühner zu schlachten, und zwar so, dass sie einem nicht noch kopflos davonflatterten. Ich lernte sie zu rupfen, sie fachgerecht auszunehmen und eine leckere Suppe davon zu kochen oder – die jungen Hähnchen – knusprig zu braten. Über Truthühner erfuhr ich ebenfalls eine Menge. Wie normale Hühner legen sie zwar auch das ganze Jahr über Eier, aber wesentlich weniger. Wenn es eine Pute im Jahr auf zwanzig Eier bringt, ist das schon viel. Man hält sie also nicht wegen der Eier, sondern wegen ihres schmackhaften Fleisches. Zu Weihnachten landeten immer zwei Puten in der eigenen Bratröhre und die eine oder andere in der eines guten Kunden. Die wenigen Eier, die sie legten, wurden in einem Extra-Korb aufbewahrt, bis man genug zum Brüten zusammen hatte. Von Sofie lernte ich, woran man erkennt, dass ein Truthuhn brutwillig ist. Dann richtete ich ihr ein Brutnest her und legte ihr zehn bis zwölf Eier unter. Nach 28 Tagen schlüpften die Küken, meist nur sieben oder acht, und selbst diese brachte man nicht alle durch. Putennachwuchs ist äußerst empfindlich.
Sofie führte mich auch in die Geheimnisse der »gehobenen« Küche ein. Vor ihrer Heirat hatte sie nämlich eine Haushaltungsschule besucht. Von ihr lernte ich die verschiedensten Koch- und Backrezepte kennen und schrieb sie fleißig in ein Heft, das sie mir eigens dazu geschenkt hatte. Ich erfuhr, wie man Obst und Gemüse auf verschiedene Weise haltbar macht, Fleisch einweckt, ja sogar, wie man Wurst herstellt. Wäschepflege fehlte auch nicht im Programm.
Ab Juli 1939 hatte ich meinen ersten Verehrer. Es war Giselher, ein Schüler aus dem Rheinland. Wie er mir stolz berichtete, stammte er aus der Nibelungenstadt Worms. Seine beiden älteren Brüder trugen die Namen Gunther und Gernot. Seine Eltern hatten für ihre drei Buben die Namen der Helden aus der Sage ausgewählt, die sich um diese Stadt rankte. Giselhers Eltern mussten recht wohlhabend gewesen sein, weil sie es sich leisten konnten, ihren Jüngsten als Feriengast auf diesen Hof zu schicken. Nach einer überstandenen Krankheit sollte der 17-jährige blasse Jüngling in der frischen Landluft und bei gutem Essen wieder zu Kräften kommen und rote Wangen kriegen. Zunächst verteilte Giselher seine Gunst gleichermaßen auf die Kindsmagd und auf mich. Mit meinen 16 Jahren war ich aber für Liebesschwüre noch nicht empfänglich. Der verliebte Bursche hätte jedoch am liebsten den ganzen Tag mit mir verbracht und bedauerte es sehr, dass ich immer wieder zu Arbeiten eingespannt wurde. Um sich die Zeit zu vertreiben, spazierte er täglich in den Wald und kam mit kleinen Geschenken für mich zurück. Mal hatte er ein Weidenpfeifchen geschnitzt, mal war es eine Handvoll wilder Erdbeeren, die er auf einem großen Blatt zu mir transportierte, mal waren es Himbeeren oder blauweiße Federn von einem Eichelhäher. Mir war es peinlich, die kleinen Gaben anzunehmen. Doch noch peinlicher wäre es gewesen, ihn vor den Kopf zu stoßen, indem ich sie ablehnte.
Eines Tages tat er etwas, das mich arg in Verlegenheit brachte. Die Hausfrau stellte mich zur Rede, weil ihr aufgefallen war, dass am Abend weniger Eier ins Regal eingeordnet waren als üblich. »Den dritten Abend beobachte ich das nun schon. Beim ersten Mal dachte ich, das kann ja schon mal vorkommen, dass die Hühner weniger legen. Aber jetzt glaube ich nicht mehr daran.«
»Darüber habe ich mich auch schon gewundert, dass die Eier weniger werden«, erklärte ich dazu.
»Tu nicht so scheinheilig! Gib zu, dass du die Eier beiseite geschafft hast.«
»Warum sollte ich das tun? Bei euch bekomme ich doch satt zu essen, sodass ich es nicht nötig habe, mir zusätzlich etwas zu beschaffen.«
Sie glaubte mir aber nicht, das sah ich ihr an. Der Makel blieb also an mir hängen und ich befürchtete, sie würde mir wieder was vom Lohn abziehen. Also musste ich den Eierdieb ausfindig machen. Von den Dienstboten kam eigentlich niemand infrage, die waren den ganzen Tag über beschäftigt. Es musste jemand sein, der Zeit hatte. Die Kinder waren noch zu klein, um in die Nester langen zu können, außerdem wurden sie ständig vom Kindermädchen überwacht. Ob sie es vielleicht war? Nein, ausgeschlossen. Am Nachmittag hätte sie sich nicht in den Stall begeben können, weil sie die Kinder am Rockzipfel hatte, und die Kleinen waren bereits in dem Alter, in dem sie sie verpetzt hätten.
Ob sich vielleicht ein Marder an den Nestern bediente? Als ich nach dem Gespräch mit der Bäuerin am Abend meine Eier einsammelte, fand ich in der Nähe des Hühnerstalles drei leere Eier, von denen jedes oben und unten ein Loch aufwies. Offensichtlich waren sie ausgetrunken worden. So etwas machte bestimmt kein Marder.
Plötzlich stieg siedend heiß ein Verdacht in mir auf. Giselher! Der hatte doch den ganzen Tag nichts zu tun und lungerte nur herum. Aber wie sollte ich ihn überführen? Die Zeit, um mich am Nachmittag auf die Lauer zu legen, hatte ich nicht. Die ausgetrunkenen Eier legte ich als Beweisstücke oben in meinen Eierkorb. In der Speisekammer versteckte ich sie so, dass niemand sie finden konnte. Ausgeblasene Eier allein genügen aber nicht, um einen Täter zu überführen, die konnten von jedem stammen, nur nicht vom Marder. Spontan kam mir eine Idee. Während noch alle beim Nachtessen saßen, verließ ich kurz die Küche, um mir die Schuhe unseres Feriengastes anzuschauen. Es war nämlich Sitte, dass jeder, bevor er zu Tisch ging, seine Stall- oder Straßenschuhe im Hausgang ins Regal stellte. Nach dem Nachtmahl musste dann entweder ich oder die Brigitte die Schuhe putzen. Eine Woche lang war sie dran, in der nächsten Woche ich. Unter den Schuhen meines Verehrers klebte eindeutig Hühnermist, und es gab nur eine Möglichkeit, wie der dorthin gelangt sein konnte. An diesem Abend hatte die Kindsmagd Schuhputzdienst. Bevor sie mit ihrer Arbeit begann, brachte ich die Beweisstücke eilig auf mein Zimmer, das ich mir mit Brigitte teilte, und schob sie weit hinten unter mein Bett. Dann gesellte ich mich wieder zur »Tischrunde«, als ob nichts gewesen wäre.
»Wieso riecht es hier nach Hühnerkacke?«, fragte mich meine Zimmergenossin naserümpfend, als wir uns zu Bett begaben. »Hast du dich nach deiner anrüchigen Arbeit vielleicht nicht richtig gewaschen?«
Indem ich schnupperte, tat ich scheinheilig: »Ich weiß nicht, was du hast, ich rieche nichts.« Trotz des unangenehmen Geruchs waren wir bald ins Land der Träume hinübergeglitten.
Anderntags, als nach dem Frühstück alle in ihre frisch geputzten Schuhe schlüpften, stand Giselher unschlüssig dabei. Schließlich fragte er: »Hat vielleicht jemand versehentlich meine Schuhe angezogen?«
Der Rossknecht lachte: »Meinst vielleicht, wir mit unseren groben Landfüßen passen in deine zierlichen Stadtschühchen?«
Die Küchenmagd kicherte: »Wir Madln können mit deinen Schuhen auch nichts anfangen. Den Knechten mögen sie zu klein sein, für uns aber sind sie zu groß.«
»Wahrscheinlich hast du sie gestern Abend nicht hier abgestellt?«, vermutete eine andere, während ich still in mich hineingrinste. In Gegenwart der Dienstboten wollte ich kein Aufheben machen, deshalb hielt ich den Mund. Missgelaunt begab sich der Jüngling auf sein Zimmer und kam mit einem anderen Paar Schuhe herunter. Das war für mich der Zeitpunkt, ein ernstes Wörtchen mit ihm zu reden. Mit meinen Beweisen in der Hinterhand sagte ich ihm auf den Kopf zu: »Warum trinkst du heimlich Eier aus? Kriegst du hier vielleicht nicht genug zu essen?«
Sogleich bekam er einen puterroten Kopf. Da war es für mich eindeutig, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Doch er stammelte: »Ich? Nein! Wie kommst du denn darauf?«
»Du brauchst gar nicht zu leugnen. Mir liegen eindeutige Beweise vor.«
»Was sollen denn das für Beweise sein?«
»Gestern Abend fand ich drei ausgetrunkene Eier. Wenn du dich schon als Eierdieb betätigst, solltest du wenigstens so gescheit sein, die Schalen nicht herumliegen zu lassen.«
»Wieso sollen die von mir sein?«, gab er noch immer nicht klein bei. »Die kann genauso gut jeder andere neben dem Hühnerstall verloren haben.«
»Aha, ein weiterer Beweis, dass du der Täter bist. Wie sonst solltest du wissen, wo ich sie gefunden habe?«
»Das beweist gar nichts! Das war lediglich eine Vermutung von mir, dass sie neben dem Hühnerstall lagen.«
»Gut, dann wollen wir diese Beweise nicht gelten lassen«, spielte ich die Großzügige und fuhr in meinem Verhör fort: »Wie aber willst du mir erklären, dass Hühnerkacke unter deinen Schuhen klebt?«
In dem Moment sah er sich überführt: »Also gut, ich bekenne mich schuldig. Du bist ja der reinste Sherlock Holmes.«
»Wer ist denn das?«
»Das ist der erfolgreiche Detektiv aus den Romanen eines berühmten englischen Schriftstellers, der die schwierigsten Kriminalfälle löst.«
»Aha!«, antwortete ich nachdenklich. Seine Äußerung brachte mich auf eine Idee: »Vielleicht könnte ich Detektiv werden. Mir ist eh noch nicht klar, welchen Beruf ich wählen soll.«
Giselher lachte schallend auf: »Ein Mädchen als Detektiv? So etwas gibt es nicht.«
»Dann eben nicht. Aber du musst zugeben, dass ich diesen Fall einwandfrei gelöst habe.«
»Das hast du. Du warst es also, die meine Schuhe genommen hat?«
Mit triumphierendem Lächeln gab ich das zu, bombardierte ihn aber mit weiteren Fragen: »Warum schleichst du dich ins Hühnerhaus? Warum trinkst du heimlich Eier aus? Musst du hier Hunger leiden?«
Verlegen lächelnd antwortete er: »Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass rohe Eier die Manneskraft stärken.«
»Ach, wozu willst du die stärken? Im ganzen Haus wüsste ich keine, der etwas daran gelegen wäre, und mir am allerwenigsten.«
Unbeirrt erklärte er weiter: »Die ersten drei Eier habe ich getrunken, um das auszuprobieren.«
»Und, hat es gewirkt?«
»Zu meiner Enttäuschung leider nicht. Inzwischen war ich aber auf den Geschmack gekommen, deshalb habe ich mich weiterhin an der Eiertheke bedient.«
»Hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, dass das auffallen könnte?«
»I wo! Die braven Hennen legen doch so viele Eier, da habe ich gedacht, die Bäuerin wird es schon nicht merken, wenn einige fehlen«, erklärte er leichthin.
»Ihr ist es aber aufgefallen.«
»Ach was, die soll nicht so kleinlich sein. Als ob es auf die paar Eier ankommt!«
»War dir nicht bewusst, dass du Diebstahl begehst?«
»Keineswegs. Mein Vater zahlt genug für meinen Aufenthalt. Da sind die paar Eier leicht drin.«
»Du magst das so sehen. Doch anständiger wäre es gewesen, wenn du die Sofie um ein paar Eier gebeten hättest. Sie hätte sie dir gewiss gerne gegeben.«
»Darin sehe ich keinen Unterschied. Es ist egal, ob sie mir die Eier gibt oder ob ich sie mir selbst nehme.«
Nun hielt ich es für nötig, ihn zu belehren: »Doch, darin besteht ein bedeutender Unterschied. Die Bäuerin wusste ja nicht, wer die Eier genommen hat. Deshalb hat sie mich verdächtigt, eine Eierdiebin zu sein.«
»O, das tut mir leid. Auf die Idee, dass sie dich im Verdacht haben könnte, kam ich gar nicht. Hast du deshalb etwa Schwierigkeiten gekriegt?«
»Und ob! Sie hat mich ganz offen des Eierdiebstahls bezichtigt. Seitdem sieht sie mich misstrauisch an, und ich fürchte, sie wird mir am Ende des Monats meinen Lohn kürzen, um sich schadlos zu halten.«
Zerknirscht fragte er: »Was kann ich tun, damit sie ihre Meinung ändert?«
»Auf der Stelle gehst du zu ihr und gestehst, dass du der Täter bist. Nur damit kannst du mich reinwaschen. Danach gebe ich dir deine Schuhe zurück. Dann benötige ich sie ja nicht mehr als Beweisstücke.«
Bei der Bäuerin muss er umgehend ein ausführliches Geständnis abgelegt haben. Denn bei unserer nächsten Begegnung zwinkerte sie mir zu: »Da warst du ja ganz schön gescheit!«
Ende Juli schlug die Abschiedsstunde für unseren Feriengast. Bevor der Bauer ihn zur Bahn brachte, überreichte Giselher mir einen selbstgepflückten Feldblumenstrauß und raunte mir zu: »Der Abschied von dir fällt mir sehr schwer. Aber sobald ich daheim bin, werde ich dir schreiben.«
»Die Mühe kannst du dir sparen, ich kann nämlich nicht lesen.«
»Haha! Wieso habe ich dich dann manchmal in einen Roman vertieft in einer Ecke angetroffen?«
»Gut beobachtet, Sherlock Holmes!«, lobte ich ihn. Die Herrin hatte mir tatsächlich erlaubt, mich in meiner Freizeit an ihrem Bücherschrank zu bedienen. Dafür, dass sie eine Bäuerin war, war er beachtlich bestückt.
Für die Blumen bedankte ich mich artig bei meinem Ritter und gab sie in eine Vase. Diese stellte ich aber nicht in meine Kammer, sondern mitten auf den Küchentisch, damit sich alle daran erfreuen konnten.
Als in den folgenden Wochen kein Brief von meinem Verehrer eintraf, war ich doch einigermaßen enttäuscht. So sind halt die Mannsbilder, dachte ich, machen einem die tollsten Versprechungen und dann vergessen sie einen nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch bald schon hatte ich ihn ebenfalls vergessen.
Am 1. September 1939 trat ein Ereignis ein, das viele Millionen Menschen ins Verderben stürzen sollte. Der Krieg, der an diesem Tag in Polen, weit weg von uns, angefangen hatte, erschütterte auch bald unsere kleine Hausgemeinschaft. Bereits nach wenigen Wochen wurde nicht nur der junge Bauer eingezogen, sondern auch sein Rossknecht und sein Schweineknecht. Nur Albert, der Großknecht, durfte bleiben, weil er für den Kriegseinsatz schon zu alt war. Vor seinem Abmarsch legte der Jungbauer die volle Verantwortung in Alberts Hände. Fortan war es seine Aufgabe, die Arbeit einzuteilen und darüber zu wachen, dass der Betrieb reibungslos lief. Das war aber nicht einfach mit nur zwei Männern auf dem Hof, die zudem nicht mehr die Jüngsten waren. Der Großknecht selbst hatte die Fünfzig längst überschritten, und der Altbauer ging stark auf die Siebzig zu. Deshalb sprach Albert bald bei der Ortskommandantur vor und stellte einen Antrag auf männliche Hilfspersonen. Für die drei Männer, die man vom Hof abgezogen hatte, versprach man ihm drei polnische Zwangsarbeiter. Diese sollten aber nicht bei uns im Haus schlafen, sondern in einem Nebengebäude. Deshalb beauftragte mich die Jungbäuerin vor deren Ankunft, dort die Betten zu beziehen, die sich in zwei Kammern befanden, sowie die Böden und die Fenster zu putzen. Diesen Aufgaben kam ich bereitwillig nach, es waren ja keine ungewohnten Arbeiten, die sie von mir verlangte. Nachdem die Polen eingetroffen waren, gehörte es zu meinen täglichen Pflichten, ihre Betten zu machen, aufzuräumen, abzustauben und die Böden sauber zu halten. Einer von ihnen hatte wohl ein Auge auf mich geworfen und spitzgekriegt, wann ich diese Arbeiten zu erledigen pflegte. Deshalb ging er eines Tages nicht zur Arbeit. Welche Ausrede er dem Großknecht aufgetischt hatte, weiß ich nicht. Er versteckte sich unter seinem Bett und wartete, bis ich kam. Während ich seine Kissen aufschüttelte, kroch er plötzlich hervor und richtete sich in voller Größe vor mir auf. Einige Sekunden war ich starr vor Schreck. Diese nutzte er, um seine Arme um mich zu schlingen und mich zu küssen. Vielleicht wollte er auch mehr. Plötzlich löste sich meine Erstarrung und ich schlug ihm mit meiner freien Hand voll ins Gesicht. Verdutzt über meine Gegenwehr lockerte er seinen Griff etwas. Dadurch gelang es mir, mich aus seiner Umklammerung zu befreien und die Flucht zu ergreifen. Aufgeregt rannte ich zur Bäuerin und platzte heraus: »Im Nebengebäude werde ich keine Betten mehr machen!«
»Ja, warum denn nicht?«, fragte sie erstaunt.
Völlig außer Atem schilderte ich ihr, was vorgefallen war.
Sie reagierte völlig vernünftig: »Diesen Mann und auch die beiden anderen werden wir genau beobachten, damit solche Übergriffe nicht mehr vorkommen. Du machst die Zimmer nur noch, wenn wir sicher wissen, dass sie weit vom Haus entfernt beschäftigt sind.«
Ende Februar 1940 suchte die Herrin mit mir ein Gespräch unter vier Augen. »Ursula«, begann sie, »dein Pflichtjahr geht bald zu Ende. Hast du schon Ziele oder Pläne für die Zeit danach?«
»Nein«, musste ich gestehen. »Bis jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich werden will. Ich weiß nur gewiss, was ich auf keinen Fall werden möchte, nämlich Bäuerin.«
»Das kann ich gar nicht verstehen, dass dir dieser Beruf so zuwider ist. Für mich selbst ist es der schönste Beruf, den es gibt.«
»Bei mir ist es gerade umgekehrt, ich kann mir keinen schrecklicheren Beruf vorstellen. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass ich bei euch nicht in den Kuhstall musste.«
»Was ist denn an einem Kuhstall so schlimm?«, hakte sie nach.
»Kühe sind mir nicht geheuer. Nicht nur vor ihren langen, spitzen Hörnern habe ich Angst, sondern auch vor ihren Hufen, mit denen sie einem ganz schöne Tritte versetzen können.«
Sofie lachte: »Anscheinend hast du daheim schon Bekanntschaft damit gemacht.«
»Und ob! Mehr als einmal. Wenn eine schlecht gelaunt war, hat sie mich mitsamt dem halbvollen Milcheimer vom Schemel getreten.«
»Wenn ich dir verspreche, dass du auch weiterhin nicht in den Kuhstall musst, und wenn du also sonst noch nichts vorhast, würdest du dann ein weiteres Jahr bei uns bleiben? Du weißt ja, es ist Krieg, der verlangt uns allen viel ab. Deshalb wäre ich froh, wenn du bleiben würdest. Gewiss, mir würde ein neues Mädchen zugewiesen, das müsste ich aber erst mühsam anlernen. Wenn du bleibst, wäre das eine Erleichterung für mich.«
Für meine Antwort benötigte ich nur wenige Sekunden Bedenkzeit: »Warum eigentlich nicht? Mir gefällt es bei euch. Ihr seid alle sehr nett. Vielleicht kommt mir in diesem zusätzlichen Jahr endlich die Erleuchtung, welchen Beruf ich wählen soll. Bevor ich aber endgültig Ja sage, brauche ich die Zustimmung meiner Eltern.«
Diese bekam ich postwendend. Meine Mutter begrüßte es ausdrücklich, dass ich noch ein Jahr bleiben wollte. Brigitte aber würde uns Ende März verlassen. Ihr, dem Stadtmädchen, war es hier auf die Dauer zu ländlich. Außerdem – oder gerade deswegen – litt sie ständig unter Heimweh. Am 1. April trat an ihre Stelle ein neues Mädchen, die Doris aus Landshut, sie war 14 Jahre alt. Mit ihr verstand ich mich ebenfalls gut. Sie bezog das frei gewordene Bett in unserer Kammer. Von Brigitte übernahm sie die Aufgabe als Kindsmagd. Als solche war sie jedoch noch weniger ausgelastet als ihre Vorgängerin, denn die Kinder waren im Laufe des Jahres wesentlich selbstständiger geworden und bedurften nicht dauernd der Aufsicht. Deshalb wurde Doris auch im Kuhstall eingesetzt, was ihr ausgesprochen Spaß machte, obwohl sie ein Stadtmädchen war.
Wenig später kam ich dahinter, dass es in diesem Haus ein gefährliches Geheimnis gab. Eines Vormittags, ich war nichts ahnend damit beschäftigt, den Hühnerstall auszumisten, sah ich aus dem Augenwinkel, wie ein wildfremder Mann in gebückter Haltung vorbeischlich. Wenn der schleichen muss, dachte ich, hat der nichts Gutes vor. Mitten in der Arbeit hörte ich auf und begab mich zur Bäuerin, um sie zu warnen. Das hielt ich für meine Pflicht. Sie befand sich in der Küche und ich sprudelte heraus, was ich beobachtet hatte. Warnend legte sie mir den Finger auf den Mund, wobei sie sich ängstlich umschaute, und sagte: »Pst! Zum Glück sind wir allein. Sei ja still, dass dich niemand hört.«
Verdattert hielt ich den Mund. Alles andere hatte ich erwartet, aber nicht diese Reaktion. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich sie an. Deshalb sah sie sich genötigt, mich aufzuklären. Dieser Mann sei Jude, flüsterte sie mir zu. Sie hielten ihn schon seit längerer Zeit auf dem Hof versteckt. Wo sein Versteck war, verriet sie mir allerdings nicht. »Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Vor allem aber musst du Stillschweigen bewahren. Wenn das rauskommt, dass wir hier einen Juden verstecken, sind wir alle dran. Dann kommen wir alle ins KZ und ich werde erschossen.«
Natürlich hielt ich mich streng an ihre Weisung und bewunderte im Stillen den Mut dieser jungen Frau.
Ohne erwähnenswerte weitere Vorkommnisse näherte sich auch mein zweites Pflichtjahr seinem Ende. Weder von Sofie noch von meiner Seite wurde der Versuch gemacht, ein weiteres Jahr anzuhängen. Noch immer wütete der Krieg im Lande, der sich weiter ausdehnte. Die Zeiten waren nicht nur unsicher, sie waren gefährlich. Deshalb hielt ich es für besser, wenn ich nach Hause zurückkehrte. Meine Bäuerin sah das ebenso. Zudem hatte mich meine Mutter in einem Brief beschworen, heimzukommen. An meinem letzten Tag auf dem Hof zahlte mir Sofie nicht nur meinen Monatslohn, sie drückte mir zusätzlich einen Zehn-Mark-Schein in die Hand. »Weil du immer so fleißig warst – und verschwiegen.« Dabei zwinkerte sie mit einem Auge. Ohne weitere Worte wusste ich, was sie meinte. Dann zog sie einen Brief aus der Schürzentasche und las ihn mir vor. Es war ein glühender Liebesbrief von meinem Verehrer aus Worms. Überrascht fragte ich: »Wann ist denn der angekommen?«
»Schon wenige Tage nach Giselhers Abreise.«
»Warum hast du mir den nicht gleich gegeben?«
»Auf meinem Hof dulde ich keine Liebschaften!«
Diese Aussage befremdete mich, und das ließ ich sie auch wissen: »Nach seiner Abreise bestand doch keine Gefahr mehr. Die Liebschaft, wie du das nennst, war damit beendet. Außerdem hatte sie ohnehin nur einseitig bestanden.«
»Das war mir bekannt. Dennoch war meine Befürchtung, die Liebesschwüre deines Verehrers könnten dich aus dem seelischen Gleichgewicht bringen und du würdest fortan deine Gedanken nicht mehr bei der Arbeit haben.«
»Und warum zeigst du mir den Brief jetzt?«
»Weil ich dir zum Abschied eine Freude machen will. Ich denke, es freut dich, dass du einen so glühenden Verehrer gehabt hast.«
Das tat es tatsächlich. Schon griff ich nach dem Brief, um ihn an mich zu nehmen.
»Nein«, sagte Sofie und hielt ihn fest. »Nun kennst du seinen Inhalt. Auf deinem weiteren Lebensweg soll dich dieses Schreiben nicht belasten. Deshalb wollen wir es verbrennen.« Mit dem dafür vorgesehenen Haken hob sie die kleine Eisenplatte vom Herd und warf den Brief in die Flammen. Gierig züngelten sie nach dem ersten Liebesbrief meines Lebens. Darüber war ich noch nicht mal traurig.