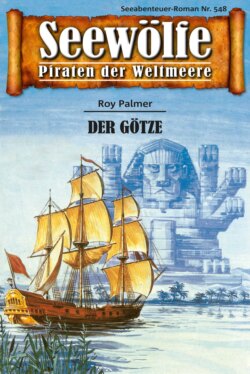Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 548 - Roy Palmer - Страница 6
1.
ОглавлениеTon de Wit hatte es in seinem Leben mit Gegnern aufgenommen, die ihm zahlenmäßig weit überlegen waren. Aber in dieser Nacht hatten die Gegner das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Bevor der Riese reagieren konnte, hatten sie ihn bewußtlos geschlagen.
Branco Fernan war der nächste, der aus dem Schlaf hochschreckte. Das hatte seinen guten Grund: Jolante wieherte entsetzt und bäumte sich auf. Branco Fernan bewegte seine steifen Gliedmaßen. Die Rüstung klapperte und schepperte. Er versuchte, sich aufzurappeln, aber es gelang ihm nicht. Nur das Visier knallte wie üblich zu.
Die Gegner waren bei ihm, umringten ihn und lachten roh. Ihre Knüppel sausten auf den Helm und auf die Rüstung, daß es nur so krachte. Es dauerte nicht lange, und Branco Fernan war derart benommen, daß er auf dem Boden liegenblieb – unfähig, auch nur einen Versuch der Gegenwehr zu unternehmen.
Jetzt wandten sich die Angreifer dem Mädchen zu. Aber Ludmilla reagierte. Gerade noch rechtzeitig genug war sie aufgewacht und erfaßte die Situation mit einem Blick. Sie konnte nichts mehr tun, um ihre beiden Freunde zu retten. Sie waren verloren. Ihre einzige Chance lag in der Flucht – zu Fuß. Einer der Kerle sprang zu dem Pferd und hielt es an den Zügeln fest.
Ludmilla kroch ein Stück davon, dann richtete sie sich auf und begann zu laufen, als hätte sie den Teufel im Nacken sitzen.
Die Kerle quittierten ihre Flucht mit Fluchen und Zischen. Ludmilla verstand zwar die Sprache dieses seltsamen Landes nicht, aber sie könnte dem Tonfall genug entnehmen. Die Angreifer hatten bemerkt, daß sie entwischt war. Jetzt nahmen sie die Verfolgung auf.
Das blonde Mädchen keuchte vor Angst. Wieder einmal verfluchte sie den Tag, an dem sie sich mit diesen beiden Verrückten zusammengetan hatte. Branco Fernan hatte ihr geholfen, das war richtig, aber es wäre wohl doch besser für sie gewesen, wenn sie daheim in Holland geblieben wäre. Natürlich wäre sie heute eine Hure. Aber war das so schlimm?
Wahnsinn, alles Wahnsinn, dachte sie, während sie flüchtete. Branco Fernan wollte die Muselmanen des Morgenlandes zum Christentum bekehren. Aber wie? Er hatte nicht mal ein Dutzend Leute, nur seinen Klepper und den Riesen, der zwar zuhauen konnte wie ein Berserker, aber eben doch nicht gegen sämtliche Araber der Welt.
Zur Hölle mit Branco Fernan! Immer trug er nur seine verdammte Rüstung, und jetzt war sie ihm zum Verhängnis geworden. Der Teufel sollte ihn holen! Ludmilla hatte irgendwie geahnt, daß es irgendwann übel ausgehen würde. Deshalb hatte sie auch ein paarmal zu fliehen versucht. Die beiden Männer hatten sie aber stets wiedergefunden und zurück in ihr Lager geholt.
Allerdings hatten sie das Mädchen dadurch auch vor einem schlimmen Los bewahrt. Vor kurzem war Ludmilla brutalen Flußräubern in die Hände gefallen, die sie vergewaltigen wollten. Im buchstäblich letzten Augenblick hatten Branco Fernan und Ton de Wit eingegriffen – sonst wäre es um sie geschehen gewesen, und die Flußbanditen hätten sie übel zugerichtet.
Aber Ludmilla verdammte Branco Fernan und dessen selbstgesetzten Auftrag dennoch. Immer wieder geriet das Trio deshalb in Teufels Küche. Und überhaupt, was hatte sie mit der Taufe dieser Heiden zu tun? Sollten diese Kümmeltürken doch glauben, an was sie wollten!
Ludmilla lief, so schnell sie konnte, zum Ufer des Tigris. Hier hoffte sie, sich im Dickicht zu verstecken. Aber die Verfolger waren schon dicht hinter ihr. Sie hörte das Trappeln ihrer Füße, das Keuchen ihres Atems. Ludmilla hatte keine Chance – sie konnte sich nicht mehr vor ihnen verbergen.
Beherzt sprang sie ins Schilf und warf sich ins Wasser. Sie flehte zum Himmel, daß es ihr doch noch gelingen möge, zu entkommen. Sie schluchzte. Ein Klatscher ertönte, sie tauchte unter und schwamm ein Stück unter Wasser. Dann hob sie den Kopf über die Wasseroberfläche. Hinter sich hörte sie ein Schnaufen. Sie warf einen Blick über die Schulter zurück – und schrie auf.
Zwei der Kerle waren ihr nachgesprungen und schwammen hinter ihr her. Sie hatten sich Messer zwischen die Zähne geklemmt. Ludmilla spürte, wie ihr Herz dröhnend zu schlagen begann. Ein würgendes Gefühl war in ihrem Hals und schnürte ihr die Luft ab. Sie verlor die Kontrolle über ihre Bewegungen. Ihre Angst schlug in offene Panik um.
Sie tauchte unter und schluckte Wasser. Plötzlich hatten die Kerle sie erreicht und griffen nach ihr. Ludmilla strampelte mit den Beinen und schlug um sich. Sie kratzte und biß, aber es nutzte ihr nichts: die Kerle zerrten sie zu sich heran.
Ludmilla riß den Mund unwillkürlich weit auf – und ein Schwall Wasser drang ein. Lieber ertrinken, dachte sie noch. Dann schwanden ihr die Sinne, und gnädige Ohnmacht entführte sie.
Ludmilla schlug langsam die Augen auf. Es fiel ihr schwer, zu begreifen, wo sie war und was vorging. War dies nun das Jenseits? Der Himmel? Sie lag in einem warmen Raum. Fackeln brannten. Sie steckten in schweren Eisenhaltern, die in die Wand gemauert waren.
Ludmilla lag auf Steinplatten. Erst jetzt, als sie an sich hinunterschaute, stellte sie fest, daß man ihr die Kleider genommen hatte.
Schritte näherten sich schlurfend. Eine Steintür wurde aufgestoßen. Ludmilla sah mit vor Entsetzen geweiteten Augen, wie eine vermummte Gestalt eintrat. Sie trug ein sackähnliches Gewand, dessen Saum bis auf den Boden reichte, und eine graue Kapuze auf dem Kopf.
„Hau ab!“ schrie das Mädchen voll Panik. Vielleicht war sie statt im Himmel in der Hölle gelandet? Möglich war es, denn ein ausgesprochener Engel war sie in ihrem Leben ja nicht gewesen.
„Schweig“, erwiderte der Maskierte mit dumpfer Stimme. „Und reden wirst du nur dann, wenn ich dich etwas frage.“
Ludmilla war völlig entgeistert. Sie vergaß sogar, ihre Blößen mit den Händen zu bedecken. „Du – kennst meine Sprache?“
„Ich kenne jede Sprache der Welt. Schweig.“
Ludmilla ließ den Kopf hängen und biß sich auf die Unterlippe. Wenn das der Teufel war, hatte sie nichts zu lachen. Er würde sie erbarmungslos quälen. Sie brauchte sich keinen Illusionen hinzugeben.
„Du wärest fast ertrunken“, sagte der Fremde. „Meine Männer haben das Wasser aus deinem Leib gepumpt und dich wieder zum Leben erweckt, nachdem sie dich ans Ufer geholt hatten.“
„Warum haben sie mich nicht erstochen?“
„Schweig!“
„Es wäre besser gewesen“, sagte Ludmilla trotzig. Sie hob wieder den Kopf und fixierte die Schlitze in der Kapuze, hinter denen die Augen des Teufels glommen. Aber glommen sie wirklich? Vielleicht war es doch nicht der Teufel?
„Du bist eine sündige Giaurhure“, sagte der Vermummte. „Du hast nichts Besseres verdient als den Tod.“
„Dann töte mich doch“, entgegnete das Mädchen. Was hatte sie schon noch zu verlieren? Nichts. Besser, sie reizte diesen Kerl bis zur Weißglut. Dann war es wenigstens bald vorbei, und sie brauchte nicht mehr zu leiden.
„Alles zur gegebenen Zeit“, sagte der Maskierte. „Es ist eine strafbare Tat, in mein Reich einzudringen. Jeder Fremdling, der wagt, seinen Fuß nach Assur zu setzen, wird mit dem Tod bestraft. Denn Allah will, daß nur sein auserwähltes Volk dieses Reich sieht.“
„Wer bist du?“ fragte sie.
„Ich bin der Herr über mein Reich.“
„Jetzt weiß ich Bescheid“, sagte Ludmilla höhnisch.
„Mein Name ist Jabal Schammar, ich bin der Erleuchtete, Allahs Vertreter auf Erden.“
„Wo sind meine Freunde?“ wollte das Mädchen wissen.
„Auch sie sind meine Gefangenen.“
„Was habt ihr mit uns vor?“
„Ich werde euch dem Urteil Allahs überantworten“, erklärte Jabal Schammar.
„Was bist du denn? Ein Priester?“ schrie Ludmilla.
„Mehr als das.“
„Ein Wahnsinniger!“ fuhr sie ihn an, dann sprang sie auf.
„Versündige dich nicht noch mehr!“ brüllte der Vermummte. „Allahs Zorn wird dich zerfetzen!“
„Ich will zu meinen Freunden!“ schrie Ludmilla. „Du Satan! Du bist ja nicht ganz richtig im Kopf!“
Sie trachtete danach, sich auf ihn zu stürzen und ihn mit ihren Fäusten zu bearbeiten, aber er griff blitzschnell zu und packte ihre Handgelenke. Ein Ruck genügte. Das Mädchen schrie gellend auf. Plötzlich lag sie wieder am Boden. Sie blickte auf und sah, daß der Vermummte wie durch Zauberei eine kurze Peitsche in der rechten Hand hielt.
Ludmilla keuchte. Sie rutschte von ihm weg, aber er war mit einem langen Schritt wieder über ihr und hieb mit der Peitsche auf sie ein. Es klatschte, und Ludmilla schrie erneut auf. Mit den Händen schützte sie ihr Gesicht und krümmte sich auf dem Boden.
Wieder sauste die Peitsche auf sie nieder. Drei, vier Hiebe trafen sie voll. Sie hatte das Gefühl, von Flammen gegeißelt zu werden.
„Versuche nie wieder, mich anzugreifen“, sagte Jabal Schammar. „Du vergrößerst nur die Zahl der Leiden, die dich erwarten, und dein Tod wird noch qualvoller sein.“
Er wandte sich ab und schritt zur Tür. Mit einem wahren Donnerhall fiel sie hinter ihm zu, und Ludmilla konnte vernehmen, wie von außen ein schwerer Riegel vorgeschoben wurde.
Das Mädchen schleppte sich zur Tür, richtete sich stöhnend auf und trommelte mit den Fäusten gegen die Steine. Ein sinnloses Unterfangen. Ihre Hände taten weh, sie ließ sie wieder sinken. Schluchzend sank sie an der Wand zu Boden.
Wie aus weiter Ferne hörte sie eine Stimme. „Ludmilla!“
„Hier bin ich!“ schrie das Mädchen.
„Hab keine Furcht!“
„Branco Fernan!“ heulte sie. „Warum holst du mich hier nicht raus?“
„Der Herr wird uns helfen!“ rief Branco Fernan, und er war überzeugt von dem, was er sagte.
Die Häscher des Jabal Schammar hatten Branco Fernan und Ton de Wit ebenfalls in zwei getrennte Räume gesperrt, die jenem ähnelten, in dem Ludmilla lag. Auch den Riesen hatte man seiner Kleidung entledigt, bis auf eine kurze Hose. Branco Fernan trug nach wie vor seine Rüstung. Keinem würde es gelingen, ihn von dem Eisenkleid zu befreien, auch dem besten Schmied nicht.
Aber was nutzte das? Nichts. Branco Fernan hatte nur seinen unerschütterlichen Glauben, an dem er festhielt. Ton de Wit und Ludmilla hegten ihre gelinden Zweifel an der großen Hilfe, die sie wie durch ein Wunder aus den Klauen der Araber retten sollte.
Wie es zur Zeit aussah, saßen sie höllisch in der Klemme – wie nie zuvor, Sie waren diesem Jabal Schammar, der offensichtlich ein fanatischer Sektenführer war, ausgeliefert.
Jabal Schammar betrat einen Raum, in dem ein großer, tückisch grinsender Götze auf einem Sockel hockte. Das Monstrum stellte ein Wesen dar, das wie eine Kreuzung aus Löwe und Sphinx wirkte und ein halbes Dutzend Arme hatte. Ein Steinmetz hatte das Ungeheuer aus einem Felsblock gehauen, den Jabal Schammar vor einigen Jahren selbst ausgewählt hatte.
Dieser Götze, so verkündete Jabal Schammar seinen Anhängern, war das Ebenbild Allahs auf Erden. Er war tatsächlich davon überzeugt, und sein Charisma war stark genug, um auch die Jünger jeglichen Zweifels zu entheben. Sie vertrauten Jabal Schammar und gingen für ihn durch die Hölle. Wenn es erforderlich war, hielten sie auch ihren Kopf für ihn hin.
Schammar sank auf die Knie, neigte den Oberkörper vor und verbeugte sich auf diese Art so tief vor dem Götzen, daß er mit der Stirn den Steinboden berührte. So verharrte und meditierte er etwa eine halbe Stunde lang. Dann richtete er sich wieder auf, murmelte Worte des Korans und zog sich zurück.
Nun ging er in einen größeren Raum, in dem seine Anhänger – etwa sechzig Kerle – in eine schweigende Andacht versunken waren. Jabal Schammar baute sich vor ihnen auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Er wartete, bis sie sich halb erhoben hatten, dann nahm er seine Kapuze ab.
Jabal Schammar war ein knochiger Mann mit einem eckigen Gesicht. Seine dunklen Augen blickten starr und bösartig, seine kantigen Züge drückten Wildheit und Unnachgiebigkeit aus. Ein Kinnbart ließ ihn noch düsterer und durchtriebener wirken, als er ohnehin schon war. Er schien von einer unsichtbaren Macht besessen zu sein, jeder spürte es. Niemand aus der Schar der Jünger wagte jemals, gegen Jabal Schammar aufzubegehren. Ihre Abhängigkeit war total.
„Salem aleikum“, sagte Jabal Schammar. „Allah ist groß, Allah ist mächtig. Die Feinde des Propheten sind uns ins Netz gegangen, wie er es befohlen hat. Doch neue Gefahr droht.“
Die Araber murmelten durcheinander. Jabal Schammar hob beschwörend beide Hände.
„Allah weist uns auch dieses Mal den richtigen Weg“, sagte der Sektenführer. „Giaurs sind im Anmarsch. Doch er erste, der seinen Fuß in unser Reich setzt, wird niedergeschlagen wie die anderen.“ Seine Augen verengten sich, sein Gesicht wurde zu einer Fratze des Hasses. „Sie sind alle unsere Feinde – Giaurs, die den Tod verdienen. Ganz gleich, ob sie weiß, gelb, rot oder schwarz sind. Sie sind keine Menschen. Sie sind wie die Tiere. Niedere Kreaturen. Am schlimmsten sind die Schwarzen, die es nicht einmal wert sind, als Sklaven gepeitscht und geknechtet zu werden. Sie sind Ausgeburten der Hölle. Sollte uns jemals einer von diesen Hunden in die Hände geraten, so werden wir ihn rösten wie ein Schaf.“
„Jawohl, rösten wie ein Schaf“, murmelten die Jünger. Sie verneigten sich vor Jabal Schammar, und er grinste wohlgefällig.