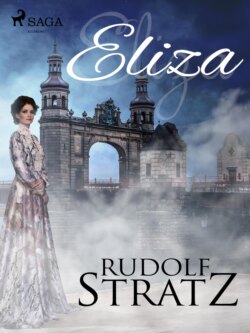Читать книгу Eliza - Rudolf Stratz - Страница 6
3
ОглавлениеAlso ich täť mich an Eurer Stell’ schäme!“ So rief das eine der beiden jungen Frauenzimmer, das grössere, braune, mit dem feinen, schmalen, vom Schutenhut beschatteten Gesicht. Sie stand zornmütig aufrecht in dem haltenden offenen Reisewägelchen, die Pelz-Wiltschura um die Schultern des ausgeschnittenen, hochgegürteten, weissen Empirefähnchens, im langen blauen Tuchrock. „An uns ist nix zu gaffe — ihr Schote! Hier ist kein Affekaste!“
Um das Fuhrwerk wogten wie Schneegestöber die weissen Waffenröcke der sächsischen Musketiere vom Infanterieregiment Loë. Hundert braungebrannte Gesichter grinsten unter den hohen, blauen Tschakos. Die Sonne brannte heiss auf die grünen Reiser und bläulichen Kochfeuer und gelben Kornschütten der stundenlangen Biwaks der Grossen Armee. Fern flimmerten in der zitternden Luft die Türme von Tilsit.
„Das sind jetzt deutsche Landsleuť, Märtche!“ rief wieder empört die Braune.
„Bettinche — halt doch die Gosch’!“ flüsterte die dralle Blonde. Aber ihre Freundin stemmte die Hände in die Hüften und funkelte furchtlos wie eine gereizte Katze auf die Soldaten hinab.
„. . und statt dass die Herre Sachse zwei schutzlose Mainzer Mädche ungeniert passiere lasse . .“
„Ich mein’, die Jungfern haben Schutz genug!“ schrie ein Korporal. Alles grölte. Vor dem Wagen hielt als Wache ein grüner, Grossherzoglich-Warschauscher Ulan zu Pferde, das weiss-rote polnische Fähnchen an der aufrechten Lanze. Eine andere rot und weiss geflammte Riesen-Tschapka und rot eingesetzte Ulanka schimmerte hinter dem Fuhrwerk. In einer zweiten, unmittelbar folgenden Kutsche raunte ein schwammiger, bleicher Franzose mit tiefschattenden Augen aus den fünf Falklappen seines braunen polnischen Wettermantels heraus zu einem an den Wagenschlag getretenen Offizier:
„Sie sehen in mir den Geheimagenten Bienassis des Herrn Polizeiministers Fouché! Ich eskortiere zwei junge Frauenspersonen, die sich des Hochverrats schuldig gemacht haben, in das Hauptquartier. Es wollen die Demoiselles Dullenkopf und Zipfler, Modeschneiderinnen aus Mainz, sein! Nun — man wird sehen!“
„Wartet nur! Ich sag’s dem Kaiser Napoleon, wie ihr euch hier unmanierlich aufführt!“ schrie drüben die Demoiselle Dullenkopf. Ein wieherndes Gelächter als Echo. Immer mehr sächsische Rheinbundkrieger strömten hinzu, Musketiere von den Infanterieregimentern Aus dem Winckel und Nostiz, Gersdorff-Cheveaulegers, weisse Zezschwitz-Kürassiere. Auch der wachhabende Leutnant amüsierte sich. Er liess den ehemaligen Abbé und Jakobiner Bienassis in seinem Wagen sitzen, schlenderte nach vorn zu den beiden Demoisellen und lüftete ironisch den hohen Dreispitz.
„Der Kaiser der Franzosen hat gerade Zeit für Dämchen eures Kalibers!“ sagte er. „Ausserdem steht Seine Majestät im Begriff, nach der gestrigen Unterzeichnung des Friedens, nach Paris, zurückzukehren. Er wird in kurzem hier durchpassieren . . .“
„Er kommt hier vorbei . .? Heilig und gewiss . .? In einer Stund’ schon?. . .“ Die Demoiselle Dullenkopf liess sich, beglückt aufatmend, steil aufrecht auf das Wagenpolster nieder. Sie faltete die Hände und warf aus ihren braunen Augen einen dankbaren Blick zum Herrn im Himmelsblau empor. „Jetzt wird alles gut!“
„Sie werden sich nicht etwa beifallen lassen, den Kaiser zu belästigen, Mamsell! Dafür wird man sorgen!“
„Ei — warum habt ihr mich denn dann per Schub aus Polen hierhergeschafft?“ frug das braune Fräulein aus Mainz spitzbübisch. „Ich bin euch allen dafür zu herzlichstem Dank obligiert, Messieurs!“
„Sie wird schon etwas angestellt haben! Lache Sie nicht, Sie Gans! Ich sehe Sie schon beim Wollespinnen in St. Lazare!“ Der Sachse blinzelte vielsagend zu dem zweiten Wagen zurück. „Mit der Pariser Polizei ist nicht zu spassen!“
Ein Haufe Offiziere stand jetzt dort an dem Kutschenschlag um Monsieur Bienassis. Aus dem himmelblau leuchtenden Biwak der Bayern nebenan war ein Brigadier der Infanterie herübergestiefelt. Blutrot flammte das Band der Ehrenlegion auf seinem blauen Herzen. Sein rundes Gesicht perlte von Schweiss. Er liess sich von dem Geheimagenten auf französisch Bericht erstatten.
„So einem z’wideren Preissen haben’s Vorschub geleistet — die Madel — die verdächtigen!“ dolmetschte er den um ihn gescharten schwarzen Raupenkämmen über hohen Schirmhelmen. „Aber am End’— jetzt ist Frieden!“
„Hären Sie — ich täť die hibschen Tierchen loofen lassen!“ sprach ein Sachse vom Infanterie-Regiment Lindt. Der dicke, kleine, bayerische Kapitän vom dritten leichten Infanteriebataillon neben ihm nickte gutmütig:
„Die Flintscherln sollen schaug’n, dass ’s weiterkommen!“
„Attention!“ Eine gelle Stimme. Die buntscheckigen Rheinbund-Uniformen spritzten salutierend auseinander. „Le maréchal!“
Der französische Korpsgeneral Lacroux trat rasch, sporenklirrend, den Reitstock wagrecht unter der Achsel, in die Mitte seiner deutschen Untergebenen. Er war ein Mann zu Anfang Dreissig, mit einem bartlosen, barschen, jungen Gesicht voll ungebildeter Bravour. Hinter ihm wimmelte sein Stab von grauköpfigen Colonels und schwarzbärtigen Brigadiers, alle um Jahrzehnte älter als er. Er schüttelte zu dem vertraulichen Getuschel des Geheimagenten ungeduldig den harten Kopf und schnalzte missbilligend mit der Zunge.
„Ah — la — la! Das ist nicht gut! Das ist Senf nach dem Essen, mein Herr! Wir haben den Frieden . . .“
Und schroff, so gedämpft, dass nur der Vertraute des allmächtigen Polizeiministers ihn verstehen konnte:
„Wenn dieser Preusse wirklich mit der Weltgeschichte um die Wette ritt, so hat sie ihn überholt! Der Wiener General Stutterheim ist seit gestern abend in Tilsit und stellt sich, angesichts der vollendeten Tatsache des Friedens, als habe er niemals den Krieg in den Falten seines weissen Mantels getragen! Dem Kaiser ist es recht. Er wünscht jetzt keine nachträglichen Verwicklungen mit Österreich. Er hat in nächster Zeit genug mit Spanien zu tun! Also schicken wir diese schönen Kinder schleunigst dahin, woher Sie gekommen! . . Einverstanden? Sie können sich dem Gewicht meiner Gründe nicht entziehen? Gut!“
Der General Lacroux trat zu dem vorderen Wagen.
„Stehen Sie auf, Demoiselles, wenn ich mit Ihnen spreche!“ befahl er kurz. „Sie haben Glück! Die Grossmut Frankreichs lässt Gnade für Recht ergehen! Sie erhalten die Erlaubnis, ungesäumt nach Mainz zurückzukehren! Schlagen Sie sofort, nachdem Ihre Pässe umgeschrieben sind, von hier aus den Weg nach Skaisgirren ein! . . . Sehen Sie mich nicht so schnippisch an! Kein Wort mehr! Sie sind französische Bürgerinnen! Sie befinden sich in der Zone des französischen Kriegsrechts! . . Lassen Sie sich das gesagt sein! Gute Reise!“
„In einer Stunde gehorche ich mit Vergnügen, mein Marschall!“ sprach die Demoiselle Dullenkopf sanft und setzte sich wieder. „Vorher muss ich noch hier den Kaiser sprechen!“
„Sind Sie toll geworden?“
„Wegen dieser Konversation tat ich ja die Reise! Die Fahrt nach Danzig war nur ein Vorwand!“
„Und Sie bilden sich ein, der Kaiser hat auch nur einen Blick für leichtfertige kleine Frauen Ihres Schlags, die im Biwak die Gemüter seiner Soldaten verwirren? Wolle einer der Herren, die Deutsch sprechen, dem Kutscher befehlen, im Galopp mit diesen beiden Abenteurerinnen nach Skaisgirren abzufahren. Die Pässe folgen nach.“
„Ich bleibe hier — und wenn man mich totschlägt . .“ Die Demoiselle Dullenkopf kletterte eilfertig aus dem Wagen und stand blass, die kleinen Fäuste geballt, rebellisch aufgereckt, mit den schwarz bebänderten Halbschuhen tief im weissen Staub. Der General Napoleons verzog keine Miene.
„Wir sind mit den Preussen fertig geworden!“ sagte er. „Wir werden auch mit Ihnen, Demoiselle, noch fertig werden! . . Hebt das Hühnchen wieder in den Wagen . . . Tausend Donner . . . Es widerstrebt mir, Gewalt gegen eine Frau anzuwenden! . . Nehmen Sie Vernunft an . .!“ Er furchte grimmig die Stirne. „Der gesunde Menschenverstand müsste Ihnen doch sagen, dass Personen Ihrer Art der Zutritt zum Kaiser verschlossen ist . . Halt! . . Nähern Sie sich mir nicht! Sie sind hübsch — ich gebe es zu aber ich wünsche keine Küsse! Wie? Nur zwei Worte ins Ohr . . .?“
Der Marschall Lacroux neigte seinen Zweispitz unwirsch zu den roten Lippen der Demoiselle Dullenkopf. Er presste den bartlosen, willensfesten Mund beim Zuhören immer nachdenklicher zusammen. Der Ausdruck seiner Züge blieb kalt und unbewegt. Aber aus den schwarzen Augen glitt ein jäher, unwillkürlicher Blick höchster Überraschung an dem jungen Frauenzimmer hernieder.
„Haben Sie irgendeinen Beweis für das, was Sie da behaupten?“ frug er leise und schnell.
„Ich weiss, dass im Gefolge des Kaisers Generale genug sind, die mich von Frankfurt und Mainz her kennen!“
„Und wenn dies eine Finte ist, Madame — wenn Sie doch wirklich die kleine Schneiderin Dullenkopf aus Mainz sind — wenn ich eine Unwürdige vor das Angesicht Napoleons liesse — nein — das ist unmöglich . .“
„Ebenso unmöglich, mein Marschall, dass Sie mir die Hilfe Frankreichs verweigern, nachdem Sie wissen, wer ich bin! Ich stehe, wenn nicht heute, so doch über kurz oder lang vor dem Kaiser! Und dann würde es Ihnen, schon aus Rücksicht auf die Rheinbundfürsten, übel vermerkt werden, dass Sie eine Fremde meiner Distinktion hier als fahrendes Fräulein behandelten!“
„Gut denn!“ Der Franzose hatte, mit der Schnelligkeit des Truppenführers, überlegt. „Ich weiss einen Ausweg! Wer ist dies hier? Ihre Zofe? Vortrefflich! Warten Sie mit ihr, wenn es beliebt — nur eine Viertelstunde, Madame! — in der Herberge hier gegenüber das Weitere ab!“
Der brutale junge Marschall geleitete, zum Staunen seines Stabs, die beiden Putzmamsellen persönlich zu dem Krug an der Heerstrasse von Tilsit nach Tapiau und beurlaubte sich am Eingang mit einem gemessen-achtungsvollen, zurückhaltenden Handgriff an den goldbetressten Hut. Durch die scheibenlos schwarzen Fensterhöhlen des schmutzigen Wirtshofs, den die Demoisellen röckeraffend betraten, wehte der Sommerwind, durch die weissen Sparren der abgedeckten Dächer schien die Julisonne in die leeren Ställe und Scheunen, aber hinten am Schanktisch klirrten dem schwitzenden, hemdsärmeligen Litauer die Soustücke mit der phrygischen Freiheitsmütze in den Kasten wie vorher, beim Rückzug der verbündeten Heere, die adlergewappneten preussischen Groschen und die russischen Kopeken mit dem heiligen Georg. Die grosse niedere Wirtsstube war gedrängt voll. Auf deutsch, polnisch, litauisch, französisch, jiddisch, italienisch wurde gezankt und geflucht, an den Tischen geschmust, in den Winkeln wurden Wechsel gekritzelt, im Hof draussen noch, neben dem Misthaufen, Geldkatzen aufgenestelt und geheimnisvolle Säcke zugebunden.
„Alleweil sind sie doch hinter der Armee beim Pferdehandel, Märtche!“ sagte die Demoiselle Dullenkopf in der Ecke, in die sie sich vor den bunten Uniformen und schwarzen Kaftanen, den weissen Stallmänteln der Rosskämme und den flaschengrünen Fräcken der Agioteure und Negozianten hineingedrückt hatten. „Guck’! Da unterm Tisch weise sich die böse Bube heimlich als schon silberne Leuchter . .“
„. . . und die Welsche’ in den Bärenmützen schachern gar mit ganzen Vliessen, die sie den Hammeln auf der Weide abgeschore’ habe!“
„Und wir hocke’ hier im Prison! Da draussen, vor der Tür, promeniert unser Monsieur Bienassis als Schildwach’ auf und ab . . .“
„Aber er macht einen scheppen Buckel und schielt nur so verkniffe’ zu uns herüber wie die Euľ am Mittag . . . Bettinche . . . dem Oos ist nit wohl zumut’ . . .“
„Wenn ich nur wüssť, was der Marschall vorhat! . . Da! . . . Eben gibt er einem Offizier einen Befehl . .“
„Der sitzt auf und galoppiert davon . . . In der Richtung nach Tilsit . . . als ob es brennen täť! . . Jetzt sieht man ihn nicht mehr im Staub . . . Bettinche . . . warum wirst du denn auf einmal so feuerrot?“
„Ich — warum nit gar?“
„Was siehst du denn dort drüben in der Wirtsstub’?“
„Nix! Jetzt weisst du’s!“
„Ach — du liebe Zeit . .“ Das dralle Märtche schnellte halb vom Holzschemel empor. „Da sitzt er ja . . der Preuss’ von neulich . . von der Weichselfähr’ . . . Jetzt wirst du auf einmal wieder weiss wie Quarkkäs’, Bettinche — was hast du denn?“
„Ach! Lass mir mein’ Ruh’, du Gackerlies . . .“
„Jetzt sieht er dich auch! Jetzt guck’ nur, was das dem Mann für ein Pläsier macht! Da geht gerad’ die Sonne auf dem seiner Visage auf . . .“
„Schau’ doch nicht immer hin!“
„Du guckt ihm ja gerad’ fortwährend in die Augen! Und er dir! . . . Jetzt steht er auf! Er kommt hierher! . . . Jesus — der Herr Musterreiter hat sich aber arg verändert!“
Der Kandidat Juel Wisselinck trug eine Kegelmütze von vermottetem Sumpfbiberpelz auf dem scharfkantigen, bartlosen Blondkopf, und um den hageren, sehnigen Körper eine enge Joppe aus weichgegerbtem, dottergelbem, zähem Elentierleder. Mit schweren Halbstiefeln an den wollgrau behosten Beinen, sonnenverbrannt, sah er aus wie ein herrschaftlicher Urwaldförster oder Wildnisbereiter. Seine blauen Augen lachten. Er trug seine kurze, bläulich qualmende holländische Tonpipe in der einen, sein dickes, grünes Schnapsglas in der anderen Hand, pflanzte beides auf den Tisch der beiden Modeschneiderinnen, nahm unbefangen neben ihnen Platz und quetschte die zarten Finger der Demoiselle Dullenkopf mit einem stürmischen Druck.
„Dank, deutsches Mädchen!“ sprach er frisch und frei. „Neulich — am Weichselufer — war keine Zeit dazu! . . . Ich musste mich sputen, den Fluss zwischen mich und diese Pariser Canaille samt ihren Schlachzizen zu legen!“
Die Demoiselle Dullenkopf wurde wieder dunkelrot. Sie konnte sich nicht helfen: sie musste den Fremden sofort wieder Warnen . . .
„Drehen Sie sich ja nicht um!“ versetzte sie leise und schnell. „Es ist unrecht von mir . . . als Mainzerin . . als französische Citoyenne . .!“
„Sie sind deutsch von Art und Geblüt! Sie haben es herrlich an mir bewährt . .“
„. . . aber da draussen steht er ja . . . Ihr Feind von der Pariser Geheimpolizei!“
„Er hat mich schon längst bemerkt!“ Der junge Mann schob sich das holländische Pfeifchen zwischen die weissen Zähne und paffte . . . „und ist knurrend weiter gehinkt wie ein Köter, der seinen Knochen verloren hat! Seit gestern ist Friede! Da wagt sich der geheime Monsieur mitten in Preussen nicht so leicht an einen Preussen heran wie im Krieg drunten in der sächsischen Wasserpolackei!“
„Und da placieren Sie sich hier sans gêne mitten unter die Franzosen?“
„Kann ich denn anders? Ich reise in höchster Eile! Aber die Strasse nach Tapiau ist vorläufig gesperrt! Die Posten scheuchen, bis der Napoleon durchpassiert ist, jeden, der nicht Subjekt des Kaiserreichs ist, mit Pulver auf der Zündpfanne zurück!“
„Deswegen können auch wir nicht weiter!“ sprach die Demoiselle Dullenkopf. „Märtche — du Aff’ — was gibt’s denn schon wieder zu pruste?“
„Ach — das ist zu komisch, wie ihr beide euch alleweil anguckt!“ Die kleine Blonde platzte heraus. Die zarte Braune wurde wieder heftig rot. Auch die wetterversengten Wangen des Kandidaten Wisselinck durchblutete ein heisser Hauch. Er trommelte verwirrt mit den Fingern auf den Tisch, leerte sein Schnapsglas und schaute angelegentlich zum Fenster hinaus. Und ebenso die braune Mainzer Modistin in die Ecke drüben, wo ein Haufen Rosstäuscher und scharlach über dem Helm geschweifter Kürassiere einander in leidenschaftlicher Gebärdensprache die Preise ihrer kriegslahmen Gäule an den Fingern vorzählten.
Und dann schauten sich die beiden, der Kandidat und die Putzmamsell, doch plötzlich wieder durch Zufall an und kamen nicht voneinander los. Und der junge Mann stützte, träumerisch in sein Gegenüber verloren, das blonde Haupt in die hohle Hand und sagte langsam:
„Einem Mädchen wie Ihnen wollte ich schon lange begegnen. Das habe ich geahnt! Das war mir vorbestimmt. Anders als die flachsgelben Marjellen hier — dunkel und zart — und eben doch eine rechte, tapfere Deutsche! Da sieht man erst, wie gross Deutschland ist und wie reich! Ich weiss ja nichts vom Rhein da unten und von den deutschen Nationen, die an seinen Ufern wohnen! Aber wenn erst einmal wirklich Friede in Preussen ist, dann besuche ich euch, ihr Kinder! . . Und Sie zeigen mir alles, was es Schönes — sogar ausser Ihnen noch — dort am Rhein gibt! Ich darf doch kommen, trautstes Fräulein?“
Die Demoiselle Dullenkopf sah vor sich nieder. Der zarte Ausschnitt ihres weissen Empirekleides wogte heftig. Eine kaum merkliche Bewegung des braunen Kopfes konnte für ein „Ja“ gelten. Die andere stiess mit ihrem Schutenhut an das Ohr der Freundin.
„Bettinche“, flüsterte sie. „Pass’ doch Obacht! Du verliebst dich ja! Aber schon bis über die Ohre . . .“
„Hab’ ich dich gefragt?“
„Und er sich erst recht! . . . Aber das hab’ ich schon seit der Weichsel bei dir gemerkt! Seitdem hat’s dich . . . vom erste Augeblick an!“
„Märtche . .“, sprach die Braune leise und blass, während der ihr gegenüber in Nerzkappe und Elenwams befangen durch die Scheibensplitter des Fensters ins Blaue hinaussah. „So ungern ich es tu’! . . . Es ist das erstemal — aber ich muss dich an den Abstand zwischen uns erinnern . .“
„Ei was! Wir sind zwei Putzmädle vom Rhein . . .“
„Missbrauche nicht mein Vertrauen!“
„Ich bin ein rheinisch Kind — und solang wir Fastnacht spiele und ich Narrefreiheit hab’, da gebrauch’ ich sie und sag’: Bettinche — Hand aufs Herz: — Du bist verschosse! . . In den Preussen drüben . . . und er in dich!“
Der junge Mann wandte den sonnenbraunen, festkantigen Blondschädel vom Fenster ab und verlor sich wieder in den Anblick der Demoiselle Dullenkopf.
„Sie wären würdig, eine Preussin zu sein!“ sprach er ernst und langsam. „Das klingt vermessen — jetzt — wo es seit gestern die Raben auf dem Felde ausschreien: Finis Borussiae! . . . Auch mein Gemüt war tief bedrückt und ohne Hoffnung . . . Aber wunderbar: Seitdem ich Sie wiedergefunden habe, habe ich auch neuen Mut in mir gefunden . . .“
„Oh — ich begreife . .,“ fuhr er fort, „dass Sie verwirrt vor sich auf die Tischplatte niederschauen und schweigen! Wozu sollten Sie erst reden? Ihre Taten sprechen für Sie! . . Glauben Sie mir, Sie unverzagte Patriotin: Was Sie an der Weichsel für mich taten, das taten Sie für Preussen . . . wenn auch leider Gottes umsonst.“
„Jesus Maria und Josef, Bettinche“, das Märtche Zipfler flog wie ein blonder, kleiner dicker Ball vom Sitz in die Höhe. Ihr Zeigefinger zitterte in der Richtung nach der Heerstrasse. „Merkst’ was, wer da angaloppiert kommt . . .?“
„Wer denn, um Gottes willen — Märtche?“ Die Demoiselle Dullenkopf stand langsam, ungläubig auf und beschattete mit der Hand die Augen.
„Er selber . . .“
„Nein!“
„Ha doch! Der hat uns hier gerad’ gefehlt!“
Die Strasse von Tilsit her fegte in geräumigen Sprüngen seines Hengstes ein General der Grossen Armee. Er ritt einen mächtigen, goldbraunen, langschweifigen Mecklenburger, der feurig die sechs Fuss Länge seines Herrn trug und kurz verhalten wie ein flankenzitterndes Steinbild stand. Der Reiter schwang sich, in der Behendigkeit eines Mannes von kaum Mitte Dreissig, mit beiden Beinen gleichzeitig aus Sattel und Bügeln, warf über die Schulter weg den Ordonnanzen die Zügel zu und trat, hoch, breitschultrig, schmalhüftig, ein Kriegsgott selber, vor den Marschall Lacroux hin. Ein dunkler Schnurrbart wirbelte sich in seinem schönen, regelmässigen Gesicht unter der hohen Pelzmütze mit der an goldener Agraffe wippenden Reiherfeder. Reiche Goldverschnürung überglitzerte seine lichtblaue Husarenuniform bis zu der Stickerei auf den goldbordierten purpurnen Reithosen. Noch die Sporen an den spiegelnd schwarzlackierten Kniestiefeln waren von Gold. Rubinaugen glühten aus dem goldenen Löwenkopf seines krummen Damaszenersäbels. Um die linke Schulter schaukelte ihm ein lose umgehängtes echtes Leopardenfell mit zähnefletschendem Rachen.
Der Marschall Lacroux eilte, ganz gegen seine barsche und kalte Troupierart, dienstbeflissen dem Brigadier der Kavallerie entgegen. Auf der rechten Brust des goldblauen Husaren vor ihm flammte der fünfstrahlige, brillantenbesetzte Silberstern der Grossoffiziere des Ordens der Ehrenlegion. Und unter dem Pantherfell hervor schlang sich ein breites Orangeband von der rechten Schulter zur linken Hüfte, und darüber strahlte, auf dem Herzen, das achteckige Gefunkel eines fürstlichen Hausordens. François Bienassis’, des Geheimagenten, Schattenaugen erkannten, hinter dem Marschall vor, das Grosskreuz des Praunheimschen Familienordens de la noble passion, mit den Donnerkeilen in den Fängen des fliegenden Adlers und der Rundschrift: ,Virtute bellica!’ Der Spion krümmte seinen feisten Leib zu einem untertänigen Diener, während ihn der Marschall vorstellte und hinzusetzte:
„Ihnen, Monsieur Bienassis, der, wie Ihr Herr und Meister Fouché, alles weiss, ist es natürlich auch bekannt, dass Seine Durchlaucht, Fürst Viktor von Praunheim-Kestrich, wiewohl regierender Fürst des Rheinbundes, doch, um seinem Drang nach soldatischen Lorbeeren zu genügen, als General in der Grossen Armee dem Kaiser dient!“
„Als Krieger dem Kriegsgott selber!“ sagte der schöne, hochgewachsene deutsche Fürst und streifte sich den weissen Stulphandschuh von der Rechten. „Ihre Befehle, mein Marschall? Sie liessen mich Hals über Kopf aus Tisit rufen . .“
„. . . weil nur Ihre Gegenwart, mein Fürst, die dringende Frage klären kann, ob dieses hübsche, brünette, junge Frauenzimmer, die eben dort drüben aus dem Krug tritt, eine grosse Dame oder eine Abenteurerin ist!“
Die Demoiselle Dullenkopf schritt, mit ihrem langen blauen Tuchrock achtlos den Staub aufwirbelnd, rasch, blass, gereizt wie eine Katze, quer über die Strasse auf den Marschall Lacroux zu. Sie funkelte den rauhen Haudegen, vor dem seine Generale und Soldaten zitterten, kampflustig, den Kopf im Nacken, aus ihren braunen Augen an.
„Ich beglückwünsche Sie, mein Marschall!“ versetzte sie atemlos und erbittert. „Ihre Strategie führt mich hier mit dem einzigen Mann der Grossen Armee zusammen, den ich vermeiden musste, wegen dessen ich diese Verkleidung als kleine Putzmamsell wählte . .“
„Es war der einzige Weg für mich, festzustellen, Madame, ob der hohe Name, den Sie sich beilegten . . .“
Der Kaiserlich französische Brigadier der Kavallerie, Fürst zu Praunheim-Kestrich, stand hochaufgereckt, ein farbenprächtiger, schnurrbärtiger, in der Sonne glitzernder Mars, breitbeinig auf seinen mächtigen Türkensäbel gestützt. Er lächelte ironisch und mass die kleinbürgerlich gekleidete junge Frauensperson vor ihm mit einem spöttischen Blick seiner dunkeln Augen.
„Die Dame spricht die Wahrheit, mein Marschal!“ sagte er. „Es ist meine Kusine Eliza aus dem bisher regierenden Hause Praunheim-Krähenstein, Freie Gräfin und Standesherrin des ehemaligen heiligen römischen Reiches deutscher Nation!“
„Meiner Treu, Euer Gnaden!“ Der Marschall Lacroux, der einstige Lyoner Metzgergeselle, führte, vor den erstaunten Augen der Grossen Armee, galant wie ein Marquis der alten Zeit, die Fingerspitzen dieser kleinen Bürgerin an seine Lippen. „Wer könnte Ihnen leichter Ihren Wunsch, vor Napoleons Auge zu treten, erfüllen als hier der Fürst, Ihr Vetter? Er steht bei dem Kaiser in hoher Gunst!“
„Das hiesse allerdings den Bock zum Gärtner machen!“ sagte die junge Reichsgräfin von Praunheim mit zornfeuchten Augen. „Vor meinem Herrn Vetter hier suche ich ja gerade Zuflucht bei dem allmächtigen Mann, dessen Wille Europas und Deutschlands Landkarte neu ordnet! Im Namen meiner unterdrückten Familie will ich bei ihm, dem erhabenen Protektor des Rheinbunds, gegen diesen Herrn Vetter Klage erheben, der sich nur durch den Adel seines Namens von dem Schinderhannes und anderen Räubern am Rhein unterscheidet!“
„Mässigen Sie sich, Kusine! Sie sprechen von einem General Frankreichs!“
„Dieser Herr Vetter — allezeit Mehrer seiner Lande auf Kosten seiner eigenen Verwandten — würde alles aufgeboten haben, um mich von hier fernzuhalten, hätte er geahnt, dass ich auf dem Marsch war und die Wahrheit mit mir! Die Wahrheit, wie es im Hause Praunheim zugeht, vor die Ohren des Kaisers der Franzosen! Jetzt werden Sie leider nicht Ihre prahlende Uniform zwischen den grossen Mann und mich drängen können, mein armer Vetter Viktor! Jetzt ist der Kaiser auf dem Weg hierher . . .“
„Man hört schon die fernen Hochrufe!“ murmelte, vorsichtig zurückhaltend, um es vorläufig mit keinem der beiden Häuser Praunheim zu verderben, der Ex-Abbé und Ex-Jakobiner François Bienassis. „Man steht schon die Staubwolke auf der Strasse!“
Die Heerstrasse war weithin zu beiden Seiten — überschwemmt von den weissen, blauen, roten, grünen Farbenwellen der aus den Biwaks herangeströmten Regimenter. Viele Tausende von Armen fuchtelten in der Luft und schwangen ebenso viele Tausende von Tschakos und Czapkas, Helmen und Bärenmützen, Zweispitzen und Kalpaks. Ein tausendstimmiges Jubelgeschrei lief gleichmässig mit der staubwirbelnden Wagenreihe mit, verklang hinter ihr und schwoll vor ihr bei ihrem Näherkommen an — stärker — immer stärker . . .
Da . . ein Blitzbild aus dem Morgenland — vorbeiflitzend in ihren Turbanen, wie ein bunter Papageienschwarm, die Mamelucken, dann ein trabendes Gewimmel goldener Fangschnüre, roter Rossschweife, blitzender Kürassiere . . . dahinter — langsamer rollend — jetzt — bei dem Marschall Lacroux haltend, ein offener, achtspänniger Wagen.
Die Gräfin Praunheim-Krähenstein hastete an den starr auf den Sattelpferden sitzenden grüngoldenen Kutschern vorbei. Sie stand vor der Feldequipage Napoleons. Sie fasste, die Ellbogen spreizend, ihren Tuchrock rechts und links mit den Fingerspitzen. Sie sank in einer ehrfurchtsvollen Verbeugung zusammen. Sie machte nicht das alltägliche französische Kompliment, sondern — nach dem Wiener Hofzeremoniell des alten Deutschen Reichs — die feierliche spanische Reverenz mit kreuzweis gebogenen Füssen bis zur Erde, und wiederholte sie unterwegs noch zweimal, bis sie an den Kutschenschlag herantrat.
Aber schon drängte der Korporal der Elite-Gendarmerie, der Nachhut des kaiserlichen Gefährts, ihr die breite Brust seines riesigen, normannischen Apfelschimmels entgegen. „Zurück, Madame!“ herrschte es unter seinem Schnauzbart. Zugleich sprang atemlos ein goldbetresster Würdenträger des Kaiserreichs aus der aufgestossenen Wagentüre. „Zurück, im Namen aller Teufel — Madame!“, zischten seine feinen, bartlosen Diplomatenlippen. Gerade jetzt vor drei Jahren hatte der Grossmarschall Duroc, als sich bei Abbeville, auf der Landstrasse in Nordfrankreich, Madame Charlotte Encore dem Kaiser zu Füssen warf, durch den dünnen Batistärmel der jungen Witwe noch rechtzeitig das vergiftete Stilett schimmern sehen. Die schöne Madame Encore war im Gefängnis gestorben, ohne dass man jemals ihren wahren Namen erfuhr. Aber seitdem durfte kein patriotisches Frauenzimmer mehr sich Napoleon mit der Bitte, ihn umarmen zu dürfen, nähern.
Doch von der anderen Seite des Wagens hatte der Marschall dem Kaiser rapportiert. Der kleine, gedunsene, gelbliche Mann machte eine kaum merkliche Bewegung des Cäsarenkopfs unter dem Zweispitz. Die Reichsgräfin Praunheim stand vor dem kleinen Korporal im ordenslosen, hellgrünen Frack der Jäger zu Fuss über der weissen Weste. Sein Blick wurde wohlwollender, als er sah, wie hübsch sie war. Ein Lächeln des feingeschnittenen Mundes gab ihr die Erlaubnis zu reden. Eliza Praunheim hielt die gefalteten Hände vor der Brust. Ihre Stimme flog, um die kostbaren, unwiderbringlichen Minuten auszunützen . . . . .
„Die Gnade Eurer Majestät hat auch geringere deutsche Souveräne der Aufnahme als Fürsten des Rheinischen Bundes gewürdigt — den Grafen von der Leyen, der nur viertausendfünfhundert Seelen hat — die beiden Salme — den Fürsten Isenburg! . . . So auch meinen Vetter Viktor hier — den Praunheim-Kestricher! Sein Gebiet ist nicht grösser als das unserer Krähensteiner Linie des Hauses Praunheim! Auch wir Krähensteiner, Sire, herrschen über ein Städtchen, sieben Flecken, acht Schlösser, achtundfünfzig Dörfer, Höfe und Mühlen!“
Der Kaiser der Franzosen, bisheriger König von Italien, Protektor des Rheinbunds, Schutzherr der Schweiz, blinzelte amüsiert aus seinen dunklen Augen den Generalen zu. Die junge Reichsgräfin fuhr atemlos fort:
„Aber wir von der Krähensteinschen Linie waren zu ungeschickt und langsam, um rechtzeitig, wie mein Herr Vetter Viktor, in Paris in den Vorzimmern zu erscheinen! Meine beiden Brüder, Sire, taugen zu nichts! Der Hyacinth — der regierende Graf — ist ein Libertin — und der andere, der Kasimir, ein Stubenhocker! Meine Eltern sind tot. Meine Grand’maman kann nur beten und Karten legen! Ich bin der letzte Mann in der Familie . . .“
„Es scheint so . . .“ Der Kaiser nickte belustigt dem Grossmarschall zu.
„Darum habe ich mich aufgemacht, um unser Recht zu verfechten! Ja — Sire — unser Recht gegen schnöde Gewalt! Mein Vetter Viktor hat den Machthabern in Paris vorgespiegelt, er sei der Souverän aller Praunheimschen Lande — auch der unseren! Man hat ihm geglaubt! Der Kriegsminister Berthier steckt mit ihm unter einer Decke! Und vor allen Lambert, der Generalkommissar des Rheinbunds — dieser allmächtige Lambert ist der grosse Totenvogel unserer Krähensteinschen tausendjährigen Selbstherrlichkeit, zugunsten meines Herrn Vetters Viktor!“
„Sie ist hübsch!“ sagte Napoleon zu den Generalen.
„Der Kommissar Lambert, Majestät, hat bereits die Receveurs unserer Hauptkassen abgesetzt, sich von unseren Ämtern Handtreue leisten lassen, uns unsere Salpetergruben weggenommen und den Salpeter an die Würzburgische Armee verschoben . .!“
„Die ganze Armee des Erzherzog-Grossherzogs von Würzburg zählt zweitausend Mann!“ rief verächtlich der Kaiserliche Brigadier Viktor Praunheim-Kestrich. Seine Base sprudelte weiter:
„Die Walburgi-Steuer hat man uns für meinen Vetter, den Herrn Rheinbundfürsten, beschlagnahmt — das schöne Judenschutzgeld — das Fleisch-Accis — die Wiesenpacht . . .“
„Madame . .“
„Ja — da wundern sich Euer Majestät . . . Unser Ölzins ist weg — die Zehndhämmel — die Mehlwage — alle Gülten und Laudanien . .“
„Genug, Madame . . .“
„Der Leibschilling, die Rauchhühner, das Besthaupt, der Novalzehnde . .“
„Um Gottes willen . . . hören Sie auf . .“
„Nur zwei Worte, Majestät . . . Man will uns die Wappenknöpfe nehmen! Unsere Diener sollen die Kestrichsche Nationalkokarde an den Hüten tragen! Meine Brüder dürfen die Krähensteinsche Familien-Uniform nur noch im Innern des Schlosses anlegen! Unsern Hausorden von der Fidelité sollen wir nicht mehr an Darmstädter und andere Ausländer verleihen . . .“
„Madame, eine Kanonade ist mir lieber . .“ Der Kaiser der Franzosen hielt die edelgeformten, kleinen Hände vor die Ohren. Aber dann hörte er doch wieder der hübschen, erhitzten Reichsgräfin zu, die sich flehend über den Kutschenschlag beugte.
„Sire . . . was soll denn aus uns werden? Um mich ist mir nicht bange! Ich knie in Andacht vor Ihrem Genius! Ich folge ihm durch Europa! Ich werde einfach Marketenderin in Ihrer Grossen Armee! Aber Grand’maman! Aber meine Brüder — diese unfähigen — ein Tänzer und ein Bücherwurm . . . Und das alles wegen meines Vetters Viktor! . . . Nein, Sire, wenn die Krähensteinsche Semperfreiheit erlöschen soll, dann lieber Französisch als Praunheim-Kestrich’sch!“
„Was sagen Sie dazu, General Praunheim?“
„Sire: auch der jetzige Rheinbundfürst Isenburg-Birstein hat, im Grundvertrag von St. Cloud, genau vor einem Jahr, mit Genehmigung Eurer Majestät seinem Reich die Isenburgschen Besitzungen der Linien Büdingen, Wächtersbach und Meerholz einverleibt!“
„Davon wird der Fall nicht besser!“ rief die Reichsgräfin Eliza und warf sich leidenschaftlich in den Staub der Strasse nieder. „Sire . . . Sie sind gerecht — Sie sind grossmütig — Sie sind der Richter der Welt — im Grossen wie im Kleinen — ich liege vor Ihnen auf den Knien . . .“
Mit dem wohlgelaunten, fetten, kleinen General in grünem Jägerfrack und schwarzem Dreispitz drinnen im Wagen ging eine Wandlung vor. Er hörte nicht mehr recht hin. Der gelbe Marmor seiner Züge beschattete sich grüblerisch. Plötzlich fiel ihm etwas ein — irgendwo in Europa — der Brückenkopf über die Elbe bei Wittenberg — Getreide für Junots Territorialtruppen in Estremadura — der verschwenderische Kaffeeverbrauch in den Tuilerien — die Absetzung der Könige von Portugal und Etrurien . . neue Brotbeutel für die Garde-Pontonniers . .
„Stehen Sie auf, Madame!“ sagte er trocken. „So wichtige Dinge bricht man nicht übers Knie! Reichen Sie ein Memorial ein — hier — an den Grossmarschall Duroc! Zu Ende der Campagnezeit — gegen Weihnachten dieses Jahres — bringen Sie sich persönlich bei mir in Paris in Erinnerung! Ich werde dann entscheiden . . .!“
Die Gräfin Praunheim stand mitten auf der Landstrasse, klopfte sich die weissen Knieflecke aus dem blauen Tuchrock und schaute, tief aufatmend, dem rasch kleiner werdenden Staubgewimmel von Mamelucken, Gendarmen und Wagenrädern in der Ferne nach. Dann blinzelte sie zu ihrem Vetter empor. Der mannesschöne, schwarzschnurrbärtige Brigadier sass schon, in Regenbogenpracht strahlend, auf seinem hochbeinigen Hengst.
„Monseigneur . . .“ Ein tiefer Knicks. Ein Neigen des Schutenhuts unten. „Es war mir eine Ehre . .“
„Sie spotten zu früh, Kusine! Noch haben Sie beim Kaiser nicht gewonnenes Spiel!“
„Aber einen Stein im Brett! . . . Meine Sache marschiert! Auf Wiedersehen in einem halben Jahr in Paris, Herr Vetter!“
Der Husarengeneral oben hob förmlich die weissbehandschuhte Rechte zur Pelzmütze.
„Darf ich Sie bitten, hier die Sauvegarde zu erwarten, die ich Ihnen ohne Verzug aus Tilsit senden werde!“ sagte er kalt. „Wie auch unsere persönlichen Beziehungen sein mögen . . . Sie sind eine Praunheim . . .“
„Euer Durchlaucht geruhen zu irren! . .“, sprach das Fräulein, unten ehrerbietig. „Dero gehorsame Dienerin schreibt sich Demoiselle Dullenkopf . .“
„Sie können nicht als eine Aventurière . .“
„Ich bin ehrbare Modeschneiderin, mein Prinz . . .“
„. . . sich im Kriegsgetümmel Missverständnissen aussetzen.“
„. . . . denen ein sittsames Frauenzimmer mit bei sich habendem ordinären Pass unschwer entgeht! Es war mir ein Glück, Ihnen aufzuwarten, gnädiger Herr . .“
„Sie wetzen Ihren Witz umsonst an mir, Kusine!“
„Ich reise heute noch mit meiner Freundin . . .“
„Ihrer Kammerjungfer vermutlich . .?“
„. . einer bescheidenen Putzmacherin gleich mir, nach Mainz zurück und empfehle mich dem hohen Herrn Rheinbundfürsten zu Gnaden . . .“
„Sie weisen das standesgemässe Geleit ab, das ich Ihnen biete?“
„Es wäre für mich zu viel der Ehre! Ich verabschiede mich mit untertänigstem Kompliment von meinem Herrn Landesvater . . .“
Der Mars im Sattel oben unterdrückte einen Lagerfluch. Er hieb seinem Mecklenburger den rechten Sporn in die Weiche und stob im Galopp davon. Sein Pantherfell flatterte. Der Reiherstutz wehte. Der Türkensäbel tanzte. Die Gräfin Eliza nickte ihm, befriedigt die kleinen, weissen Zähne zeigend, nach und schaute um sich. Die goldbetressten Hüte des Marschalls Lacroux und seines Gefolges dunkelten weit da drüben aus einem weissen und blauen Gewoge sächsischer und bayrischer Offiziere. Aber dicht vor der jungen Praunheim war aus dem Staub des Bodens eine düstere Gestalt in Ottermütze und Elenwams, mit juchtenen Waldstiefeln, aufgewachsen. Die wetterbraunen Züge des Kandidaten Juel Wisselinck färbten sich fahl. Er hatte die Arme über der Brust gekreuzt. Er mass die Reichsgräfin aus seinen wilden blauen Augen vom Hutband bis zur Schuhschleife.
„Napoleonsmagd . . .“ sprach er.
Die Gräfin Eliza verschränkte wie er die Arme über der Brust und hielt fest seinem Blick stand.
„Was geht das Ihn an?“ fragte sie hochmütig.
„Oh — ich weiss es . . Es sprach sich schon im Krug herum. Sie stammen aus einem regierenden Hause, das sich Praunheim nennt . .“
„. . . seit Karls des Grossen Tagen, mein Herr!“
„Es soll viele solche Zaunkönige da draussen im Reiche geben!“
„Aber keinen vornehmeren als wir . .“
„Um so schimpflicher, dass Sie sich zur Erde bücken, dem Eroberer die Schuhriemen zu lösen! Das ist das deutsche Mädchen, das ich in Ihnen sah! . . Das ist die Patriotin vom Rhein, die ich bewunderte! . . Blutiger wurde noch nie ein Mann enttäuscht! . . Mein Herz ist voll Bitterkeit, Madame, weil ich es zu früh und freimütig erschloss . . .“
„Lassen Sie jedem seine Art zu leben!“ sagte die Standesherrin kühl. Der junge Mann lachte auf.
„Kniet nur vor dem apokalyptischen Tier!“ sprach er grimmig. „Betet ihn an, den kleinen, fetten Zauberer, der keine Schlacht verliert! Wissen Sie, wie es in dem Trauerspiel des Herrn Professor Schiller heisst: ,Ich verachte dich — ein deutscher Jüngling!’ Ich bin ein Preusse . . .“
„Und was ist Preussen?“ Die Reichsgräfin vom Rhein reckte kampflustig den hübschen, braunen Kopf. „Euer Preussen, mein Herr, war! Es ist nicht mehr! Sein König musste sich Napoleon unterwerfen, sein Heer ist zerschellt, sein Adel gebrochen, sein Land verwüstet, seine Kassen leer, seine Städte vom Feind besetzt! . . . . Was hat es noch für einen Sinn, Preussen zu dienen — mit Lebensgefahr zu dienen — wie Sie?“
„Das weiss, ich auch nicht!“ sagte Juel Wisselinck.
„Nun also . . .“
„Ich tu’ es eben!“
„Mon Dieu — warum?“
„Weil ich muss!“
„Weshalb müssen Sie?“
„. . . weil ich ein Preusse bin . . .“
„Das geht im Kreise herum!“ sagte die junge Krähensteinerin. „Das beisst sich wie die Schlange in den Schwanz! . . . Nun — halte Monsieur das, wie es Ihm beliebt — was liegt mir an Preussen?“
„Gar nichts?“
„Wahrlich nichts, mein Herr! . . Ich bin selbst Souveränin, so gut wie Ihr König!“
„Warum haben Sie mich dann an der Weichsel gerettet?“
Die Gräfin Praunheim schwieg und betrachtete die Radspuren Napoleons im Staub.
„Warum haben Sie mich vorhin vor den Kreaturen der Pariser Polizei gewarnt?“
Eliza Praunheim schaute immer noch auf eine kleine Vertiefung in dem Staubmehl des Bodens. Das war die Stelle, wo sie vor dem Kaiser der Franzosen gekniet.
„Ich weiss es wirklich selber nicht!“ sagte sie, ohne den Blick zu erheben.
Es kam keine Antwort. Endlich schaute sie auf. Sie stand allein. Der Mann im Elenwams ging, schon zwanzig Schritte von ihr entfernt, die Heerstrasse dahin — weiter — immer weiter — ohne den Kopf zu wenden, zwischen den Lagervölkern Napoleons hindurch — und entschwand ihrem Blick.