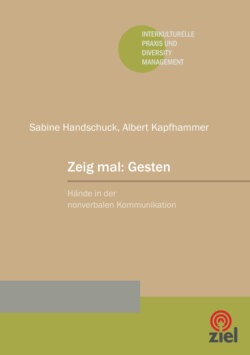Читать книгу Zeig mal: Gesten - Sabine Handschuck - Страница 7
ОглавлениеSuche nicht die großen Worte, eine kleine Geste genügt.
Phil Bosmans
1. WAS SIND GESTEN?
Unter Gesten werden in diesem Buch Zeichen verstanden, die mit der Hand oder den Händen ausgeführt werden und die eine bewusste Form der Kommunikation darstellen. Das ist eine willkürliche Eingrenzung des großen Themas „nonverbale Kommunikation“, da auch Bewegungen mit Kopf, Schulter, Armen usw. Gesten sind, auf die aber nur ganz am Rande eingegangen wird. Gestik wird zum Teil auch unbewusst ausgeführt, also nicht mit der Absicht einer Mitteilung. „Etwa 90 Prozent aller Gesten eines erwachsenen Sprechers werden redebegleitend produziert“ (Weidinger 2011: 9). Sie haben überwiegend keinen expliziten Mitteilungscharakter.
Werden Gesten bewusst eingesetzt, sind sie mit einer Kommunikationsabsicht verbunden und werden als konventionelle Gesten bezeichnet. Kinder lernen deiktische Gesten als erstes – diese Hinweisgesten beziehen sich auf Personen, Gegenstände, Orte und Zeiten. Deutet ein kleines Kind auf ein Spielzeug, kann das bedeuten: „Das will ich haben!“ Deutet es auf sich selbst, heißt das „ich“.
Viele Menschen erwarten den sogenannten Fingerzeig bei einer Hinweisgeste. Mit einem Fingerzeig auf die Tür kann ein Kind seinen Wunsch ausdrücken, auf den Spielplatz zu gehen, auch wenn dieses Anliegen noch nicht in Worten gefasst werden kann. Bittet man in Seminaren darum, zu zeigen, wo die Zukunft liegt, wird in der Regel der Fingerzeig nach vorne eingesetzt. Auch das ist eine deiktische Geste.
Bildhafte Gesten, auch semantische Gesten genannt, übermitteln Informationen durch die bildliche Darstellung. Diese kann einen Gegenstand durch eine Handbewegung formen, so zum Beispiel einen imaginären Ball, der mit den Händen umschlossen die Größe des Balles wiedergibt. Die konkrete Darstellung wird auch als ikonische Geste bezeichnet.
Es kann aber auch eine Vorstellung, eine Idee gestisch ins Bild gesetzt werden. Semantische Gesten, die abstrakte Konzepte darstellen, werden als metaphorische Gesten bezeichnet. So visualisiert eine Handbewegung zur einen und zur anderen Seite ein Pro und ein Kontra und entspricht der Redewendung „zwei Seiten einer Medaille“.
Die dritte Kategorie der semantischen Gesten sind Embleme. Embleme können von jedem Mitglied einer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe problemlos gedeutet und auch sprachunabhängig eingesetzt werden. Beispielsweise gehören Bejahungs- oder Verneinungsgesten zur Gruppe der Embleme. Bedeutungen von Emblemen sind kulturspezifisch. So kann ein Nicken je nach Kontext sowohl eine Bejahungsgeste als auch eine Verneinungsgeste sein. Die häufigsten Missverständnisse in der nonverbalen interkulturellen Kommunikation sind auf die Fehlinterpretation von Emblemen zurückzuführen.
„Ein Gestentyp wird Beat genannt, da die gestischen Bewegungen aussehen, als würden sie den Takt anschlagen“ (Weidinger 2011: 8). Andere Bezeichnungen für diesen Typus sind Taktgesten oder rhythmische Gesten. Sie werden sprachbegleitend eingesetzt und unterstreichen das Gesagte, akzentuieren relevante Aspekte, visualisieren emotionale Beteiligung oder strukturieren die Rede: Beispielsweise kann der drohende Zeigefinger sich während einer Schimpftirade auf und ab bewegen, oder die rhythmisch bewegten Hände in Form einer Handpyramide können dem Gesagten Nachdruck verleihen.
Die Einteilung in verschiedene Gestenformen bleibt unscharf, da sich durch eine Geste verschiedene Informationen vermitteln lassen. Um welchen Typus von Geste es sich handelt, ist davon abhängig, was jeweils mitgeteilt werden soll. Abhängig von der Mitteilungsabsicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, verbale und nonverbale Informationen zu kombinieren (Handschuck / Klawe 2004: 175f).
Gesten können das Gesagte unterstützen, was mit Redundanz bezeichnet wird. Teilt man einer Person mit, dass man ihrem Anliegen nicht entsprechen will und macht dazu eine abwinkende Geste mit der Hand, unterstreicht die Geste das Gesagte.
Durch Gesten kann aber auch eine Botschaft nonverbal ergänzt werden. Sogenannte komplementäre Botschaften konkretisieren das Gesagte. Wenn eine Person im Gespräch äußert, dass sie manche Verbote für völlig unangemessen hält und dabei auf das Schild „Spielen im Hof verboten“ zeigt oder mit dem Daumen hinter sich auf die Hausmeisterwohnung deutet, wird die verbale Mitteilung um die Informationen ergänzt, welches Verbot gemeint ist, und wen man dafür verantwortlich macht.
Bei der Addition werden zusätzliche Informationen gegeben. Gesten dienen dabei als Interpretationshilfe zur Einschätzung von Einstellungen oder Bewertungen. Berichtet eine Frau ihrer Freundin, dass eine gemeinsame Bekannte trotz Schulden einen Flug in die Karibik plant und tippt sich dabei an die Stirn, wird deutlich, was sie von dem Vorhaben hält.
Von Divergenz spricht man, wenn nonverbale Botschaften und verbale Botschaften im Widerspruch zueinander stehen. Beispielsweise kann die verbale Begrüßung einer unwillkommenen Person durchaus freundlich formuliert sein, aber die ausgestreckte Hand wird ignoriert. Oder es wird beteuert, dass das erzählte Erlebnis des Gegenübers interessant ist, vermittelt aber durch das Drehen der Daumen, wie langweilig und langatmig der Bericht empfunden wird.
Bei der Substitution werden Worte durch Gesten ersetzt. Ob man dem Freund den Daumen hält oder der riskant fahrenden Fremden den Mittelfinger zeigt, die Hand zu Abwehrgeste erhebt, um nicht angesprochen zu werden oder den Finger auf die Lippen legt – die Botschaften bedürfen keiner verbalen Ausführung.