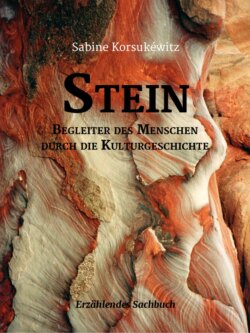Читать книгу Stein - Sabine Korsukéwitz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. Jade und Türkis – zwei Edelsteine der Frühgeschichte
Aus der chinesischen T‘ang-Dynastie (618 – 907 v.Ch.) ist eine grausame Geschichte überliefert:
3000 Schönheiten aus dem ganzen Reich zierten den Hof des Kaisers Ming. Einer davon gelang es, alle anderen auszustechen und den Kaiser an sich zu fesseln. Sie soll sehr schön gewesen sein, Yang-kuei-fei, Jade-gekrönte-Yang; schwarze Mandelaugen, der Mund eine Rosenknospe, eine Haut wie Pfirsich und Reispapier; ihre Gestalt war schlank und biegsam wie ein Schilfrohr im Wind und sie bewegte sich in so feinen Trippelschritten, dass sie über den Boden zu schweben schien.
Hinter dem zarten Äußeren muss sich ein harter Kern verborgen haben. Willensstark, intelligent und skrupellos brachte sie den Kaiser dazu, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen und der Hofstaat tanzte wie Puppen an den Fäden ihrer kleinen Finger. Sie war die wirkliche Macht hinter dem Himmelsthron. Eine Zeitlang bewunderte man sie derart, dass die Geburt eines Mädchens als gleichwertig der eines männlichen Nachkommen galt.
Was Yang-kuei-fei trug, wurde sofort Mode im gesamten Reich. Ihr Geschmack war berühmt und kostspielig. Besonders liebte sie Jade und sie veranlasste Kaiser Ming unsägliche Summen dafür auszugeben. Außerdem betrieb sie einen über die Maßen frechen und offenen Nepotismus, so dass bald jede einträgliche Stelle mit einem ihrer vormals armen Verwandten besetzt war.
So gewaltig wurde ihre Arroganz und Verschwendungssucht, so drückend die Steuern, dass es schließlich zu einem Volksaufstand kam. Der Kaiser und sein Hofstaat sahen sich gezwungen, mitten im bitteren Winter über die Berge nach Sezuan zu fliehen.
Die Soldaten, die hungrig waren und lange keinen Sold bekommen hatten, machten Yang-kuei-fei für ihre Lage verantwortlich. Sie stellten dem Kaiser ein Ultimatum: Entweder Yang würde auf der Stelle hingerichtet, oder aber sie würden den Kaiser und seine Anhänger im Stich lassen, allein in den Bergen. Bei aller Liebe war dem Kaiser doch der eigene Pelz näher und, nachdem er sich mit einem wunderschönen Liebesgedicht bei Yang-kuei-fei entschuldigt hatte, überließ er sie den Söldnern.
Sie erhielt, wie es Sitte war, einen Seidenschal, an dem sie sich selbst aufzuhängen hatte. Da hing sie nun, an einem kahlen Pflaumenbaum, Heer und Kaiser zogen weiter. All ihr kostbarer Jadeschmuck fiel herab und lag dort im Gras und auf den nackten Felsen. Doch so verhasst war Jade-gekrönte Yang, dass niemand die Schmuckstücke auflas. Wahrscheinlich liegen sie heute noch an der Stelle.
Das Verhältnis der Chinesen zu Jade ist mit der Freude anderer Völker an Schmuck-, Edelsteinen und schönen Dingen nicht zu vergleichen. Für sie besitzt Jade eine Qualität, die man nur als mystisch bezeichnen kann und sie haben eine gerade unheimliche Fähigkeit wahre Jade von ähnlichen Grünsteinen zu unterscheiden. Es ist der Stein des Himmels und mit keinem anderen zu vergleichen. Noch in den 70er Jahren bekam ein Drittel aller neugeborenen Mädchen das Wort Jade als Teil ihres Namens beigefügt: Rote Jade, Jadeschnee..., für Junge suchte man Namen, die Prestige und Macht ausdrückten: Pi (Jadescheibe, die in alten Zeiten hohen Rang ausdrückte), Kuei (Jadeszepter) oder Pu (rohe Jade von hohem Wert). Die chinesischen Schriftzeichen für König und Jade sind sich ähnlich. Sie unterscheiden sich nur durch einen einzigen Punkt. Und das war ganz sicher beabsichtigt. (In alten Zeiten war der König – oder was man bei uns etwa parallel darunter verstand – die höchste Person im Staat; der Begriff Emperor/Kaiser entstand erst später).
Jade war rar im alten China. Als True jade, ‘wahre Jade’ , gilt nur Nephrit, der hauptsächlich in Khotan, der Provinz Sinkiang (Chinesisch Turkestan) gefunden wurde und zwar am White Jade River und im Green Jade River, wo er heute noch abgebaut wird.
Das Verlangen nach dem Besitz von Jade war überwältigend. Frühe chinesische Herrscher richteten ihre Eroberungszüge danach aus, dem Reich soviel Jade-produzierende Gebiete wie möglich hinzuzufügen. Mehrmals sind chinesische Generäle an Burma gescheitert. So groß war die Angst der Generäle vor dem Zorn des Himmelsohns Chien-Kung, dass sie den burmesischen Prinzen hohe Bestechungsgelder zahlten, um Jade heimbringen zu können, die sie dem Kaiser dann als ‚Tribut‘ präsentierten.
Allerdings kommt aus Burma ‘nur’ Jadeit, auch Jadeitit. Der Unterschied zur ‘wahren Jade’ ist wohl nur einem Chinesen verständlich, denn beide sind Silikate mit unterschiedlichen Beimischungen von Magnesium, Eisen, Kalzium und Natrium.
Nephrit, wahre Jade, ist das zäheste Mineral, das wir kennen. Es gehört zur selben Gesteinsgruppe wie Asbest. So hart ist dieser Stein, dass er mit keinem Hammer auf einem Amboss zu zerschlagen ist. Es heißt, dass der Inhaber eines Mineralienkontors bei Bonn um 1910 einen sehr großen Nephrit Block aus China in seinen Besitz bekam. Er wollte ihn natürlich gern in kleinere, besser verkäufliche Stücke zerschlagen und – als die Hammer und Amboss-Methode scheiterte – legte er ihn unter einen Dampfhammer. Der Nephrit blieb unbeschädigt, der Dampfhammer war verbogen!
In China machte man vor 2000 Jahren folgendes Experiment: Ein Nephrit Stück wurde drei mal vierundzwanzig Stunden in einem Kalkofen gebrannt – und kam wie Phoenix aus der Asche heraus, ohne etwas von Glanz und Farbe verloren zu haben. Durch das Glühen wurde er allerdings spröde, so dass er jetzt wenigstens leichter zerteilt werden konnte. Soweit – so gut. Wie aber um alles in der Welt konnte man dieses unglaublich widerstandfähige Material in der Vorzeit bearbeiten? Mit einem unwahrscheinlich hohen Werkzeugverbrauch, feinstem Schleifsand und Kupfersägen, in geduldigster Kleinarbeit, bei der sich Fortschritte nur millimeterweise zeigten. Ein chinesischer Jademeister rechnete für die Fertigstellung eines einziges faustgroßen Stücks ein halbes Jahr.
Kultgegenstände aus Nephrit hat es mindestens schon seit der Jungsteinzeit gegeben. Sorgfältig geschliffene und geglättete Dolche und Äxte aus Grünstein sind aus Gräbern in Sachsen, Südeuropa, Dalmatien, Mähren, Ungarn, Schlesien, Österreich und der Schweiz geborgen worden. Gefunden wurde er in Europa aber nur sehr selten, in südlichen Geröllen und als Adern in der Schweiz. Alles weist also auf einen Fernhandel aus Asien hin. Das hat man sich anders vorzustellen, als Handel heute. Es dauerte vielleicht einige Jahrhunderte, bis so ein Gegenstand von Hand zu Hand ging und immer weiter gen Norden wanderte, getauscht, geraubt, geplündert wurde, bis er schließlich als Prunkaxt am Gürtel eines Sachsenhäuptlings hing.
Eine regelrechte Nephrit Kultur ist sonst nur aus Neuseeland bekannt, wo Grünstein in großer Menge vorkam, aber wegen der unendlichen Mühseligkeit seiner Bearbeitung nur zu besonderen Zwecken verwendet wurde, beispielsweise zur Ahnenverehrung. Äxte aus Nephrit waren Häuptlingsprivileg.
Im Altertum rechnete man auch grünen Jaspis zu den Grünsteinen. Jaspis, ein Silicium Oxid das wesentlich leichter in die gewünschte Form zu bringen ist. Heute werden Fälschungen angeboten aus gefärbtem Marmor, Serpentin, Aventurin, Chrysopras, Rhodonit oder einfach aus Glas. Man ist also gut beraten, wenn man ein wirklich teures Stück erwirbt, sich auf der Kaufquittung versichern zu lassen, dass es sich um echte Jade handelt, so dass man den Kaufpreis reklamieren kann, wenn es sich als Fälschung herausstellt. Bei Groschenartikeln, wie man sie in vielen Steinläden und auf Flohmärkten findet, lohnt sich dieser Aufwand sicher nicht.
In der Antike war ‘Grünstein’ sehr beliebt. Er wurde von den Ägyptern, den Griechen und später den Römern abgebaut. Plinius der Ältere, General und Naturforscher, beschreibt ihn in seinen Steinbüchern so:
“Im Morgenland soll man den Jaspis, welcher dem Smaragd ähnlich ist, und der mitten querdurch mit einer weißen Linie gezeichnet ist, auch Monogrammos heißt, oder wenn er mehrere solcher Linien enthält und dann ‘der Vielbeschriebene’ heißt, als Amulett tragen.”
Die Stämme Israels lernten ihn wahrscheinlich in der ägyptischen Gefangenschaft kennen. Anschließend trug der Hohepriester der Juden in seinem Brustschild einen als ‘Jaspis’ bezeichneten Stein, der wahrscheinlich Nephrit war. Für das wichtige Ritual der Knabenbeschneidung wurden Messer aus Nephrit verwendet. In Persien wurde dieses Mineral als yeschem bezeichnet – Sprachforscher machen daraus den ‘hebräischen Jaspis’. Im alten Assyrien galt der Nephrit als geburtsfördernder Stein. Eine Keilschrift von Ischtars Höllenfahrt erwähnt einen Gebärgürtel aus Nephrit. Man kann sich allerdings auf die Übersetzungen nicht unbedingt verlassen, weil es im Altertum mit den Bezeichnungen und Einordnungen für Steine und Minerale bunt durcheinander ging. Die Wertschätzung für milchig-grüne Steine war allerdings bei allen Völkern der Frühzeit hoch, viel höher als die für alle Edelsteine, die im Westen heute Frauenherzen und Kapital in Bewegung setzen.
Laut singhalesischer Überlieferung soll sich Gautama, als er zum Buddha wurde, auf einen Thron aus durchscheinendem grünem Stein gesetzt haben. Der Thron stand im Himalaya-Gebirge und soll bis in den Himmel gereicht haben. Ob es sich dabei um Nephrit gehandelt hat?
Einzig Chinesen wussten offenbar schon immer genau den feinen Unterschied festzustellen. Der chinesische Philosoph Kvan Chung (7.Jh vor unserer Zeitrechnung) erklärte die überragende Bedeutung dieses Steins so: “In seiner glänzenden Glätte erkennt man das Sinnbild des Wohlwollens (der Götter), in seinem leuchtenden Schliff ist das Wissen verkörpert, in seiner unbiegsamen Festigkeit die Gerechtigkeit.” Sein chinesischer Name ist auch yu , ‚Edelstein der Edelsteine‘ oder ‚hohe Wahrheit‘.
Diese Steine sind so einzigartig, weil aus märchenhaften und zauberischen Vorzeiten stammen. Eine Schöpfungsgeschichte:
In der frühesten Zeit kämpften zwei mächtige Anführerinnen um die Herrschaft über das Reich der Mitte. Nach langem Streit besiegte endlich die Gute die Schlechte. Aber leider wurde bei dem heftigen Kampf eine der vier Säulen des Himmels beschädigt, so dass ein Teil des Firmaments einstürzte. Die neue Herrscherin war darüber traurig und sehr bestürzt und bat ihre Untertanen ihr aus allen Teilen des Landes Steine von höchster Qualität zu bringen, aber was man ihr brachte war nicht schön genug. Da verbrachte sie viele Tage damit, sie so zu verfeinern, dass sie der Farbe und Beschaffenheit des Himmels gleich kamen. Als endlich die Reparatur beendet war, freute sich das Volk daran und feierte das große Werk. Es waren aber einige von den Steinen übrig geblieben. Die verstreute die Herrscherin über das ganze Reich, damit sie von späteren Generationen gefunden und zu Kunstwerken von angemessener Schönheit verarbeitet werden konnten. Seither ist eine Bezeichnung für Jade auch ‘Stein des Himmels’.
Und tatsächlich, wenn man lange genug in so ein milchiges Stück helle Jade blickt, mit ihrem weichen Glanz, soviel angenehmer und ruhiger als ein funkelnder, grellbunter Edelstein – ist es nicht so, als ob man eine kleine Wolke in Händen hält? Das taktile Erlebnis, wenn man ein geschliffenes Stück Nephrit oder Jadeit in der Fingern hält ist ausgesprochen luxuriös; sie fühlt sich fein an und weich wie Seide, fest und doch nicht hart. Jade erwärmt sich in der Hand, ohne ein gewisses Gefühl von beruhigender Kühle zu verlieren. Man muss es selbst ausprobieren. Die Empfindung lässt sich nicht mit Worten teilen. In der Steilheilkunde soll Jade jähzornige Menschen besänftigen.
Die Besessenheit mit diesem Stein kannte im Alten China keine Grenzen. Ganze Städte wurden für ein gutes Stück Jade eingetauscht, ungefähr so, als ob man Berlin und Potsdam für einen einzigen schön geschnittenen Löwen aus Jade verschenkt hätte, mit all seinen Einwohnern darin.
Die besten Fundstücke hatten den Herrschern ausgeliefert zu werden und deren Sucht danach lässt sich mit simpler Prunksucht überhaupt nicht erklären. Und mit Gewinnstreben schon gar nicht, denn sie war kein gewöhnliches Zahlungsmittel. Der Jade wurden alle möglichen wundertätigen Eigenschaften zugeschrieben. Unter anderem sollte sie den Körper von Toten unverwest erhalten. Prinz Liu Sheng aus der Han-Dynastie wurde in einem Jadegewand begraben, das mit 2156 rechteckigen Stücken besetzt war, von Golddrähten zusammengehalten. Die Arbeitszeit zu diesem Kleidungsstück soll 12 Jahre betragen haben. In der Zeit der Han-Dynastie (206 v.Ch. – 220 n.Ch.) wurde der Taoismus von der Philosophie zur Religion erhoben. Unsterblichkeit wurde zum Hauptziel aller menschlichen Bemühungen – so erklärt sich der Aufwand für das Begräbnisgewand aus Jade.
Erst in späterer Zeit wurde der Edelstein profaniert und begann dem individuellen Schmuck zu dienen. An den Fürstenhöfen kam eine Weile lang die Mode auf, ‘singende Steine’ zu tragen, Gürtel, die durch die Anordnung der Jadestücke angenehme musikalische Tonfolgen erzeugten. So wollte man höflicherweise seine Annäherung ankündigen, damit Anwesende Gelegenheit hatten, eventuell peinlichen Klatsch über die sich nähernde Person zu beenden.
Wir kennen Jade hauptsächlich grün, aber es gibt sie auch in rosé, weiß und gelb. Die am meisten geschätzte Farbe auch von Jade war ‘imperial yellow’, weil alle Chinesen sich als Nachkommen des legendären gelben Kaisers sehen, der 2698 – 2598 v.Ch. die Größe Chinas begründete.
Die feierlichste Zeremonie, die je ein Regierender auszuführen die Ehre hatte, war das Jadeopfer für Himmel und Erde auf dem heiligen Berg Tai. Sie konnte nur stattfinden, wenn die Nation wohlhabend und in Frieden lebte und keine Naturkatastrophen irgendwelche Teile des Reiches verwüstet hatten.
Naturgemäß kam solch eine Gelegenheit nur selten, insgesamt acht mal vom ersten König/Kaiser 221.v.Chr bis Sung Chen Tsung 1008 n.Chr. Er war der Letzte, der die Zeremonie ausführte. Vorher musste er sieben Tage fasten und meditieren und trug dann zwei Sets von Jadebüchern (oder Tafeln) auf den Berg Tai. Sie enthielten Danksagungen und Bitten an die Geister von Himmel und Erde. Ein Set verblieb vergraben auf dem Berg, das zweite wurde wieder mit heruntergebracht und im kaiserlichen Palast aufbewahrt. Nur zwei solcher Tafeln wurden nach langer Zeit wiedergefunden und 1933 von General Ma Hung-kuei außer Landes geschafft. Er deponierte sie als seinen persönlichen Besitz in der Bank von Los Angeles. Seine Witwe gab sie 1971 der chinesischen Republik zurück.
Heutzutage existieren nur noch sehr wenige von den wunderbaren antiken Jadeschätzen in Rot China und das ist wirklich eine Schande, gemessen an der einzigartigen Bedeutung, die Jade für Chinesen hat. Jeder kennt wohl die Geschichte der Eroberung Chinas durch die vereinigten Kolonialmächte, die Geschichte einer einzigartigen konföderierten Strafexpedition gegen ein Reich der Mitte, das sich weigerte, sich in ein Volk von Süchtigen verwandeln zu lassen. Vielleicht wäre die Sache anders ausgegangen, hätten die Herrscher dieses alten Kulturvolks – ebenso wie die jüngeren Nationen – Waffen höher geschätzt als Schönheit.
Man erzählt sich, dass die Kaiserin-Witwe Cixi wie alle Bewohner der Verbotenen Stadt vor ihr, nach ihrem persönlichen Geschmack und ohne Rücksicht auf die Kosten, luxuriöse Umbauten und Verschönerungen vornehmen ließ. Entgegen dem Rat ihrer Beamten befand Cixi, dass ihr himmlisches Reich gegen eine Handvoll stinkender Barbaren keine Flotte benötigte und zog das Silber aus der Kriegskasse ab. Als die Umbauten im Vergnügungsgarten des Sommerpalastes beendet waren, lud sie die Edlen des Reiches zu einem Fest und präsentierte ihnen stolz einen künstlichen See in dessen Mitte marmorne Schiffe elegant ihre Segel blähten.
“Seht her: Das ist meine Flotte!”, soll sie lachend gerufen haben.
Mitte des 19.Jh war das Reich der Mitte besiegt und gedemütigt, weil seine altertümlichen Segler den dampfbetriebenen europäischen Kanonenbooten keinen nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen hatten. Ich weiß nicht, ob diese Anekdote so ganz der Wahrheit entspricht. In der Regierungszeit der letzten Qing wurde die Armee nämlich mit großem Aufwand modernisiert. Wie auch immer: Die Kriegsdschunken der Qing wurden versenkt. 1858 marschierte Lord Elgin in Peking ein. Und nun fielen natürlich die ‘stinkenden Barbaren’ über die Schätze des Sommerpalastes her. Unbezahlbare Jadekostbarkeiten, die seit hunderten und tausenden von Jahren im Besitz chinesischer Fürsten gewesen waren, verschwanden in den Hosentaschen englischer und französischer Marodeure. Die wertvollsten und größten Stücke wurden säuberlich in Kisten verpackt nach England und Frankreich verbracht, wo ein geringerer Teil in Museen, der weitaus größere Teil in Privatsammlungen landete.
Erst danach, nachdem einiges von den Beutestücken ausgestellt und beschrieben worden war, kam Jade auch in Europa in Mode. Die Preise zogen an. 1863 verkaufte der König von Annam (heute Vietnam) aus einer Geldverlegenheit heraus dem Kaufmannhaus Siemssen, das eine Niederlassung in Kanton unterhielt, einen eineinhalb Kubikfuß großen grünen Stein. Wenig genug mag der Kaufmann dafür angeschrieben haben, denn ihm war Wert und Geschichte der Ware nicht bewusst. Später stellte sich heraus, dass er ein gutes Geschäft gemacht hatte: Der Stein wurde auf 36 000 Dollar taxiert.
Was bei der ersten Plünderung des Sommerpalastes hatte versteckt und gerettet werden können, verschwand 1900 während des Niederschlags des Boxeraufstands durch englische Truppen. Aber kein langnäsiger Eroberer, sondern Mao gab dem Jadekultur den Todesstoß, indem er die Bevölkerung zwang zum Wohle der Revolution all ihren Jadeschmuck herauszugeben. Da kamen dann die letzten fein geschnittenen Jadeblüten zum Vorschein, die Dolche, Vasen, Schalen, Schmetterlinge, Vögel und mythischen Tiere, Einhörner und Phoenix, Miniaturlandschaften, antike Steine von ungewöhnlicher Farbe, manche mit winzigen Einschlüssen von Gold Diese mussten an die Partei ‚gespendet‘, um gegen Devisen ins westliche Ausland verhökert zu werden.
Offiziell wurde der Jade Kult verpönt. Als während der Kulturrevolution dem damaligen Staatoberhaupt Liu Shao-Chi der Prozess gemacht wurde, zählte zu den Anklagepunkten die Tatsache, dass er Jade-Antiquitäten gesammelt hatte, Beweis seiner bürgerlichen Dekadenz.
Heute ist zwar immer noch Hongkong die Jade-Hauptstadt der Welt. Kenner und Sammler aus aller Welt besuchen dort Auktionen auf denen ungeheure Preise für historische und besondere Stücke gezahlt werden. Und die Jade, die heutzutage in Khotan gefördert wird, erzielt durchaus vergleichbare Preise. Aber es gibt nicht mehr so viele zahlungskräftige Kunden. Große Steine werden oft zerschlagen, weil sie in mehreren kleineren Teilen leichter verkäuflich sind und es gibt, dank der Kulturrevolution, nur noch wenige Jademeister, die in der Lage wären, den Stein des Himmels zu bearbeiten wie in alter Zeit.
Nur ein anderer Stein wurde in der Frühzeit in ähnlich spiritueller Weise von einem Volk geschätzt: Der Himmelsstein der Indianer, der Türkis oder chalchihuitl.
Das heutige Gebiet der Bundesstaaten Neu Mexiko, Arizona, Colorado, Utah, Nevada und Kalifornien war bewohnt von asiatisch-stämmigen Menschen, die vor 40.000 Jahren eingewandert waren, auf der Flucht vor dem sich ausbreitenden Eis. Die Beringstraße war zu dieser Zeit trocken gefallen und zu Fuß überquerbar. Einige der Stämme zogen in den südlichsten Teil von Nordamerika. Im Laufe der Erdentwicklung stellte sich heraus, dass sie Eis für Feuer eingetauscht hatten. Ihre neue Heimat war eine unbarmherzige wasserarme Steinwüste mit einem empfindlichen ökologischen System, dem sie sich aber hervorragend anzupassen verstanden.
Hier fanden sie auch jenen nass schimmernden blau-grünen Stein, der in seiner Farbe all das in repräsentierte, was ihnen lebensnotwendig, ja heilig war: Wasser und Himmel – den Türkis. Es störte sie nicht, dass er in Farbe und Qualität variierte, das tun Wasser und Himmel auch.
Die besten Stücke wurden bewahrt oder als Schmuck gefasst, die geringeren als Opfergaben für Rituale verwendet oder zerstoßen und magischen Gebräuen zugesetzt. (Da wurden, wenn meine Quellen stimmen, die Götter beschummelt.) Kein Schamane, Medizinmann, Cazique hätte ohne Türkis sein Amt ausüben können. Er war die Verbindung zum Göttlichen und zur Seelenwelt schlechthin.
Alle Stämme schätzten diesen Stein zu einem gewissen Grad, manche mehr, manche etwas weniger, und alle waren bereit, einige Mühen auf sich zu nehmen, wenn es darum ging, ein besonders gutes Stück zu erwerben. Mit Türkis und den Indianern sei es, wie mit Jade bei Chinesen, so hat man mir versichert: Sie hätten ein geradezu übersinnliches Gespür für die Güte und Echtheit dieses Steins. Sie würden ihn durch ihre tiefe spirituelle Bindung daran erkennen. Nie könne man ihnen eine Fälschung oder ein minderwertiges Stück für einen guten Türkis aufschwatzen. Mit Sicherheit haben sie ihr Leben lang so engen Kontakt zum Türkis und er ist in ihrer Kultur so wichtig, dass sie wohl allein deshalb keinen Fälschungen aufliegen würden.
Seit der Steinzeit haben sie ihn vom Boden aufgesammelt – besonders nach einem Regenguss sind die schimmernden Steine gut auszumachen – und aus Bergen herausgegraben. An die zweihundert prähistorischen Türkisminen sind heute noch bekannt, ein guter Teil davon dokumentiert und kartographiert durch die spanischen Eroberer.
In unserem präzisen, materialistischen Wertsystem, in dem es um Härtegrade, Reinheit und Seltenheit geht, um Geldwert, hat dieser Stein einen geringen Platz. Es ist ein wasserhaltiges Kupfer-Aluminiumphosphat, kryptokristallin, knollig, tropfsteinförmig und ist als Kluft Füllung oder Überzug von bereits vorhandenem Gestein entstanden. Die besten Steine finden sich in weichenTalksäumen, aus denen man sie mühelos herausgraben kann; meist aber stecken sie in einer härteren Matrix von Ergussgesteinen oder Pegmatiten. Türkis hat einen Härtegrad von fünf bis sechs Mohs. Sein Glanz ähnelt Wachs oder Porzellan. Die Farbe variiert von blau-grün über dunkelgrün, rötlich braun und violett bis hin zu weiß. Nur die wasser- und himmelfarbigen Qualitäten aber sind die Seelensteine, von denen ich erzählen möchte. Der sogenannte ‘schwarze Türkis’ der Zuni-Indianer ist gar keiner; es ist versteinerte Kohle. Doch genug von diesem Mineralonesisch. Das können Sie in jedem Nachschlagewerk finden.
Gesammelt und als Edelstein geschätzt wurde er in den Alten Reichen, in Ägypten, wo man ihn aus dem Sinai bezog, im Osmanischen Reich und in Persien. Den Namen, unter dem er uns geläufig ist, hat er von europäischen Kreuzfahrern bekommen, die ihn zum ersten Mal in der Türkei zu Gesicht bekamen – Türkis.
Aber für kein Volk hatte er auch nur annähernd die Bedeutung, wie für die indianischen Stämme des amerikanischen Südwestens. Ihre Religion oder Philosophie waren animistisch. Sie glaubten, dass jedes Objekt in der großen weiten Welt ein eigenes Leben und eine Seele besitzt. Einige dieser Wesen führten vorbildliche Existenzen, andere waren Tunichtgute und Verschwender. Einige besaßen magische Fähigkeiten, konnten über die Sonne schweben, andere waren erdgebunden und konnten gefunden oder gefangen werden. Manchen war es sogar gegeben im Himmel und auf Erden, in beiden Sphären gleichzeitig sein. Diese mächtigen Wesen konnten die Leben der Menschen beeinflussen, sie schützen oder schädigen, sie belohnen oder bestrafen, je nach Verdienst und Laune.
Wie auch die australischen Ureinwohner überlieferten die Indianer ihre Urzeitlegenden mündlich. Sie erklärten die Entstehung der Welt, die Herkunft des Volkes und fixierten wünschenswerte Verhaltensmuster. So wird sogar noch aus neuerer Zeit unter den Zuniindianern die Geschichte von Hli’okwa erzählt, dem personifizierten Türkis, der Santa Domingo verließ, weil die Einwohner Türkise benutzten, um Prostituierte zu bezahlen.
Es gibt wohl hunderte von Märchen und Schöpfungsmythen um den Türkis. Nach der Erntezeit folgte bei den Navajo die Zeit der großen Winterzeremonien, bei denen sie in einer Serie von Gesängen ihre Schöpfungsgeschichte nacherzählten. Die Entstehungsgeschichte der Welt und die hilfreichen Mächte nicht zu vergessen, hatte für sie eine ähnlich profunde Bedeutung, wie für die australischen Aborigines. Auch hier spielen Tiere eine wichtige Rolle. Oft ist es die blaugrüne Eidechse, die zu Fundstellen von Türkis führt oder weiter südlich ein Papagei der geopferte Türkise verschluckt, um sie einem der Manitus zu bringen.
In der Schöpfungsgeschichte der Navajo gibt es vier Welten, eine über der anderen. In frühester Vorzeit gab es in der untersten Welt eine Überschwemmung (Sintflut?) und das Volk wurde von den Wassern nach oben in unsere Welt getrieben. Um sich zu retten, pflanzten sie ein hohles Schilfrohr, durch das sie die oberste Welt erreichen konnten. Erster Mann und Erste Frau brachten mit sich etwas Erde von den Bergen der Unterwelt und formten daraus die Berge im Navajo Land.
Im Osten erschufen sie den heiligen Berg Sisnajinni (Blanca Peak in Colorado), schmückten ihn mit weißen Muscheln und befestigten ihn mit einem Blitz am Boden. Dawn Youth und Dawn Maiden lebten von nun an hier.
Im Süden machten sie den Tsosichi (Mount Taylor in New Mexiko), auch Turquoise Mountain genannt. Diesen Berg schmückten sie mit Türkisen und befestigten ihn mit einem Steinmesser. Turquoise Youth und Turquoise Maiden siedelten an dieser Stelle.
Im Westen pflanzten sie den Doko-oslid (den höchsten der San Francisco Peaks in Arizona), ausgestattet mit Muscheln und von einem Mondstrahl an der Stelle gehalten. Muschel-Mädchen und Mondlicht-Junge lebten hier.
In den Norden setzten sie Dipenitsa (Hesperus Peak in Kalifornien), den sie mit schwarzem Jet verzierten und mit einem Regenbogen auf der Oberwelt befestigten. Jet Youth und Darkness-Maiden fanden dort ihre Heimat.
In der Mitte formten sie Tsichnaodiubli, der mit gestreiftem Achat dekoriert wurde. Hier erschufen sie den ersten Navajo und schenkten ihm einen Türkis-Hogan (Hogan = das halb in der Erde stehende, runde Navajo Haus). Als Sonne machten sie ein flaches rundes Objekt aus einem klarem Stein (Bergkristall?) und fassten ihn mit Türkisen ein.
Auch die Zuni kennen eine Oberwelt und eine Unterwelt. In der Himmelswelt der Zuni-Mythologie steht ein tiefblauer Berg aus Türkis, dessen Widerschein unserem Himmel die blaue Farbe verleiht. In dieser Himmelswelt leben viele interessante Charaktere, zum Beispiel Bär, der seinen Buckel bekam, weil er versehentlich von einem großen Türkis getroffen wurde, den Älterer Kriegsgott, offenbar in einem Anfall übler Laune, geworfen hatte.
Da gibt es Salt-Old-Woman, She-Who-Changeth und ihren Geliebten Johano-ai, Beautiful Flowers, Morning Green und bei den Zia einen Spielergott namens Po’shanjanice. Sie alle haben unendliche Mengen von Türkisschmuck, Türkis-Spielzeug, Türkisschalen, -häusern und so fort, so dass man sich vorstellen kann, welchen Prestigewert der Besitz dieses Steins für die Indianer dieser Region hatte und wahrscheinlich noch hat. Kein Ritual kam ohne ihn aus. Ein Indianer ohne Türkis war nackt und verachtenswert.
Die Yavapati meinen, ‘Mana’ residiere im Türkis, so etwas wie das personifizierte Glück im Sinne des chinesischen joss, also etwas, das unbedingt nötig ist, um alle seine Unternehmungen zu einem glücklichen Ende zu bringen.
Die Hopi kennen einen Liebeszauber, zu dem ein Medizin-Bündel zusammengestellt wird aus Teilen von der Kleidung der Frau, die becirct werden soll, einem Türkis, einer Muschel, einem Bergkristall und einem Pferdehaar. Es ist unbedingt erforderlich, dass, wenn alles zusammengewickelt ist, das Pferdehaar oben ein Stück weit herausschaut... Man hatte dann das Bündel vor sich zu halten und es zu besingen, woraufhin die Begehrte in Wallung geraten musste und unfehlbar zum Haus des Verliebten kam. Eine Bedingung gab es allerdings, die eingehalten werden musste – und das zeigt die moralischen Vorstellungen der Hopi: Das Ganze hatte unter allen Umständen geheim gehalten zu werden. Keine Macho-Prahlerei. Der Kavalier genießt und schweigt.
Türkise wurden als Gastgeschenke, Wiedergutmachung und bei der Beendigung von Feindseligkeiten gegeben und mit den Toten begraben. Die Navajo hatten eine solche Furcht vor ihren Toten, dass niemand es gewagt hätte auch nur einen Stein aus dem Schmuck zu entfernen, den der oder die Tote bei ihrem Hinscheiden trug. Alles wurde mit ihr zusammen beerdigt. Das bekamen natürlich weiße Grabräuber schnell heraus und so wurden viele alte Gräber wegen des Schmucks geplündert und die Toten entweiht.
Gern wird ja der ‘edle Wilde Amerikas’ zitiert mit den Worten: “ Du verlangst, dass ich die Erde umpflüge! Soll ich etwa ein Messer nehmen und die Brust meiner Mutter zerfleischen? Wenn ich dann sterbe, wird sie mich nicht an ihren Busen zurücknehmen, wo ich ruhen kann.
Du verlangst, dass ich nach Steinen grabe? Soll ich etwa unter ihrer Haut nach ihren Knochen wühlen? Dann, wenn ich sterbe, kann ich nicht in ihren Leib aufgenommen werden, um wiedergeboren zu werden.”
Für einige Stämme Nordamerikas mag das ja zugetroffen haben, die Indianer im Südwesten des amerikanischen Kontinents hatten da keinerlei Bedenken. Im Gegenteil: Die Götter hatten ihnen den Türkis geschenkt und es gab keine Erde-Mutter-Parallele, die den Bergbau verhindert hätte.
Die prähistorischen Indianer durchstreiften das Land mit offenen Augen für alles Brauchbare. Da mag der Eine oder Andere von ihnen auch nach einem Regen auf ein Stück Stein gestoßen sein, ausgewittert aus dem Fels oder in einem Bach fortgetragen, das ihm vorkommen musste, wie ein Stück Himmel oder ein Tropfen grünlichen Wassers, ein kleines Wunder inmitten dieser rotverbrannten Landschaft voller glühender Felsen, Kakteen, brauner Stachelgräser und hartschaliger, schattenloser Joshua Bäume Das konnte nur ein gutes Omen sein, das Geschenk eines wohlwollenden höheren Wesens, eine große Kostbarkeit. Später stießen diese Steinzeitmenschen vielleicht auf eine offenliegende Ader, aus der die blau-grünen Tropfen mit steinernen Faustkeilen herausgelöst werden konnten. Die glücklichen Finder solcher Himmelssteine zeigten sie stolz herum; andere wollten auch so etwas besitzen.
Die ersten Türkisminen waren Tagebaue. Das Graben in einem Fels schuf vielleicht einen Überhang und man entdeckte, genau wie die Feuersteinsucher in Europa, dass es die umgebende harte Matrix aufschloss, wenn man unter so einem Überhang ein Feuer entfachte, insbesondere bei oder vor einem kalten Regenguss.
Auch hier führte Wunsch und Notwendigkeit zur Entwicklung geeigneter Werkzeuge: Steinhämmer, Keile, Picken aus Elchhorn, Knochen und feuergehärtetem Holz wurden nach und nach erdacht, sowie Bohrer mit Quarzspitzen, mit denen die Türkise durchlöchert wurden, so dass man sie an Lederbändern aufreihen konnte. Die ersten Schmuckstücke waren sicher einzelne oder in Ketten aufgereihte, unregelmäßige Steine, später stellte man Perlen daraus her, entdeckte Steinschneidekunst, Schliff und besonders die Kunst der Einlegearbeit, deren Meister die Mayas waren. Um die Steine auf ihren Untergrund zu leimen, benutzten die Mayas Rattendreck, während die Indianer weiter nördlich Gummi und Pinienharz verwendeten. Die Motive der Mosaike und die geschnittenen Steine symbolisieren immer wieder das Grundbedürfnis der Indianer nach Wasser: Frösche, Wasservögel und Schildkröten.
Die meisten alten Türkisminen waren nichts weiter als Untertassen-förmige Tagebaue, aber es gab auch Minenschäfte, ja ganze unterirdische Räume, von Menschenhand ausgehöhlt und sogar mit Holz abgestützt. Um von einem Level zum anderen zu gelangen, benutzten die Indianer dieselbe Art von Hühnerleiter, die auch in den Felspueblos üblich waren.
Da der Transport von Rohsteinen mitsamt der Matrix mühselig war, wurden die Steine meist an Ort und Stelle zu einem gewissen Grad bearbeitet. Archäologen haben neben manchen prähistorischen Minen die Überbleibsel von Gebäuden gefunden, die wahrscheinlich Werkstätten waren. Man entdeckte auch, dass sich Glanz und Farbe des Steins künstlich verbessern ließen, indem man ihn mit Talg einrieb und polierte. Wollte man ein Stück zum Tauschhandel verwenden, so wurde es oft im Mund getragen, weil Feuchtigkeit das Erscheinungsbild verbessert.
Hatte ein Stamm einen reichen Fundort entdeckt, so bemühte man sich selbstredend, ihn solange wie möglich geheim zu halten. Aber dann setzte ein ‘Goldrausch’ ein. Der Türkis war ein heiliges Gut. Gruppen von anderen Stämmen musste das Schürfen gestattet werden. Indianer aus Gebieten, die nicht über Türkisstätten verfügten, haben regelmäßig weite Pilgerfahrten zu den Turquoise-Mountains unternommen. Die Besucher waren sicher nicht gerade willkommen, aber vor Ort herrschte eine Art Schürf-Frieden, den alle respektierten. Eine ganz andere Frage war es dann, ob man mit dem Gewinn heil nach Hause kam.
Im Gebiet der Shoshonen machten weiße Archäologen unserer Tage einen grausigen Fund: Massen von Menschenknochen, offenbar waren sie alle an dieser Stelle eines gewaltsamen Todes gestorben, Knochen waren gebrochen, Schädel zertrümmert, Pfeilspitzen lagen noch zwischen den gebleichten Rippen. Die Machart der Stoffe und Gegenstände, die bei den Skeletten erhalten geblieben waren, suggerierte, dass es sich um eine unglückliche Gruppe von Hopis gehandelt haben muss, die auf dem Heimweg von Shoshonen massakriert wurden.
Einige Minen wurden, nachdem sie soweit wie möglich ausgebeutet waren, einfach verlassen. Andere wurden wieder aufgefüllt, eine mühselige Arbeit. Ob das getan wurde, um den Fundort geheim zu halten, oder vielleicht doch um die Natur zu heilen und zu versöhnen, lässt sich heute nicht mehr feststellen.
Als die Spanier Mexiko unterworfen und reichbeladene Schiffe in ihre Heimat geschickt hatten, richtete sich ihr gieriger Blick nach Norden.
1536 tauchte ein halbverhungerter, völlig abgerissener Abenteurer in Ténochtitlan auf (Mexiko-Stadt ), ein gewisser Alvar Nunez Cabeza de Vaca. In seiner Begleitung war ein schwarzer Sklave mit Namen Estevan. Acht Jahre lang hatten sie sich durch Dschungel, Fels und Halbwüsten nach Florida gekämpft von Stamm zu Stamm. Manchmal gelang es ihnen, sich als Abgesandte von Göttern auszugeben und die Gastfreundschaft der Indianer zu genießen, manchmal trieben sie Handel und einige Male mussten sie monatelang Sklavenarbeit verrichten, um sich am Leben zu erhalten.
De Vaca war ein gewaltiger Aufschneider und Märchenerzähler. Die Reichtümer der westlichen Indianerstämme müssen bei jedem neuen Vortrag angeschwollen sein, bis der Vizekönig selbst, Don Antonio de Mendoza den Abenteurer an seinen Hof bringen ließ, um den Bericht mit eigenen Ohren zu hören. Und wieder schmückte de Vaca die Erzählung aus. So wurden mit der Zeit aus ein paar Zuni-Dörfern die Sieben Goldenen Städte von Cibola. Niemanden störte es offenbar, dass de Vaca für all seine Mühen nichts vorzuweisen hatte außer einer Handvoll von Türkisen. Er zeigte auch überhaupt kein Verlangen danach, die Reise zu wiederholen. Also schickte ihn Mendoza mit der nächsten Galeone nach Spanien, um seine Geschichte Karl V. zu erzählen.
Der Mohr Estevan dagegen, der als ‘Abgesandter von Göttern’ ein vergleichsweise gutes Leben geführt hatte, ließ sich gern einer Expedition von Fray Marcos de Niza als Übersetzer und Scout zuteilen. Und so wurde Estevan der Gruppe jeweils ein paar Tagereisen vorweg geschickt, mit dem Auftrag, durch indianische Kuriere Nachrichten zurückzuschicken. Waren die zu erwartenden Gewinne mittelmäßig, so sollte er dem Indianer ein Kreuz in Handteller-Größe mitgeben mit entsprechender Steigerung. Man kann sich denken, dass die Zeichen, die Estvan sandte, mehr als optimistisch waren. Weiter und weiter lockte er die spanische Truppe.
Inzwischen ließ sich Estvan überall feierlich empfangen und mit Türkisen und Frauen beschenken. Natürlich waren die Spanier an Türkisen nur mäßig interessiert. Was sie suchten, waren Gold, allenfalls Silber und Smaragde. Dennoch: Türkise waren besser als nichts und wurden eingesackt.
Als Estevan bei Cibola ankam, hatte sich wohl die Kunde von den grausamen Göttern schon verbreitet. Götter gaben normalerweise Geschenke und verlangten keine. Außerdem fanden die Zuni es ausgesprochen unglaubwürdig, dass ein schwarzer Mann behauptete, er sei der Vorbote von weißen Göttern. Und als er schließlich unverschämt wurde und Geschenke von Türkis und Frauen verlangte, da sperrten ihn die Zuni kurzerhand außerhalb der Stadtmauern in einen Käfig. Seine angesammelte Beute wurde konfisziert, er selbst und seine Begleiter bei einem Fluchtversuch getötet.
Als die spanische Expedition dann Cibola erreichte, müssen sie sehr enttäuscht gewesen sein: Zwar waren die Einwohner gut genährt und gekleidet, aber von Gold keine Spur. Man gab ihnen einige Türkise, aber die besten Stücke waren vor der Ankunft dieser gierigen Götter versteckt worden.
Auch Fray de Niza verheimlichte dem Vizekönig das Desaster. Der sandte noch eine weitere Expedition nach. Als dann das ganze Ausmaß von Lügen und Prahlerei offenbar wurde, schickte man Fray de Niza in Unehren nach Spanien. So brachte die Prahlerei von drei Männern den Indianern Krieg, Tod und Sklaverei. Nach all dem Aufwand wollte man nun doch etwas davon haben. Truppen wurden losgeschickt, um die Dörfer zu plündern, egal, was es brachte. Irgendwas würde schon dabei heraus kommen.
Der Berichterstatter Pedro Castaneda schrieb1541: “ Sie schenkten uns einige gegerbte Häute und eine Menge Piniennüsse, Mais und einheimisches Geflügel. Später brachten sie noch ein paar Türkise, aber nicht viele.” Die besten und feinsten Stücke wurden nach Spanien gesandt. Einige befinden sich heute noch bei den Kronjuwelen. Aber eigentlich hatte der Stein für die Konquistadoren nur eine Bedeutung: Symbol für die Hoffnung auf größere Schätze, denen sie unentwegt nachjagten.
Mit der Versklavung der Indianer durch Spanien versiegte der Türkisabbau. Viele der alten Minen wurden vergessen. Nur noch heimlich und an der Oberfläche suchten die Indianer von Zeit zu Zeit nach dem ihnen so wichtigen Stein. Mitte des 19 Jh. begannen weiße Siedler und Eroberer erneut, das Land nach Bodenschätzen abzusuchen und die Minen wieder in Betrieb zu nehmen. Weit davon entfernt, irgendwelche Stämme um Erlaubnis zu fragen, wurde Türkis nun mit Hilfe von Sprengstoff und Dampfhämmern aus der Matrix gebrochen, eine Vorgehensweise, die tatsächlich an die vielbeschworene Vergewaltigung der Natur denken lässt. Effektivität war eben das neue Credo, materieller Reichtum Lebensziel und einziger Maßstab. Die Bezahlung der Minenarbeiter variierte nach Rassenzugehörigkeit: Mexikaner erhielten 1,50 Dollar am Tag, weiße Amerikaner 2,50 Dollar. Die gesäuberten und sortierten Steine wurden in hölzerne Kisten verpackt und nach New York geschafft. In den Cerillo-Minen konnten sieben bis zehn Männer am Tag Türkise im (damaligen) Wert von acht bis zehntausend Dollar fördern.
Wie schockierend und fremdartig mussten diese Weißen den Indianer vorkommen, deren Gott das Geld war, da doch all ihre eigenen Mythen, Regeln und Gesetze auf die Erhaltung der Gemeinschaft und die Harmonie mit der Natur abzielten. Nicht dass die Indianer bessere Menschen gewesen wären; ihre Werte unterschieden sich einfach grundsätzlich von denen der Neuankömmlinge auf ihrem Kontinent.
Archäologen und Völkerkundler hatten oft Schwierigkeiten, die alten Minen mit ihren Ruinen und dem überall herumliegenden steinzeitlichen Werkzeug zu besichtigen. Die neuen Eigner hüteten ihre Claims eifersüchtig und viele erlaubten weder das Anfertigen von Skizzen noch von Fotografien. Aber einige der Relikte gelangten doch in den Besitz von Museen und wissenschaftlichen Gesellschaften.
Ob friedlich oder kriegerisch, die Begegnung mit den Weißen veränderte die Kultur der Indianer und ihr ästhetisches Empfinden. Vor der Eroberung durch die Spanier war die Metallverarbeitung den Indianern unbekannt – einer von mehreren Faktoren, der gegen sie arbeitete. Wenn man heute von ‘indianischem Türkisschmuck’ spricht, so ist eigentlich ‘Silber und Türkis’ gemeint. Es heißt, dass die ersten metallischen Schmuckfassungen aus mexikanischen Silbermünzen gefertigt wurden. Eine zweifelhafte Angelegenheit: Bestechung, um den Zusammenhalt der Stammesgemeinschaften zu zerstören war so üblich in jenen Tagen, dass der Besitz von mexikanischen Pesos als Judaszeichen betrachtet wurde, besser also, sie schnell umzuarbeiten. Viele Münzen wechselten allerdings auch durch Diebereien und Überfälle den Besitzer. Und daraus hat sich nun die Tradition indianischen Türkis-und-Silber-Schmucks ergeben. Die Navajos lernten das Schmiedehandwerk von mexikanischen Indios; andere Stämme lernten von den Navajos.
1863 bekam Kid Carson von der US-Arme den Auftrag, die Navajos zusammenzutreiben und sie einzusperren, um ihren Widerstand zu brechen. Man ließ sie 360 Meilen marschieren bis Fort Sumner in Neu Mexiko. Manche behaupten, sie hätten das Schmiedehandwerk dort gelernt, andere sagen, das wäre ganz unmöglich gewesen, weil sie dort zusammengepfercht existieren mussten, schlimmer als Vieh und keine Werkstätten zu ihrer Verfügung hatten.
Als sie 1868 endlich ‘freigelassen’ wurden, eine sehr begrenzte Freiheit, da war das Reservats-System installiert und mit ihm die Handelsposten. Von da an beeinflussten die Wünsche und Vorstellungen der Händler und ihrer Kundschaft in den weit entfernten Städten des Nordens das indianische Kunsthandwerk – zum Guten oder zum Schlechten.
Als dann die Eisenbahnen den Westen erschlossen, kamen Touristen und sie wollten damals wie heute etwas Indianisches kaufen, um es zu Hause vorzeigen zu können. Was für sie hergestellt wurde, war minderwertiges Zeug, sowohl in Material, als auch im Geschmack den Erwartungen der weißen Kundschaft angepasst. Um den Preis niedrig zu halten, wurde Silber nicht massiv verarbeitet, wie es besonders die Navajos liebten, sondern dünn und hohl gestanzt und gepresst. Auf Wunsch der Unternehmer wurde es mit allen möglichen und unmöglichen ‘Zauberzeichen’ versehen, darunter sogar Hakenkreuze. Chester Yellowhair, einer der berühmten indianischen Schmiede, sagte darüber verächtlich: “Das Silber sah aus wie Hühnergekrakel.” Aber es war das, was die Käufer wollten. Manchmal wurde ein Stück Papier dazu geliefert, das auf die ‘tiefe religiöse Bedeutung’ dieses Schmucks und der Symbole für die Indianer hinwies. Erst in den 1940igern wurden indianische Kunsthandwerkschulen und eigene Handelsgesellschaften gegründet, darunter die wichtigste 1941: Die Navajo Arts and Crafts Guild. Heute kann man sowohl billigen Tand als auch Türkisschmuck von hoher Qualität kaufen und die Preise für beides sind angemessen.
Eine merkwürdige Einrichtung gab es in Zusammenhang mit Türkis: Das Pfandleihsystem. Wenn ein Reservats Indianer eine gewisse Zeitlang kein Einkommen hatte, und das war oft, dann war er dennoch auf Lebensmittel, Tabak und andere geringe Wirtschaftsgüter aus der Handelsstation angewiesen, auf Baumwolle, Kaffee, Färbemittel und Rohstoffe zur Herstellung von Teppichen oder Schmuck. Und so versetzte er dafür einfach einen Teil seines Türkisschmucks. Das waren teilweise prachtvolle und sehr alte Stücke und sie wurden in einem eigenen Raum der Station ausgestellt, dem Pfandraum. Bekam der Indianer dann wieder etwas Geld in die Hand, nach der Schafsschur, oder wenn er eine Saisonarbeit gefunden hatte, dann war das erste, was er tat, in den Laden zu gehen und seine ‘Familienjuwelen’ auszulösen. Dieser Prozess konnte sich viele Male wiederholen. Es soll auch verständnisvolle Händler geben haben, die den verpfändeten Schmuck für bestimmte Rituale und Tänze ihrerseits dem Besitzer liehen, damit er in vollem Ornat teilnehmen konnte.
Man sollte annehmen, dass Händler solche guten Stücke an reiche Touristen weiterverkauften, wenn man ihnen nur genug bot. Aber das ist nie geschehen. Der Händler benötigte schließlich das Vertrauen seiner indianischen Kundschaft so sehr, wie sie ihn. Und die Ausstellungen im Pawnroom haben solche Läden sicher auch für weiße Reisende anziehend gemacht. Heute haben sich die Verhältnisse wieder einmal geändert. Ein Indianer, der dem Händler bekannt ist, bekommt seinen Kredit auch ohne Pfand. Wenn sie dennoch ihren Schmuck in den Laden bringen, dann mehr um sich vor Verlust zu schützen. Sie benutzen den Kaufmannsladen als Banktresor.