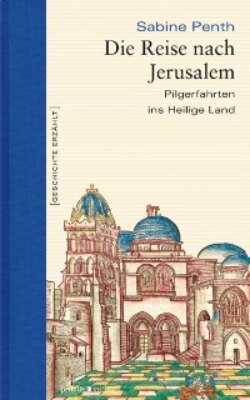Читать книгу Die Reise nach Jerusalem - Sabine Penth - Страница 7
Heil, das abfärbt: Von heiligen Orten und ihrer Wirkmächtigkeit
ОглавлениеUralt ist die Vorstellung von der besonderen Wirkmächtigkeit bestimmter Plätze, von der Existenz heiliger Orte. Sie findet sich schon in den frühesten Religionen der Menschheitsgeschichte. Nachdem die frühe Christenheit solche Ideen fast drei Jahrhunderte lang als heidnisch abgelehnt hatte, brachen sie sich seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts nun im christlichen Gewand immer machtvoller Bahn.
Dabei unterscheidet sich das christliche Konzept heiliger Orte ganz entscheidend von dem der älteren heidnischen Religionen: Ein Platz ist nicht heilig aus sich heraus, aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit oder besonderer Eigenschaften, seine Heiligkeit ist vielmehr eine abgeleitete: Heilig wird ein Ort erst durch das, was einst an ihm geschah, und durch das fromme Gedenken der Gläubigen an diese Ereignisse in Gottesdienst und Gebet. Heilig sind solche Orte, an denen das Handeln Gottes in der Welt sichtbar wurde – sei es durch das Leben, Sterben und Auferstehen seines Sohnes in Palästina, sei es durch das Zeugnis, das Heilige und Märtyrer mit ihrem Leben und Sterben für ihn und ihren Glauben ablegten.
Der jungen Kirche waren solche Ideen noch weitgehend fremd. Sie lebte völlig in der sogenannten Naherwartung, d. h., sie rechnete täglich mit der Wiederkehr Christi zum Jüngsten Gericht und mit dem Ende der Zeiten. Außerdem war Jesus nach seiner Auferstehung an keinen irdischen Ort mehr gebunden – und Gottes Gegenwart war ohnehin universell.
Im Leben und Gottesdienst der christlichen Gemeinde spielte die Erinnerung an die Ereignisse der Heilsgeschichte, wie sie im Alten und Neuen Testament geschildert wurden, und insbesondere an das Erlösungswerk Christi eine zentrale Rolle. Je mehr Zeit ins Land ging, ohne die erwartete und erhoffte Wiederkunft des Auferstandenen zu bringen, desto wichtiger wurde diese kollektive Erinnerung. In der Liturgie einzelner Feiertage im Jahreskreis gedachte man bestimmter Ereignisse aus dem Leben und Wirken Jesu. Dazu kamen mit der Zeit weitere Anlässe zum Gedächtnis: Heilige und Märtyrer aus der Zeit der Christenverfolgung sollten nicht in Vergessenheit geraten und den Christen mit ihrem Glaubenseifer und ihrem mutigen Zeugnis als leuchtende Beispiele vor Augen gestellt werden.
Je weiter man sich von den Anfängen entfernte und je größere geographische Ausbreitung das Christentum fand, desto verbreiteter wurde die Sehnsucht unter den Gläubigen, nicht nur die biblischen Erzählungen und die Heiligenviten zu hören, sondern die Schauplätze dieser Ereignisse auch einmal mit eigenen Augen sehen zu können. „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“, hatte Jesus den ungläubigen Apostel Thomas getadelt, als dieser handgreifliche Beweise für die Realität seiner Auferstehung und Gegenwart verlangte (Joh 20,29). Doch diese Mahnung vermochte wenig gegen den Wunsch vieler Christen, Jesus und den Heiligen auch räumlich nahe zu kommen, indem sie die Stätten ihres irdischen Lebens besuchten.
Nicht zuletzt versprach man sich von Reisen an diese Plätze Heil für Seele und Leib. Die Heiligen, die man aufsuchte, sollten als Mittler dienen und Fürsprache bei Gott für den Pilger einlegen – natürlich für dessen Seelenheil, aber auch durchaus in eher weltlichen Anliegen wie etwa der Heilung von einer Krankheit. Nicht von ungefähr häufen sich denn auch Berichte von Wundern, die sich an den Gräbern von Heiligen ereigneten und damit die Gottesnähe und Heiligkeit der dort Bestatteten unter Beweis stellten. Von den biblischen Stätten im Orient gibt es hingegen kaum solche Berichte, zumal es an deren Heiligung durch die leibliche Gegenwart des Gottessohnes keine Zweifel geben konnte.
Bei Reisen ins Heilige Land standen außerdem eher Kontemplation und Gebet im Mittelpunkt und damit die Mehrung des Seelenheils. Dieser Intention leistete die Kirche seit dem Hochmittelalter noch Vorschub, indem sie für den Besuch bestimmter Plätze und die Ableistung genau vorgeschriebener Gebete und Frömmigkeitsübungen an diesen Stätten Ablässe, also den Nachlass zeitlicher Sündenstrafen, in Aussicht stellte. Dies führte letztendlich dazu, dass einfache Pilger im späten Mittelalter oft gezielt nur noch dorthin gingen, wo ein Ablass zu erhalten war. So schreibt etwa der Konstanzer Ritter Konrad Grünemberg über seine Heilig-Land-Wallfahrt im Jahre 1487, dass die Führer seiner Reisegruppe die Pilger beim Rückweg von Bethlehem nach Jerusalem auf das abseits gelegene, schon verfallene Kloster St. Saba aufmerksam machten. Doch „daselbst ist gar kein Ablaß, darum es die Pilger auch nicht aufsuchen“, kommentiert er lakonisch.1
Auch den besuchten Orten selber schrieb – und schreibt – man außergewöhnliche Kräfte zu. Sie seien gleichsam von der Heiligkeit des einst dort Geschehenen durchdrungen, und auf den frommen Besucher könne quasi etwas von dieser Heiligkeit abfärben, so die verbreitete Vorstellung.
Gabe aus dem Gnadenschatz der Kirche: Der Ablass
Im 13. Jahrhundert entstand die Lehre vom „Gnadenschatz der Kirche“, den Christus, die Märtyrer und Heiligen durch ihr gottgefälliges Leben, ihr Leiden und Sterben angesammelt hatten. Über diesen Schatz konnte der Papst nach Gutdünken verfügen und daraus Gaben an reuige Sünder verteilen – die Ablässe. Dabei ging es zunächst um den Erlass von Strafen, die Sündern von der Kirche als Buße auferlegt worden waren, später bezog man auch die jenseitigen Strafen ein, die der Mensch im Fegefeuer zu erwarten hatte. Echte Reue sowie Leistungen in Form etwa von Almosen, Gebeten oder dem Besuch bestimmter Pilgerstätten waren die Voraussetzung für die Gewährung solcher Ablässe.
Das an den Wallfahrtsstätten erfahrene Heil blieb also nicht räumlich begrenzt, es konnte sozusagen mitgenommen werden und über den Besuch hinaus im Leben der Pilger Wirkung entfalten. – Die Idee des heiligen Ortes war auch im Christentum angekommen.
Heil zum Mitnehmen: Reliquien
Die gesamte christliche Welt wurde nach und nach mit einem Netz solcher heiliger Stätten überzogen – etwa Orte, an denen Heilige lebten, wirkten, starben oder begraben wurden. Zunächst galten die Körper der Heiligen noch als unverletzlich, doch seit dem Hochmittelalter verlor man diese Scheu und begann, einzelne Körperteile von der ursprünglichen Grabstätte zu entfernen. Als Reliquien wurden z. B. Arme, Beine, Hände, Finger, Kopf oder Zähne an Klöster, Domkirchen oder bedeutende Adlige verschenkt, um diesen eine besondere Ehre zu erweisen. Damit aber wuchs die Zahl der möglichen Wallfahrtsstätten immer stärker an.
Die wichtigsten Pilgerziele im Abendland waren Rom als das Zentrum der christlichen Welt und Santiago de Compostela mit dem Grab des Apostels Jakobus im äußersten Westen. Von überragender Bedeutung blieben jedoch stets Jerusalem und das Heilige Land, wo Jesus gelebt und gewirkt hatte. Als Schauplatz von Leiden, Tod und Auferstehung Christi musste Jerusalem, das man als Mittelpunkt und Nabel der Welt betrachtete, sämtliche anderen Wallfahrtsorte weit in den Schatten stellen.
Für die meisten Pilger war eine Wallfahrt, zumal zu einem der weit entfernten, berühmten Pilgerziele, aufgrund der Kosten und Gefahren ein einmaliges Erlebnis. So ist es nur zu verständlich, dass sie den Wunsch hegten, die dort gemachte Heilserfahrung zu perpetuieren und auch den zuhause gebliebenen Angehörigen einen Anteil daran zu verschaffen. Dies sollte nach Meinung der Volksfrömmigkeit, aber auch vieler Theologen, durch die Mitnahme von Reliquien ermöglicht werden. In deren Gestalt glaubten die Pilger, ein Stück des heiligen Ortes, ja seine Heiligkeit selbst, mit nach Hause bringen zu können. Doch Körperreliquien lagen außerhalb der Reichweite einfacher Pilger; für sie kamen eher die sogenannten Kontaktreliquien infrage, wie etwa Kleidung, Schmuck oder Gebrauchsgegenstände, die der Heilige in seinem Leben benutzt hatte, aber auch Materialien, die nach seinem Tod mit dem Leichnam oder mit dem Sarg in Berührung kamen.
Im Heiligen Land waren die Herrenreliquien besonders begehrt, d. h. Reliquien, die in direkter Beziehung zu Christus standen. Besondere Verehrung genoss das „wahre Kreuz“, das die Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins des Großen, der Legende nach im Jahr 326 unter einem Venustempel der römischen Kolonie Aelia Capitolina – wie Jerusalem nach der Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes im Jahr 135 durch Kaiser Hadrian genannt wurde – ausgegraben hatte. Ein Teil dieser als Kreuz Christi hoch geehrten Reliquie befand sich in Konstantinopel, der andere Teil wurde in der Grabeskirche in Jerusalem aufbewahrt und den Gläubigen gezeigt.
Dieser Jerusalemer Teil des „wahren Kreuzes“ hatte eine sehr wechselvolle Geschichte. Die persischen Sassaniden erbeuteten 614 die Reliquie, als sie Jerusalem eroberten; erst der byzantinische Kaiser Herakleios konnte die Perser 628/629 zurückschlagen und das Kreuz im Rahmen eines Friedensvertrags zusammen mit den verlorenen Gebieten wiedergewinnen. In feierlichem Triumph kehrte der siegreiche Kaiser am 14. September – dem Tag der „Kreuzerhöhung“, an dem die Kirche damals die Auffindung des Kreuzes durch Helena feierte2 – mit der wertvollen Reliquie nach Konstantinopel zurück und zog in die Hagia Sophia ein, wo sie in einem Dankgottesdienst vor dem Hochaltar aufgerichtet wurde. Herakleios persönlich brachte das Heilige Kreuz im Jahr darauf wieder nach Jerusalem.
In den folgenden Jahrhunderten erfahren wir nichts mehr über die Jerusalemer Kreuzesreliquie. Erst mit der Eroberung der Heiligen Stadt durch die Kreuzfahrer am 15. Juli 1099 tritt sie erneut ins Licht der Geschichte. Einen Monat danach berichten Quellen, die christlichen Ritter hätten das Heilige Kreuz wiedergefunden, das nun zur bedeutendsten Reliquie des von den Kreuzfahrern errichteten Königreichs Jerusalem wurde. Als besonderen Gunsterweis verschenkte der König von Jerusalem kleine Partikel des Kreuzesholzes, gefasst in wertvolle Reliquiare, die man Staurotheken (von griech. staurós = Kreuz und théka = Behälter) nannte, an europäische Könige, Adlige oder Geistliche. Diese Reliquien wurden in ganz Europa hoch verehrt. Eine zweite Quelle für solche Kreuzesreliquien war der Teil des „wahren Kreuzes“, der in Konstantinopel aufbewahrt wurde. Außerdem führte man das Heilige Kreuz in allen wichtigen Schlachten mit sich, um sich damit des göttlichen Schutzes zu vergewissern – bis es schließlich bei der vernichtenden Niederlage der Kreuzfahrer gegen Sultan Saladin in der Schlacht von Hattin 1187 in die Hand der Muslime fiel und seither verschwunden blieb.
Als ähnlich kostbar galten auch die Heilig-Blut-Reliquien. Dabei handelte es sich meist um Erde, die angeblich bei der Passion mit dem Blut Christi getränkt worden war und die man in wertvollen Reliquiaren aufbewahrte. Weithin berühmt ist etwa die Heilig-Blut-Reliquie der oberschwäbischen Benediktinerabtei Weingarten, die noch heute von den Gläubigen verehrt und jährlich beim sogenannten Blutritt in einer feierlichen Reiterprozession segnend durch die Straßen, Felder und Fluren getragen wird.
Eine zweite Form von Blutreliquien kam im Mittelalter hinzu. An den verschiedensten Orten sollen sich damals Blutwunder ereignet haben: Zahlreiche Legenden erzählen, dass Hostien und Kruzifixe zu bluten begannen, weil Juden oder Heiden sie quälten, mit Messern oder Lanzen durchbohrten, um damit das Leiden und Sterben Christi zu parodieren. Aus Beirut etwa wurde berichtet, dass die dortigen Juden Christus verspotten wollten, indem sie an einem Christusbild seine Passion nachahmten, doch beim Lanzenstoß flossen tatsächlich Blut und Wasser aus seiner Seite. Mit diesem Blut salbten die Juden viele Kranke, die dadurch geheilt wurden, woraufhin sich alle Beiruter Juden zum Christentum bekehrten, so die Legende.3 Die bei diesem und ähnlichen Wundern angeblich aufgefangene Flüssigkeit galt ebenfalls als Blut Christi und wurde als Heilig-Blut-Reliquie verehrt.
„Davon nahmen wir Segen mit“: Kontaktreliquien aus dem Heiligen Land
Für einfache Heilig-Land-Pilger allerdings blieben diese wertvollen Herrenreliquien weitgehend unerreichbar. Sie brachten eher Berührungsreliquien von ihrer Wallfahrt mit, die wesentlich erschwinglicher waren, weil man sie fast in beliebiger Menge herstellen konnte. Die Tatsache, dass Palästina das Land war, in dem Jesus gelebt und gewirkt hatte, wo – wie es im Psalm hieß – „seine Füße standen“,4 machte gleichsam aus dem ganzen Land, aus jeder Stätte, die er einmal aufgesucht hatte, heiligen Boden. Jedes Sandkorn, jeder Tropfen Jordanwasser konnte als Kontaktreliquie gelten. Für den Jordan erklärt dies Jacques de Vitry, seit 1216 Bischof von Akkon, folgendermaßen:
Die Pilger und die Einheimischen waschen üblicherweise ihren Körper und ihre Kleider mit großer Andacht im Wasser des Jordan. Denn als unser Erlöser vom heiligen Johannes in diesem Gewässer getauft wurde, hat er den Strom durch die Berührung mit seinem reinsten Körper geheiligt und dem ganzen Wasser die Kraft der Taufe gegeben. Die gesamte Dreifaltigkeit hat diesen glücklichen und würdigsten Fluss geweiht: Über ihm hat man den Vater gehört und den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube gesehen, in ihm wurde der Sohn in menschlicher Gestalt getauft.5
So schöpften die Pilger denn auch an der Taufstelle Jesu Wasser aus dem Jordan, das sie in – oft mit orientalischen Motiven geschmückten – Fläschchen mit nach Hause nehmen konnten.
Auch Erde aus dem Heiligen Land war ein beliebtes Mitbringsel der Pilger. Noch heute sind kleine Schatullen erhalten, meist ebenfalls mit orientalischen Mustern oder arabischen Schriftzeichen verziert, in die man die Erde füllen konnte. Dabei musste es sich keineswegs nur um Christus-Reliquien handeln, auch Erde von bestimmten alttestamentlichen Stätten stand im Ruf, wundertätig zu sein.
Der Dominikaner Burchard de Monte Sion, der 1283 das Heilige Land bereiste, berichtet etwa über den sogenannten Damaszener Acker (Ager Damascenus) bei Hebron, aus dessen Lehm Gott einst Adam geschaffen haben soll:
Dieser Acker besteht in der Tat aus sehr roter Erde, die ganz geschmeidig ist, wie Wachs. Davon habe ich eine große Menge mitgenommen. Genauso machten es die anderen Pilger und Christen, die den Ort besuchten. Die Sarazenen bringen diese Erde außerdem mit Kamelen nach Ägypten, Äthiopien, Indien und sonst wohin, wo sie für sehr teure Gewürze eingetauscht wird. Trotzdem scheint der Graben dort klein zu sein. Man erzählt nämlich, dass er sich nach Ablauf eines Jahres, wie groß er auch sei, auf wunderbare Weise wieder füllt. Aber ich habe vergessen, der Wahrheit der Sache auf den Grund zu gehen. Ich sage das deshalb, weil der Graben, als ich dort war, so klein war, dass kaum vier Leute darin sitzen konnten, und er war nicht tiefer als bis zu meinen Schultern.
Man sagt, dass keinem, der diese Erde bei sich trägt, von einem lebenden Wesen Schaden zugefügt wird. Außerdem soll sie den Menschen vor Unglück bewahren.6
Die Schilderung Burchards zeigt dreierlei ganz deutlich: das ausgeprägte Bedürfnis der Pilger, etwas von dem heiligen Ort mitzunehmen, um damit die Heilserfahrung des Besuchs dauerhaft in den Alltag hinüberretten zu können, ihre teilweise geradezu kindlich-naiv anmutende Wundergläubigkeit – wenn auch schon bei Burchard selber Ansätze zu kritischem Hinterfragen zu erkennen sind – sowie die Geschäftstüchtigkeit der zur damaligen Zeit muslimischen Landesherren, die es verstanden, nicht nur vor Ort, sondern sogar noch in weit entfernten Gegenden den Lehm von einem allen drei abrahamitischen Religionen als heilig geltenden Ort in klingende Münze zu verwandeln.
„Heiliges Öl“ wurde gewonnen, indem man Gräber von Heiligen oder andere heilige Stätten mit Olivenöl übergoss und dieses anschließend in kleinen Fläschchen auffing. Der Kontakt zu dem jeweiligen Heiligen konnte sogar noch ein wesentlich engerer sein: In manche Sarkophage bohrte man an der Ober- und Unterseite Löcher und ließ Öl hindurchfließen, sodass es in direkte Berührung mit dem Leichnam kam. Aber auch mithilfe des Kreuzesholzes wurde Öl geweiht, wie der sogenannte Pilger von Piacenza um 570 über seinen Besuch der Grabeskirche berichtet: Zunächst einmal habe man das Kreuz aus seiner Kammer (gemeint ist wohl eine Seitenkapelle) zur Anbetung in das Hauptschiff der Kirche gebracht.
Zu dieser Stunde erschien ein Stern am Himmel und wanderte über den Ort, wo das Kreuz war. Und solange das Kreuz angebetet wurde, stand er über ihm. Und es wurde Öl in gewöhnlichen Flaschen zur Weihe dargebracht. Sobald das Holz des Kreuzes mit der Öffnung einer Flasche in Berührung kommt, wallt das Öl stark auf, und wenn sie nicht schnell verschlossen wird, fließt es ganz heraus.7
Das auf diese verschiedenen Arten hergestellte „heilige Öl“ wurde den Pilgern anschließend in kleinen Ampullen verkauft.
Auch wenn es dem modernen Betrachter auf den ersten Blick so scheinen mag – um Souvenirs im modernen Sinne handelte es sich bei all dem nicht. Es ging nicht um bloße Erinnerung, um ein „Weißt-du-noch?“ nach der Rückkehr in die Heimat. Vielmehr sollte das erfahrene Heil auch in der Zukunft weiterwirken, oder – wie es der Pilger von Piacenza formuliert: ex qua benedictionem tulimus – „davon nahmen wir Segen mit“.8