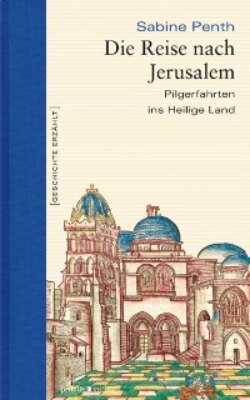Читать книгу Die Reise nach Jerusalem - Sabine Penth - Страница 8
Palästinareisen und Legenden: Der Wallfahrtsgedanke entsteht
ОглавлениеDie ersten Christen, die das Heilige Land etwa seit der zweiten Hälfte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts bereisten, waren noch keine Pilger im eigentlichen Sinne des Wortes. Es handelte sich offenkundig vornehmlich um Geistliche – meist Bischöfe – und Gelehrte aus Kleinasien und Ägypten, die eher aus einem fast schon wissenschaftlich zu nennenden Interesse heraus die Stätten der Bibel aufsuchten. In den Quellen finden sich nur spärliche Hinweise auf diese Reisenden, wenige sind auch namentlich bekannt.
Die Anfänge der christlichen Wallfahrt ins Heilige Land
Bischof Melito von Sardes ist der früheste unter ihnen; er unternahm in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts eine Reise nach Palästina. Eusebius von Caesarea zitiert in seiner etwa anderthalb Jahrhunderte später entstandenen Kirchengeschichte die Einleitung eines heute verlorenen Werkes von Melito, in dem dieser für einen gewissen Onesimus Auszüge aus den Büchern des Alten Testaments zusammenstellte. Da er, so erklärt Melito, „in den Orient gereist und an den Schauplatz der Predigten und Taten gekommen“ sei sowie „über die Bücher des Alten Testaments genaue Erkundigungen eingezogen habe“, könne er ihm nun den korrekten Kanon – also Anzahl und Reihenfolge – der alttestamentlichen Schriften nennen.1
Über die Reise des Bischofs Alexander von Kappadokien im ersten Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts hören wir ebenfalls in der Kirchengeschichte des Eusebius. Seine Erzählung mutet stark legendenhaft an: Demnach erhielt Alexander in einer nächtlichen Offenbarung den göttlichen Auftrag, künftig zusammen mit Narcissus das Bischofsamt von Jerusalem zu verwalten, da dieser aufgrund seines hohen Alters allein nicht mehr dazu imstande war. So sei Alexander „wegen des Gebets und der Stätten der Geschichte“ nach Jerusalem aufgebrochen. Die Einwohner der Stadt aber hätten ihn – ebenfalls aufgrund einer Offenbarung – nicht nur aufs freundlichste empfangen, sondern ihn anschließend gewaltsam an der Heimreise gehindert, da er ihr von Gott bestimmter Bischof sei.2
Der Presbyter Pionius aus Smyrna, der im Jahr 250 unter Kaiser Decius den Märtyrertod starb, soll in seiner Verteidigungsrede über seine Reise nach Judäa gesagt haben, er habe „das Land gesehen, das bis heute Zeugnis ablegt vom Zorn Gottes“. Was er mit eigenen Augen sah, führt er als Beweis für die Richtigkeit der christlichen Ansprüche an: Trockenes und unfruchtbares Land sei eine offenkundige Strafe Gottes für die Sünden der Bewohner, das Wasser des Toten Meeres nähre kein lebendes Wesen aus Furcht vor einer Wiederholung göttlicher Strafe und die Landschaft Palästinas spiegele noch zu seiner Zeit das biblische Schicksal von Sodom und Gomorrha als Vorgeschmack für das bevorstehende Gericht Gottes.3
Clemens von Alexandria verließ 218 wegen theologischer Streitigkeiten mit seinem Ortsbischof seine Heimatstadt und reiste ins Heilige Land, um dort Hebräisch zu lernen. Der bedeutende Theologe und Exeget Origenes, der die Katechetenschule in Alexandria leitete, kam im Jahre 230 erstmals auf Einladung der Bischöfe von Caesarea Maritima und Jerusalem nach Palästina, um dort zu predigen. Um den Konflikten mit dem Alexandriner Bischof zu entkommen, ließ er sich 234 endgültig in Caesarea nieder und gründete dort eine eigene theologische Schule. Zahlreiche Reisen führten ihn fortan „auf der Suche nach den Spuren Jesu und seiner Jünger und der Propheten“4 zu den Stätten der biblischen Ereignisse. Deren genaue Lokalisierung war für ihn ein wichtiger Aspekt seiner exegetischen Arbeiten, in die er auch die Interpretation der Ortsnamen mit einbezog.
Über Firmilianus, Bischof von Caesarea in Kappadokien, schließlich berichtet Eusebius, er sei von Origenes so begeistert gewesen, dass er ihn zum Predigen in seine Gemeinden einlud und ihn dann auch selber in Judäa aufsuchte, um „einige Zeit bei ihm zur besseren theologischen Ausbildung“ zu verbringen.5 In seinem 393 entstandenen Werk „Berühmte Männer“ (De viris illustribus) schreibt der durch seine lateinische Bibelübersetzung bekannte Kirchenvater Hieronymus, Firmilianus habe Origenes besucht, „als er unter dem Vorwand der heiligen Stätten nach Palästina kam“.6 Damit projiziert er jedoch die Verhältnisse seiner eigenen Zeit in die Vergangenheit zurück, denn eine Pilgerreise als Vorwand für den Besuch bei einem Gelehrten wäre für den Anfang des 3. Jahrhunderts ein offenkundiger Anachronismus.
Festzuhalten bleibt bei diesem Überblick über die uns bekannten Palästina-Reisenden des 2. und 3. Jahrhunderts, dass sie alle ihre Heilig-Land-Fahrt nicht als Akt der Frömmigkeit unternahmen. Ihre Namen und Hinweise auf den Zweck ihrer Reise finden sich meist in Quellen, die erst ein Jahrhundert oder länger nach ihrem Tod entstanden, sodass kaum mehr zu klären ist, ob es sich dabei um ihre tatsächlichen Motive handelte oder ob diese lediglich von den späteren Autoren unterstellt sind. Soweit sich dies erkennen lässt, stand Wissbegier in biblischen Fragen weit eher im Zentrum ihres Interesses als Gebet und Frömmigkeitsübungen an den heiligen Stätten. Als Pilger sind sie demnach wohl noch nicht anzusprechen.
Kaiserin Helena und die Legende von der Auffindung des „wahren Kreuzes“
Nachdem Kaiser Konstantin (306–337) am 28. Oktober 312 unter dem Feldzeichen des Kreuzes den Usurpator Maxentius an der Milvischen Brücke in Rom vernichtend geschlagen hatte – genauso, wie es ihm angeblich vor der Schlacht in einer Vision geweissagt worden war –, wendete er sich dem christliche Glauben zu, auch wenn er sich erst auf dem Sterbebett taufen ließ. Er begünstigte Anhänger und Kleriker der christlichen Religion in der Gesetzgebung und veranlasste den Bau von Kirchen in seinem Herrschaftsbereich. Nach dem Sieg über seinen Mitkaiser Licinius in Adrianopel 324 zum Alleinherrscher aufgestiegen, begann Konstantin auch in den östlichen Provinzen mit seinen Fördermaßnahmen und ließ zahlreiche Kirchen errichten. So gehen der Bau der Grabeskirche in Jerusalem, der Geburtskirche in Bethlehem und der Kirche am Ölberg auf seine Initiative zurück. Unter seiner Herrschaft begann sich Palästina langsam in ein christlich geprägtes Land zu verwandeln. Als Konstantin im Frühjahr 326 nach Rom zurückkehrte, um dort die Feiern zu seinem zwanzigjährigen Herrschaftsjubiläum zu begehen, hatte dieser Prozess gerade erst begonnen und führte unter der mehrheitlich noch nichtchristlichen Bevölkerung des Ostens zu Unruhen.
Vor diesem Hintergrund reiste die Kaiserinmutter Helena, damals bereits eine alte Dame von ungefähr achtzig Jahren, im Sommer 326 in den Orient. Vielleicht tatsächlich unter dem Eindruck der offenkundigen Machtdemonstration des Christengottes beim Sieg Konstantins über Maxentius war Helena wohl schon kurz nach 312 zum Christentum konvertiert. Nun wollte sie, wie Eusebius von Caesarea in seiner Biographie Kaiser Konstantins schreibt, Gott für Sohn und Enkel Dankgebete zollen, das wunderbare Land erforschen und den Fußspuren Jesu die gebührende Verehrung erweisen – Eusebius interpretiert ihre Reise also eindeutig als Pilgerfahrt.7
Davon aber, dass Helena das Kreuz Christi in Jerusalem gesucht und gefunden habe, ist bei Eusebius noch keine Rede. Doch schon wenige Jahrzehnte nach ihrem Tod (ca. 329) entstand die sogenannte Helena-Legende, die in zahlreichen griechischen, lateinischen und syrischen Fassungen überliefert ist. Demnach hatte sich die Kaiserin gezielt nach Jerusalem begeben, um dort das Heilige Kreuz zu suchen, das sich beim Sieg ihres Sohnes als so wirkmächtig erwiesen hatte. Die wohl älteste Fassung der Legende ist in der nach 387 entstandenen Kirchengeschichte des Gelasius von Caesarea überliefert, die heute leider nur noch in Fragmenten rekonstruiert werden kann. In lateinischer Übersetzung findet man den Text des Gelasius in der um 402 verfassten Kirchengeschichte des Rufinus wieder. In leuchtenden Farben schildert die Legende den religiösen Eifer und den strahlenden Erfolg der frommen Kaiserin.
In einer Vision erhält Helena den göttlichen Auftrag, nach Jerusalem zu gehen und dort das Kreuz Christi zu suchen. Dort angekommen, befragt sie die Einwohner, wo Jesus gekreuzigt wurde. Doch der Ort ist schwer zu finden, weil die Christenverfolger dort eine Statue der Göttin Venus hatten aufstellen lassen. Wollte nun ein Christ dort beten, hätte es ausgesehen, als bete er Venus an – und so wurde die Stätte nur selten von Gläubigen besucht und war mit der Zeit fast in Vergessenheit geraten. Ein himmlisches Zeichen aber offenbart der Kaiserin den rechten Platz. Als sie dorthin eilt und sofort den heidnischen Tempel, der den Ort befleckt, niederreißen lässt, findet sie tief unter dem Schutt tatsächlich drei Kreuze, die in Unordnung übereinanderliegen. So ist die Freude über den Fund des Schatzes getrübt, denn man weiß nicht sicher zu entscheiden, welches der drei das Kreuz Christi ist. Die Inschrift des Pilatus ist zwar ebenfalls vorhanden – doch getrennt von den Kreuzen, sodass auch sie keinen sicheren Beweis zu liefern vermag. Erneut bedarf es also eines göttlichen Zeichens.
Zur gleichen Zeit liegt eine vornehme Einwohnerin der Stadt todkrank danieder. Als nun der Jerusalemer Bischof Makarius die Zweifel der Kaiserin und der anderen Anwesenden sieht, schlägt er vor, alle drei Kreuze herzubringen und Gott um ein Zeichen zu bitten. Dann kniet Makarius nieder und betet, Gott möge die Todkranke durch die Berührung mit dem Holz der Erlösung genesen lassen. Anschließend berührt er die Kranke nacheinander mit allen drei Kreuzen. Bei den ersten beiden Versuchen geschieht nichts, doch nach dem Kontakt mit dem dritten Kreuz springt die Frau geheilt auf und preist die Macht des Herrn.
Daraufhin lässt Helena eine prächtige Kirche an der Stelle bauen, wo sie das Kreuz fand. Die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz geschlagen wurde, schickt sie ihrem Sohn Konstantin. Dieser lässt aus einigen davon einen Zaum für sein Streitross anfertigen, die übrigen werden in seinen Helm eingearbeitet. Außerdem sendet die Kaiserin ihrem Sohn auch einen Teil des Kreuzesholzes, der andere Teil wird in einem silbernen Schrein aufbewahrt und regelmäßig zur Erinnerung an diesen Tag verehrt.
Als weiteres Zeichen ihrer tiefen Frömmigkeit lädt die Kaiserin die Gott geweihten Jungfrauen aus Jerusalem zu einem Gastmahl ein. Helena selber bedient sie demütig beim Essen, wäscht ihre Hände und betrachtet es als Schande, wenn die Gäste damit Dienerinnen beauftragen wollen. Die „Königin der ganzen bekannten Welt und Mutter des Kaisers“ tritt hier als Dienerin der Dienerinnen Gottes auf – so schließt die Legende.8
Populärer allerdings als diese Fassung wurde eine zunächst in Syrien verbreitete Version der Geschichte, die auch als Judas-Cyriacus-Legende bezeichnet wird. Diese Erzählung trägt stark antijüdische Züge: Hier kommt Kaiserin Helena nicht als Pilgerin, sondern mit einer großen Armee nach Jerusalem und ruft alle Einwohner der Stadt sowie alle Juden aus Jerusalem und Umgebung, ungefähr 3000, zusammen. Die Kaiserin, eine gebildete Frau mit ausgezeichneter Kenntnis der Heiligen Schrift, tadelt die Versammelten ob ihrer Unwissenheit. Dann fordert sie die Juden auf, ihr eine kleinere Gruppe von wirklichen Schriftgelehrten zu schicken, um ihr Rede und Antwort zu stehen. Aber als diese zu ihr kommen, macht sie auch ihnen nur Vorhaltungen, weil sie zwar das Gesetz und die Propheten gelesen, sie aber nicht verstanden hätten – ein Vorgang, der sich mit immer kleineren Gruppen von Gelehrten mehrfach wiederholt. Sie seien so blind wie ihre Vorfahren, wirft ihnen Helena vor, die zu Mördern wurden und sagten, Christus sei nicht Gott. Verwirrt gehen die Juden weg und beraten sich, weil sie nicht verstehen, was die Kaiserin von ihnen will.
Daraufhin tritt einer von ihnen mit dem bezeichnenden Namen Judas auf und erklärt ihnen, er wisse, dass Helena auf der Suche nach dem Kreuz Jesu sei. Sein Vater habe ihm auf dem Sterbebett geweissagt und dessen Vater seinem Vater, dass dereinst jemand kommen werde, um das Holz zu suchen, an dem Jesus aufgehängt wurde. Wenn es aber gefunden werde, so würden die Religion ihrer Väter und das Gesetz untergehen und das Christentum die Herrschaft antreten, denn Jesus sei tatsächlich der Messias gewesen. Aus Neid hätten ihre Vorväter ihn verurteilt, getötet und begraben, er aber sei nach drei Tagen auferstanden. Deshalb habe sich der Bruder seines Urgroßvaters, Stephanus, zu ihm bekehrt und in seinem Namen zu predigen begonnen, doch er sei von den Juden gesteinigt worden. Daher seien seine Vorfahren nur heimlich Anhänger Jesu gewesen. Sein Vater habe ihm geraten, das Kreuz zu zeigen, wenn man es suche, und ansonsten an seine Söhne weiterzugeben, was er ihm gesagt habe. Nach dieser Erzählung fragt Judas die anderen Juden um Rat, was zu tun sei. Diese verbieten ihm zu verraten, wo das Kreuz sich befinde.
Erneut werden die Juden zu Helena gerufen und von ihr in eine Diskussion verwickelt. Weil sie ihr nicht antworten können, befiehlt sie ihre Hinrichtung, doch die Juden liefern ihr stattdessen Judas aus, weil er ein Prophet sei und sich angeblich am besten in den Schriften auskenne. Ihn nun endlich befragt die Kaiserin nach dem Kreuz Jesu, doch er versucht, sich ihren Fragen zu entziehen. Diese Dinge seien nun schon zwei- oder dreihundert Jahre her, wie also solle er darüber Bescheid wissen? Helena aber glaubt ihm nicht und lässt ihn sieben Tage ohne Nahrung in einen trockenen Brunnen werfen. Nach Ablauf der Woche ist Judas bereit, die Kaiserin nach Golgotha zu führen. Dort bittet er Gott um ein Zeichen, woraufhin eine laute Stimme erschallt und intensiver Weihrauchduft aufsteigt. Judas preist Gott für seine Gnade, gräbt an der bezeichneten Stelle und findet tatsächlich drei Kreuze, die er in die Stadt zur Kaiserin bringt.
Auf ihre Frage hin, welches davon das Kreuz Christi sei, bringt Judas alle drei in die Mitte der Stadt, und man wartet auf ein neuerliches Zeichen. Um die neunte Stunde wird ein toter Jüngling auf einer Bahre vorbeigetragen. Judas legt nacheinander die Kreuze über den Toten, und sobald er ihn mit dem dritten berührt, wird er wieder lebendig. Helena lässt das solchermaßen identifizierte Kreuz Jesu mit Gold und Edelsteinen schmücken und einen silbernen Schrein dafür anfertigen; auf Golgotha baut sie eine Kirche. Judas aber wird vom Jerusalemer Bischof getauft. Nach dessen Tod weiht ihn der Bischof von Rom auf Helenas Bitte zum Nachfolger; außerdem erhält er von ihm den Namen Cyriacus.
Die Kaiserin bittet ihn jetzt, auch noch die Kreuzesnägel zu finden. Judas Cyriacus betet erneut, und sofort fährt ein Blitz an der Kreuzigungsstätte in die Erde. Schimmernd wie Gold heben sich die gesuchten Nägel ohne menschliches Zutun aus dem Boden, und Judas bringt sie zu Helena. Gemäß dem Wort des Propheten Sacharja: „An jenem Tag wird auf dem Pferdezaum stehen: dem Herrn heilig“ (Sach 14,20), lässt diese daraus einen Zaum für das Pferd ihres Sohnes anfertigen. Nachdem all dies geschehen ist, befiehlt die Kaiserin, alle Juden aus Judäa zu vertreiben. In Jerusalem beschenkt sie die Armen reich und weist alle Gläubigen an, jedes Jahr die Auffindung des Kreuzes festlich zu begehen. Judas Cyriacus aber wird von Gott so begnadet, dass er alle Dämonen auszutreiben und alle Krankheiten zu heilen vermag.9
In dieser Form nun fand die Legende von der Auffindung des „wahren Kreuzes“ auch im Westen während des gesamten Mittelalters weite Verbreitung, beispielsweise in der Legenda aurea des Jacobus de Voragine aus dem 13. Jahrhundert. Dabei mögen die judenfeindlichen Züge der Erzählung durchaus zu deren Popularität beigetragen haben, ja, die antijüdischen Elemente nahmen mit wachsender Verbreitung sogar zu. Nicht zuletzt konnte die Christenheit aus der Geschichte von der Bekehrung des Judas – bewusst gezeichnet als Gegenbild des ersten Judas, der Jesus verriet – die Hoffnung schöpfen, dass irgendwann einmal alle Juden ihren „Irrtum“ einsähen und zum christlichen Glauben überträten.
Ein mittelalterlicher „Bestseller“: Die Legenda aurea
Um 1263/1267 erstellte der Dominikaner Jacobus de Voragine, später Bischof von Genua, eine Sammlung von Legenden und biblischen Erzählungen. Dabei kam es ihm vor allem auf die universale Bedeutung des jeweiligen Heiligen, auf seine Vorbildfunktion, an; historische Details ließ er daher, wo nicht unbedingt erforderlich, bewusst aus. Die Geschichten sind nach dem Ablauf des Kirchenjahres geordnet, das ja durch die Abfolge der einzelnen Heiligenfeste gebildet wird. Über tausend mittelalterliche Handschriften und Übersetzungen in zahlreiche Volkssprachen legen Zeugnis dafür ab, dass die „Goldene Legende“ eines der am weitesten verbreiteten und meistgelesenen Bücher des christlichen Abendlandes war.
Die Wahrheit hinter der Legende: Die Orientreise der Kaiserin Helena
Was sich als historischer Kern aus der Helena-Legende herausfiltern lässt, ist weit weniger spektakulär. Die Auffindung des Kreuzes Christi durch Helena kann man aus den Quellen nicht belegen. Allerdings scheint eine Kreuzesreliquie tatsächlich seit der Zeit Konstantins des Großen in der Grabeskirche verehrt worden zu sein. So schreibt etwa Bischof Cyrill von Jerusalem 351 in einem Brief an Konstantins Sohn, Kaiser Constantius II., zu dessen kaiserlichen Vaters Zeit sei das heilbringende Holz des Kreuzes in Jerusalem gefunden worden.10 Und bereits Ende der 340er-Jahre erklärt Cyrill an mehreren Stellen in seinen Katechesen, dass Fragmente des Kreuzesholzes von Gläubigen mitgenommen und in der ganzen Welt verteilt worden seien.11
Tatsächlich begab sich die Kaiserinmutter in den Jahren 326/327 in die östlichen Provinzen des Römischen Reiches. Möglicherweise handelte es sich bei dieser Reise um eine Propagandamaßnahme, die den von Konstantin begonnenen Wandlungsprozess zugunsten des Christentums unterstützen und gleichzeitig Unruhen unter der nichtchristlichen Bevölkerungsmehrheit über die Reformen dämpfen sollte. Allerorten besuchte Helena die christlichen Gotteshäuser, betete, machte den Kirchen großzügige Weihegeschenke und verteilte Wohltaten unter den Armen.
Damit demonstrierte sie, dass die Hinwendung des Kaiserhauses zum Christentum ernst zu nehmen war und warb gleichzeitig um Sympathien für die Christen. Indem sie – anders als dies bei einem männlichen Mitglied der kaiserlichen Familie der Fall gewesen wäre – ohne große militärische Eskorte unterwegs war, konnte Helenas Besuch zudem nicht so leicht als Provokation aufgefasst werden.
Unsere einzige zeitgenössische Quelle für die Orientreise der Kaiserinmutter ist die Konstantins-Vita des Eusebius von Caesarea.12 Seine ausführliche Schilderung lässt ihren Besuch weitgehend wie eine Wallfahrt erscheinen, getragen von frommen Motiven. Mögliche politische Implikationen der Reise klingen nur am Rande an, wenn Eusebius darauf hinweist, dass Helena die östlichen Provinzen, ihre Städte und Menschen „mit kaiserlicher Fürsorge“ in Augenschein genommen habe.13 So konnte Helena durchaus zum Vorbild für künftige Pilger werden, die auf ihren Spuren ins Heilige Land reisten.