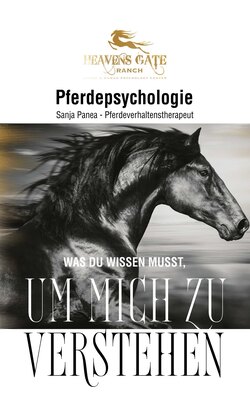Читать книгу Pferdepsychologie - Sanja Panea - Страница 8
ОглавлениеDIE ETHOLOGIE DER PFERDE
Wir beginnen nun mit der Einführung in die faszinierende Welt der Pferde. Lass uns gemeinsam einen Blick in seine Ethologie werfen.
Pferde haben ihr gesamtes Verhalten als Flucht und Herdentier auf das Leben in der weiten Steppe angepasst. Sie legen täglich 40 Kilometer in ständiger Bewegung zurück. Pferde leben in einer Herde – je größer die Herde, desto mehr Schutz ist für das einzelne Tier gewährleistet. Das Pferd kann alleine in der Natur nicht überleben, das ist nicht möglich. Die Herdenhierarchie ist klar definiert, an der Spitze steht ein sozial starkes Leittier. Die Rangordnung kann aber auch immer neu erstellt werden, man bezeichnet sie auch als Hackordnung. Eine wesentliche Rolle für die Rangordnung spielen Alter und Dauer der Gruppenzugehörigkeit.
Dieses Austauschen des Ranges in der Hackordnung muss dem Menschen immer bewusst sein. Wenn man als Mensch ein Teil der Herde ist, ist es von größter Wichtigkeit, dass die Position eindeutig ist und nicht infrage gestellt wird. Der Mensch muss sich als ranghoch positionieren und auch durchsetzen, wenn nötig; es darf absolut kein Zweifel bestehen. Nur so werden unnötige Zwischenfälle und Verletzungen vermieden. Damit das reibungslos funktionieren kann, muss der Mensch die Körpersprache des Pferdes kennen und in der Lage sein, diese klar und unmissverständlich einzusetzen.
Es wurden beim Pferd 170 verschiedene Gestiken festgestellt. Alleine das zeigt schon, wie komplex das alles ist. Das Lesen der Körpersprache des Pferdes ist eines der wichtigsten Elemente, die ein Pferdemensch beherrschen sollte, denn das stellt das Fundament zur Verständigung dar.
Das Pferd hat sich im Laufe der Entwicklung optimal an das Leben als Fluchttier angepasst. Seine Schnelligkeit und seine Reflexe sind alles, was es hat, denn damit sichert es sein Überleben. Der Mensch sollte daher niemals das Pferd dafür bestrafen, dass es seine Urinstinkte einsetzt und sein Leben sichern möchte. Jegliches Verhalten hat eine tiefere Ursache, nach der wir im Zweifelsfall suchen müssen. Wenn das Pferd in unserer Anwesenheit etwas Falsches macht, dann stimmt etwas nicht. Diese Defizite werden wir im Laufe dieses Buches genauer erkunden.
Der Fluchtinstinkt ist bei den Pferden unterschiedlich stark ausgeprägt, in Abhängigkeit von vier verschiedenen Faktoren:
1. Rasse
2. Lernverhalten
3. Umfeld
4. Spirit
Der Fluchtinstinkt ist immer präsent. Das ist eine Tatsache, die der Mensch im Umgang mit dem Pferd und auch im Training niemals außer Acht lassen sollte.
VERHALTEN
Bei den Pferden kann man verschiedene Verhaltensarten beobachten. Grundlegend werden diese in sieben Bereiche aufgeteilt:
Sozialverhalten
Da Pferde Herdentier sind, ist das Zusammenleben in einer Gruppe überlebenswichtig. Um in einer Herde leben zu können, müssen die Pferde von klein auf die Körpersprache erlernen, indem sie ihre Rangspiele spielen – auch in den täglichen Auseinandersetzungen untereinander. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Fohlen und Jungpferde in einer Gruppe gehalten werden. Dazu gehören auch die Dominanzspiele der Pferde. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Pferdebeziehung.
Schauen wir uns den Punkt Dominanz noch mal genauer an:
Dominanzspiele
Dominanzspiele dienen folgenden zwei Gründen:
1. Recht zur Fortpflanzung
2. Recht zum Fressen und Trinken
Es ist ein sehr wichtiges Element des Pferdeverhaltens, denn wenn die Pferde sozial benachteiligt sind, indem sie keine Möglichkeit bekommen, diesen natürlichen Bedürfnissen nachzugehen, weil sie alleine gehalten werden, kann sie das emotional und psychisch extrem negativ beeinflussen. Wenn z. B. Hengste falsch gehalten werden, zeigen sie ein abnormales Verhalten, weil ihr Lebensraum und das Umfeld unnatürlich sind und sie ihren Bedürfnissen nicht nachkommen können. Sie leben oft in Isolation, werden zu gefesselten Stuten gebracht oder müssen Dummies decken, und das alles in einem vom Menschen kontrollierten Umfeld. Kein Ausschlagen, kein Beißen, kein Quietschen … alles Teil des Vorspiels und gleichzeitig eine Wichtigkeit der emotionalen Balance der Pferde. Der Drang, Dominanzspiele zu spielen, ist sehr groß, völlig unabhängig davon, ob es ein junges oder altes Pferd ist. Nur wenn das Pferd krank oder verletzt ist, ist dieser Drang nicht da. Viele Menschen können es nicht ertragen, wenn ihre Pferde anfangen, sich gegenseitig zu dominieren, sie haben Angst, dass sie verletzt werden. In den heutigen Haltungsbedingungen ist es tatsächlich schwieriger, solch natürliches Verhalten zu erlauben, denn es gibt oft nur kleine Paddocks, Ecken und Begrenzungen. Im natürlichen Umfeld der Pferde gibt es hingegen keine Zäune, sie können dort nicht in eine Ecke gedrängt werden. Hast Du schon mal beobachten können, wie ein dominantes Pferde ein anderes die ganze Zeit in Bewegung hält? Wenn Dein Pferd versucht, Dich zu bewegen, dann denkt es, dass es der Dominantere von euch beiden ist, und noch schlimmer: Es will überhaupt keine Freundschaft mit Dir, weil es Dich nicht respektiert: Pferde möchten sich mit den Dominanteren anfreunden.
Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, wer wen bewegt, dann ist es auch sehr einfach, verschiedene Techniken beim Pferd anzuwenden, sodass es einen versteht.
Ernährungsverhalten
Durch das energiearme Futter in den Weiten der Steppe müssen sich die Pferde den ganzen Tag fortbewegen, um ausreichend Nahrung zu bekommen. Der Verdauungsapparat ist so ausgelegt, dass sie den ganzen Tag fressen müssen, 16 Stunden lang, und vor allen Dingen kauen. Ein Pferd benötigt circa 3000–3500 Kauschläge für ein Kilo Heu. Die Kauschläge sorgen für ein gutes Einspeicheln des Futters. Ein normales Warmblut bildet pro Minute circa 40–90 Milliliter Speichel, auf den ganzen Tag verteilet wären das dann 5–10 Liter. Der Mensch z. B. produziert umgerechnet einen Milliliter Speichel pro Minute und anderthalb Liter pro Tag.
Der Speichel ist beim Pferd von großer Bedeutung, denn er enthält größere Mengen an Mineralstoffen und Bikarbonat, die zur Neutralisierung der Magensäure im Mageneingang dienen. Dadurch wird das Futter auch feucht und lässt sich besser abschlucken.
Wie man anhand der Fressdauer und der Kauschläge deutlich sehen kann, ist eine ausreichende Raufutterversorgung sehr wichtig, nicht nur für den Organismus, sondern es dient auch der Beschäftigung. Der Erhaltungsbedarf eines Pferdes beträgt anderthalb Kilo Heu pro 100 Kilo Körpergewicht. Aber viele verstehen das falsch: Das ist der Erhaltungsb edarf und in den meisten Fällen zu wenig. Zu wenig Futter wiederum führt bei Pferden zu Unruhe, Unausgeglichenheit, Nervosität und Unbehagen. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Fresspausen nicht länger als vier Stunden andauern dürfen. In den Wintermonaten benötigt das Pferd außerdem 30 Prozent mehr Futter als in den Sommermonaten, da die Energie durch Kälte, Wind und Wetter schneller verloren geht.
Durch eine verbesserte Kauaktivität entsteht auch ein besserer Abrieb der Zähne. Bei einer ungleichen Abnutzung der Zähne – durch zu geringe Kauaktivität oder eine krankhafte Veränderung der Kaumuskulatur, der Kiefergelenke oder der Zähne – kann es zu hakenartigen Veränderungen an den Zähnen mit fatalen Folgen kommen, schmerzende scharfe Kanten, die das ordentliche Zermahlen des Futters beeinträchtigen und zu Verletzungen an der Zunge und im Maulbereich führen können. Dann wiederum kann es zu Schlundverstopfung oder auch Koliken kommen, da das Futter nicht mehr richtig zerkleinert werden kann.
Du siehst also, wie wichtig es ist, dass Dein Pferd ausreichend Raufutter zur Verfügung hat.
Fortbewegungsverhalten
Das Pferd als Flucht-, Beute-, Steppen- und Herdentier hat das Bedürfnis, sich ständig fortzubewegen. Die zwei primären Gründe dafür sind Futter und Flucht. Für die Nahrungsaufnahme bewegt sich das Pferd 12–16 Stunden im Schritt. Da es auch ein Beutetier ist, kann es kurzfristig sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, z. B. bei Gefahr, dies findet dann im schnellen Galopp statt.
Diese Verhaltensweise müssen wir bei unseren Pferden immer berücksichtigen, denn das ist bei ihnen in der DNA verankert. Man muss darauf achten, dass das Pferd soviel Auslauf wie nur möglich bekommt, das sorgt dann auch für eine ausgeglichene Psyche. Nehmen wir ihm das weg, dann entstehen Spannungen, Verhaltensstörungen, Stress, Unbehagen, Aggression, Frust, Unkonzentriertheit und Nervosität.
Die Intensität der eben genannten Verhaltensmuster ist abhängig von Rasse und Spirit des Pferdes. Besonders gefährdet sind die Boxenpferde, die im schlimmsten Fall nur ein oder zwei Stunden an die Luft dürfen und das vielleicht noch ganz alleine ohne Artgenossen. Das ist keine artgerechte Haltung, da die primären Bedürfnisse der Tiere nicht beachtet werden. Wildpferde legen pro Tag 8–40 Kilometer in Bewegung zurück. Ihre Schrittlänge beträgt dabei 80 Zentimeter. Bei einem Boxenpferd, das einen täglichen Auslauf von etwa zwei Stunden bekommt, beträgt die Schrittlänge nur 30 Zentimeter. Das bedeutet, dass sich das Boxenpferd in den zwei Stunden nur 170 Meter bewegt. Dass das nicht artgerecht ist, versteht sich von selbst.
Das Pferd als Pflanzenfresser und Fluchttier verfügt über einen angeborenen kontinuierlichen Fortbewegungstrieb. Physiologisch mangelhafte Bewegung – zeitlich zu kurz, zu wenig und dann zu schnell –, ist die Hauptursachen für Erkrankungen. Diese erkennt man dann an Durchblutungsstörungen, geschwollenen Beine, Atmungsproblemen etc. Auch die pure Lebensfreude bleibt dabei aus, denn das Pferd hat keine Möglichkeit, sich zu entfalten – physisch und psychisch.
Der Mensch hat sich die Schnelligkeit des Pferdes und seinen Fluchtinstinkt zunutze gemacht, das sehen wir im Rennsport. Wenn wir uns den Rennsport aber genauer ansehen, dann sehen wir alles andere als entspannt galoppierende Pferde, sondern weit aufgerissene Augen, Stress, Schweiß auf dem Pferdekörper, obwohl es noch gar nicht am Start ist, und wir sehen Angst – Todesangst; wir sehen Pferde, die um Ihr Leben laufen, fliehende Pferde. Hier wird der Fluchtinstinkt völlig missbraucht, für den Egoisten Mensch, der nur auf Profit, Anerkennung und Lob aus ist.
Wenn man seinem Pferd das Ausleben seines Fortbewegungstriebes nicht ermöglicht und dann erwartet, das es sich genau in dem Moment, in dem der Mensch es verlangt, konzentriert und das tut, was von ihm verlangt wird, obwohl es vorher 23 Stunden in der Box eingesperrt war, braucht man sich nicht wundern, wenn es dann explodiert. Und genau an diesem Punkt wird dann das Pferd dafür bestraft, dass es seinen natürlichen Instinkten folgen möchte, weil der Mensch als Raubtier sich nimmt was er will und wann er es will. Funktioniert das Pferd nicht, wird es bestraft, eingeschläfert oder kommt weg, weil es den Anforderungen der Bestie Mensch nicht entspricht.
Komfortverhalten
Alle Lebewesen auf diesem Planeten streben nach Wohlbefinden und Gesunderhaltung. Für Pferde ist der Komfort eines der wichtigsten Bedürfnisse überhaupt. Das sind Dinge wie Wälzen, Scheuern, Kratzen, gegenseitiges Fellkraulen, in der Sonne dösen und sich entspannen. Das alles dient der Gesunderhaltung, denn Grundvoraussetzung für Wohlbefinden ist die Abwesenheit von Schmerzen und Leid. Manteuffel (2006) und Boissy et. al. (2007) vertreten darüber hinaus die Ansicht, dass Wohlbefinden bei Tieren mehr ist als das Fehlen von negativen Empfindungen. Sie schließen deshalb das Auftreten positiver Gefühle mit ein.
Da Pferde sozial lebende Tiere sind, haben sie das Bedürfnis nach soziopositiven Beziehungen. Diese Beziehungen hemmen aggressives Verhalten zwischen den Gruppenmitgliedern, dienen der Festigung des Gruppenzusammenhalts und haben eine beruhigende Wirkung. Bei diesen affiliativen Verhaltensweisen zeigt sich eine große und starke Verbundenheit bei den Tieren, die sich sehr mögen, auch als positiver Effekt bezeichnet. Die affiliativen Verhaltensweisen können eine positive Stimmung bei den Tieren hervorrufen.
Ruheverhalten
Jedes Lebewesen muss die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und zu regenerieren. Pferde erreichen dies mit Dösen oder Schlafen. Als Fluchttier erhält sich das Pferd durch viele kleine und kurze Schlafeinheiten – dem Dösen. Nur wenn es sich ganz sicher fühlt, legt es sich zum Schlafen hin.
Es ist überlebensnotwendig, dass sich ein Lebewesen ausruht und schläft. Ein Pferd kann notfalls mehrere Tage hintereinander im Stehen schlafen, wobei dabei aber kein Tiefschlaf möglich ist. Jedes Pferd sollte jedoch jede Nacht die Möglichkeit haben, in die Tiefschlaf- die REM-Phase zu gelangen, denn nur dann ist eine vollständige Regeneration möglich. In der Offenstallhaltung muss der Untergrund dafür sauber und trocken sein und ausreichen, dass sich die ganze Herde hinlegen kann, wenn nötig. Viele Pferde legen sich nicht auf einem nassen Untergrund hin, aus dem Grund fehlt ihnen dann der Tiefschlaf. Das ist aber auf Dauer nicht auszuhalten.
Ich war einmal auf einem Seminar. Dort konnte man mit und ohne Pferd teilnehmen. Es waren viele Teilnehmer mit ihren Pferden dort. Diese stellten sich mit ihren Pferden in einer Reihe auf und warteten auf Anweisungen des Trainers. Alle Pferde standen ganz ruhig neben ihren Besitzern. Plötzlich brach eines der Pferde zusammen und konnte nicht mehr aufstehen. Das Pferd kam aus einer Offenstallhaltung ganz in meiner Nähe, von der bekannt war, dass sie dort nicht ausreichend Futter bekamen und sehr viele krank wurden. Der Tierarzt wurde gerufen und mit Müh und Not konnte man das Pferd in eine Einzelbox bringen. Es legte sich dort sofort wieder hin, denn es hatte keine Kraft mehr, sich auf den Beinen zu halten. Die Diagnose des Arztes: Völliger Erschöpfungszustand durch Schlafmangel. Da das Pferd in dem Offenstall nur Einsteller war, wusste die Besitzerin nicht, ob es sich hinlegte oder nicht. Sie schleppte das Tier dann auch noch in diesem Zustand per Anhänger zu dem Seminar – das musste ja schiefgehen. Sie stellte dann in Absprache mit der Besitzerin des Offenstalls eine Kamera auf und sie stellten fest, dass keines der Pferde sich zum Schlafen hinlegte. Die Frau wechselte den Stall sofort und das Pferd erholte sich recht schnell, denn nun konnte es sich hinlegen, weil da eine ruhigere Gruppe von Pferden war und kein Stress mehr.
Ich selber habe auf meiner Ranch eine Dual-Haltung. Meine Pferde sind den ganzen Tag 14–16 Stunden zusammen in der Herde. Abends bringe ich jeden in seine Box, wo sie dann auch in aller Ruhe ihr Müsli zu sich nehmen können, ohne das Futterneid aufkommt. Die Boxen sind schon mit Heu für die ganze Nacht vorbereitet und meine Pferde kommen jede Nacht in den Tiefschlaf. Ich halte meine Pferde am Haus und gehe jede Nacht um 23 Uhr noch mal zu ihnen in den Stall, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Um diese Uhrzeit liegen sie bereits quer in ihren großen Boxen in ihren sauber und dick eingestreuten Betten und schlafen stundenlang. Ich habe das schon von Anfang an schon so gemacht, als meine Fohlen noch klein waren. Besonders da ist es wichtig, dass die Fohlen in den Tiefschlaf kommen. Somit habe ich mit Verhaltensauffälligkeiten keine Probleme und alle Pferde sind ausgeglichen und gesund.
Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sicherstellen, dass sich das Pferd in dem jeweiligen Offenstall auch hinlegt. Viele Betrieb betonieren den Untergrund und legen diesen nicht mit Softmatten aus, wobei diese zusätzlich noch mit Sägespänen oder Stroh eingestreut werden sollten, um den bestmöglichen Komfort zu gewährleisten. Durch den Schlafentzug kann es zu reduziertem Allgemeinbefinden kommen. Die Pferde magern ab, bekommen Magengeschwüre und Durchfälle. Da sie aber diese Anzeichen schleichend kommen, wird es oft nicht mit dem Schlaf in Zusammenhang gebracht.
Viele Betriebe wollen sich die Kosten für Einstreu und gute Matten sparen und erzählen den Pferdebesitzern, dass Stroh gar nicht so gut ist für die Pferde, sie könnten ja eine Kolik bekommen. Das ist aber totaler Blödsinn! Es geht dabei nur darum, dass der Arbeitsaufwand größer ist und mehr Mist anfällt. Das ist alles. Wenn Du in so einem Stall bist und feststellst, dass es nicht tiergerecht zugeht, dann fordere die Stallbetreiber bitte dazu auf, sofort eine Änderung vorzunehmen. Es wird sicher viele geben, die uneinsichtig sind, aber der Leidtragende ist das Pferd. In vielen Betrieben wird übrigens auch keine ausreichende Menge Heu gefüttert, ebenfalls aus Kostengründen. Also achte darauf, wo Du Dein Pferd unterbringst.
REM-Schlaf
Es ist bereits erwiesen, dass Schlafmangel einen negativen Effekt auf die Leistung hat. Daher ist es sehr wichtig, dass die Pferde unbedingt in die Tiefschlaf-, also die REM-Schlafphase gekommen. Der Schlaf soll bei Thermoregulation, Erholung, Energieerhaltung, Wachsamkeit, physischen Erholungsprozessen und der Aufrechterhaltung des Immunsystems behilflich sein. Um den REM-Schlaf zu erreichen, müssen sich Pferde komplett entlasten und liegen; im REM-Schlaf ist keine physische Haltung mehr möglich.
Pferde legen sich nicht hin, wenn sie sich nicht vollkommen sicher fühlen. Daher solltest Du sicherstellen, dass sich Dein Pferd wirklich zum Schlafen hinlegt – überzeuge Dich davon! Kontrolliere es! Bei der Offenstallhaltung ist das gut zu beobachten, wenn man eine Kamera im Stall installiert. In den Offenställen ist das mit der nötigen Entspannung oft ein Problem. Kontrolliere ob und wie häufig sich Dein Pferd hinlegt, meistens ist das zwischen 20 und 5 Uhr morgens, aber auch bis zu zwei Stunden nach der Mittagszeit. Du solltest gut gemisteten Untergrund und dicke Einstreu, vor allem nachts, sicherstellen.
Der Zusammenbruch des Pferdes bei dem Seminar war kein Einzelfall, vielmehr kommt es sogar ziemlich oft zu Zusammenbrüchen wegen Schlafmangel, das ist ein verbreitetes Problem und muss von jedem Pferdebesitzer beachtet werden.
Wichtig ist zu verstehen, dass das Gehirn des Pferdes sich in einer leichteren Schlafphase, wenn es sich z. B. zwar hinlegt, aber den Kopf dabei nicht ablegt, zwar etwas ausruht, aber die Muskulatur wird nur im REM- Schlaf völlig entlastet. Es wird vermutet, dass das Gehirn während des REM-Schlafs die Informationen im Langzeitgedächtnis festigt, das Vorderhirn wird also funktionell abgetrennt, sodass der Hirnstamm für die begleitenden Bewegungen an den Beinen (Zuckungen) verantwortlich sein muss. Sollten Pferd unabhängig von physischen oder psychischen Gründen wie etwa Unwohlsein, Unsicherheit oder Angst in einem neuen Umfeld, nicht in der Lage sein, sich hinzulegen, kann leichtes Dösen keinen verlorenen REM-Schlaf ersetzten, das muss man sich stets bewusst machen.
Während einer durchschnittlichen Nacht hat das Pferd etwas sechs Schlafphasen, jede dauert etwa 15 Minuten. Wenn das Pferd sich nur hinlegt, ohne sich völlig abzulegen, liegt die durchschnittliche Dauer zwischen vier und sechs Minuten.
Meine Pferde kommen wie gesagt jede Nacht in die REM-Phase. Sie sind dabei so entspannt, dass ich ihnen oft im liegenden Zustand die Hufe sauber machen kann. Bei Fohlen und Jungpferden ist es besonders wichtig, dass sie einen eigenen Ruhebereich bekommen, denn das brauchen sie zum Wohlfühlen, Lernen, das Wachstum und die Gesunderhaltung.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass meine Pferde viele Stunden in der Tiefschlaf-Phase verbringen, weil ich es überprüfe. Einmal war eins meiner Mini-Ponys krank. Da auch sie in der Gruppe gehalten werden, haben sie auch eine gemeinsame Großraumbox für die Nacht. Als der Tierarzt gegen 23 Uhr kam, lagen alle miteinander in der Box und schliefen tief und fest, nur das kranke Pony stand. Der Tierarzt schaute sich um und fragte, was mit denen allen los sei. Ich sagte: »Ach nichts, die schlafen bloß. Steigen Sie einfach über sie drüber.« Er stieg also auf dem Weg zu dem kranken Tier über alle drüber und die Ponys bewegten sich alle nicht. Er meinte, dass er so was noch nie gesehen habe, dass Pferde nicht aufstehen, wenn jemand Fremdes kommt. Es liegt an der sicheren Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, und dem tiefen Vertrauen. Sonst würde ein Pferd das nie machen.
Erkundungsverhalten
Dann gibt es noch das Erkundungsverhalten. Für Pferde als Fluchttier ist es extrem wichtig, dass sie ihre Umgebung gut kennen, sogar lebenswichtig. Sie sind so sensibel in ihrer Wahrnehmung, dass sie noch weit entfernte Gefahren erkennen können. Die Möglichkeit der Beobachtung ihrer Umgebung vermittelt ihnen Sicherheit. Bei Gefahr wird der Fluchtinstinkt ausgelöst. Wird das Erkundungsverhalten beim Pferd durch das Haltungssystem unterdrückt, löst dies beim Pferd Unsicherheit, Angst und Nervosität aus. Durch das Erkundungsverhalten können Pferde auch lernen, eine Gefahr besser einzuschätzen, und sie erschrecken sich dann nicht gleich wegen jeder Kleinigkeit.
Pferde müssen die Möglichkeit haben, ihre Umgebung kennenzulernen. Sie werden dadurch viel selbstbewusster und überreagierend nicht sofort. Nimmt man einem Pferd die Möglichkeit zu erkunden, zu beobachten, Erfahrungen zu sammeln, führt das früher oder später zu einem permanent gestressten und hypernervösen Tier.
Auscheidungsverhalten
Pferde halten ihren Liegebereich sauber. Sie urinieren und koten nicht in der Nähe von Futter- oder Liegeplatz. Die Hengste markieren ihr Revier, indem sie mit dem Äppeln Zeichen setzten. Sie bevorzugen dazu weichen Untergrund, damit der Urin nicht an den Beinen hoch spritzt, denn das mögen sie nicht.