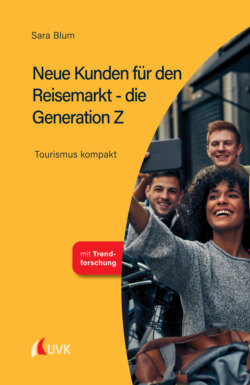Читать книгу Neue Kunden für den Reisemarkt - die Generation Z - Sara Blum - Страница 13
Fünf-Phasen-Modell nach Gausemeier und Plass (2014)
ОглавлениеAbbildung 2: Phasenmodell der Szenario-Technik nach Gausemeier und Plass
Quelle: Gausemeier und Plass (2014, 48).
Szenario-Vorbereitung: In dieser Phase wird die Zielsetzung der Forschung bestimmt. Dazu muss das Gestaltungsfeld festgelegt und genau abgegrenzt werden. Zudem findet eine genaue Analyse der gegenwärtigen Situation des festgelegten Gestaltungsfeldes statt (Gausemeier und Plass 2014, 49–50).
Szenariofeld-Analyse: In dieser Phase geht es darum, die Einflussfaktoren des Szenariofeldes zu ermitteln und die für die Entwicklung des Feldes besonders relevanten Faktoren herauszufiltern. Von den Autoren wird vorgeschlagen, das Szenariofeld hierbei zunächst in Einflussbereiche einzuteilen. Hierbei handelt es sich ebenso um Bereiche, die das Szenariofeld direkt beeinflussen (Unternehmen, Branche, Konkurrenz, Lieferanten, Kunden), wie um Bereiche, die einen indirekten Einfluss ausüben (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft). In diesen Einflussbereichen werden Einflussfaktoren identifiziert (Gausemeier und Plass 2014, 50). Aus diesen Einflussfaktoren werden anschließend die Faktoren ermittelt, die einen großen Einfluss auf den Untersuchungsgegenstand im Rahmen des Gestaltungsfeldes haben und ihn stark prägen. Diese Faktoren werden Schlüsselfaktoren genannt (Gausemeier und Plass 2014, 51–54).
Projektionsentwicklung: In der Projektionsentwicklung werden die zuvor herausgefilterten Schlüsselfaktoren genauer betrachtet. Für jeden Schlüsselfaktor werden in einem ersten Schritt mögliche Entwicklungen in der Zukunft ermittelt. Anschließend werden die Projektionen dahingehend ausgewählt, dass sie sich voneinander abgrenzen lassen und tatsächlich mögliche Entwicklungen für die Zukunft darstellen (Gausemeier und Plass 2014, 55–58).
Szenario-Bildung: In der nächsten Phase entstehen die eigentlichen Szenarien. Hierfür werden die Projektionen auf ihre Konsistenz geprüft. Paarweise wird festgehalten, ob die Projektionen sich unterstützen, unabhängig voneinander sind oder sich negieren. Daraus entstehen Projektionsbündel mit Projektionen, die sich besonders stark unterstützen. Diese bilden die Basis für die Szenarien, welche an dieser Stelle ausformuliert werden (Gausemeier und Plass 2014, 61–62).
Szenario-Transfer: Im Szenario-Transfer werden die zuvor erstellten Szenarien analysiert und bewertet. Ziel hierbei ist es, Chancen und Risiken für das Szenariofeld zu ermitteln und dadurch Handlungsempfehlungen und/oder Entscheidungshilfen zu bieten (Gausemeier und Plass 2014, 69).
Die Autoren Gaßner und Kosow gehen in ihren Darlegungen auf Unterschiede bei den Eigenschaften von Szenarien ein, welche im Folgenden aufgezeigt werden. Die Szenario-Technik kann durch qualitative und/oder quantitative Ansätze durchgeführt werden. Qualitative Ansätze greifen auf narrativ-literarische Verfahren zurück, wobei Schlüsselfaktoren auf ihrer inhaltlichen Ebene betrachtet werden. Der qualitative Ansatz kann für mittel- und langfristige Fragestellungen genutzt werden und findet besonders in den Bereichen Kultur, Politik und Institutionen seinen Einsatz. Der quantitative Ansatz greift vermehrt auf mathematische Modelle und Modellierung zurück. Er wird eher für kurzfristige Entscheidungen und in Bereichen, in denen Quantifizierung sinnvoll erscheint, angewandt. Diese Bereiche sind beispielsweise Demografie oder Wirtschaftsentwicklungen. Heute werden häufig hybride Ansätze in der Szenario-Technik gewählt, die eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Ansätzen darstellen (Gaßner und Kosow 2008, 25).
Eine weitere Unterscheidung kann bei Szenarien in dem Umgang mit zukünftigen Entwicklungen gemacht werden. Zum einen gibt es Szenarien, bei denen gegenwärtige Entwicklungen so fortgeschrieben werden, wie sie es momentan vermuten lassen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich auch in dem Verhalten des Umfeldes keine bedeutenden Veränderungen ergeben. Dieses Szenario wird von Gaßner und Kosow (2008, 26) als Referenz-Szenario betitelt. Dementgegen stehen Policy-Szenarien, die explizit extreme Entwicklungen, Gegentrends oder neue Entscheidungen einbeziehen. Dadurch sollen versteckte Handlungsoptionen aufgedeckt, und bisher unerkannte Chancen und Risiken erkannt werden. Generell betonen die Autoren, dass hierbei auch undenkbare, unerwünschte und unwahrscheinliche Entwicklungen mitbedacht und damit Diskontinuitäten einbezogen werden sollten (Gaßner und Kosow 2008, 26).
Unterscheiden lassen Szenarien sich außerdem anhand ihrer Reichweite. Diese betrachtet etwa den Zeithorizont, die geografische Reichweite und das Thema. Bei dem Zeithorizont wird unterschieden zwischen kurzfristigen (< 10 Jahre), mittelfristigen (< 25 Jahre) und langfristigen (> 25 Jahre) Szenarien. Die geografische Reichweite kann in verschiedene Größen eingeteilt werden. Beispielsweise gelten hier die globale, kontinentale, internationale oder regionale Ebene als gängige Einteilungen. Auch das Thema der Szenarien kann unterschiedliche Ausmaße annehmen. Szenarien können einzelne Themen untersuchen, ganze Sektoren betrachten oder einzelne Institutionen in den Mittelpunkt stellen. Generell lässt sich festhalten: Je größer die Reichweite, desto größer ist auch die Abstraktion (Gaßner und Kosow 2008, 27).
Neben diesen Eigenschaften, stellt die IZT durch Gaßner und Kosow auch Gütekriterien für Szenarien auf. An diesen Gütekriterien orientiert sich das vorliegende Buch, um einer wissenschaftlichen Prüfung standzuhalten. Damit soll einerseits die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit aber auch die der kreativen Gestaltung und des Arbeitsprozesses gesichert werden. Im Folgenden werden die Kriterien vorgestellt:
» Plausibilität: Dargestellte Entwicklungsmöglichkeiten in den Szenarien müssen logisch möglich sein. Sie können unwahrscheinlich oder unerwünscht sein, müssen aber vorstellbar sein.
» Konsistenz: Die Entwicklungen in Szenarien müssen in sich stimmig sein. Das bedeutet, dass entwickelte Projektionen sich nicht gegenseitig ausschließen dürfen.
» Verständlichkeit/Nachvollziehbarkeit: Ein Szenario muss für einen externen Leser (durch detaillierte Beschreibungen) verständlich sein. Zudem muss die Komplexität reduziert werden, damit ein Szenario nachvollziehbar ist. Forscher müssen sich auf zentrale Schlüsselfaktoren fokussieren.
» Trennschärfe: Die entwickelten Szenarien müssen sich ausreichend voneinander unterscheiden, um sie miteinander vergleichen zu können.
» Transparenz: Bei der Anwendung der Szenario-Technik werden fortlaufend Annahmen gemacht und Entscheidungen für die weiteren Forschung getroffen. Für die Transparenz ist es wichtig, diese festzuhalten und zu begründen. Ein offener Umgang mit den eigenen Positionen ist wichtig, um den Forschungsprozess transparent zu halten.
» Grad der Integration: Der Einbezug von möglichst vielen Ebenen zur Untersuchung der Einflussfaktoren stellt ein wichtiges Kriterium bei der Erstellung von Szenarien dar.
» Rezeptionsqualitäten: Szenarien werden auch in einer narrativen Form erstellt und sollten für externe Leser einfach verständlich, spannend und bildhaft ausgestaltet sein, damit sie sich das beschriebene Zukunftsbild einfach vorstellen können.
» Beteiligte: An der Entwicklung von Szenarien können verschiedene Personen beteiligt werden. Eine möglichst heterogene Zusammenstellung ist hierbei von Vorteil (Wissenschaftler, Experten oder Akteure aus der Praxis und Betroffene/Beteiligte).
» Aufwand: Szenarioprozesse sind aufwändig und bedürfen Zeit, Geld und personeller Ressourcen.
Quelle: Gaßner und Kosow (2008, 28–31).