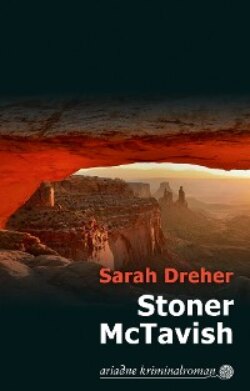Читать книгу Stoner McTavish - Sarah Dreher - Страница 7
Kapitel 1
Оглавление»Ich weiß, was dir fehlt«, sagte Marylou.
»Was?« Es war schwül im Reisebüro. Stoners Hand blieb am Papier kleben, als sie wütend eine provisorische Reiseroute wegradierte, um eine neue einzutragen. Der Zettel war schlaff wie ein alter Baumwolllappen.
»Liebe.«
»Ich brauch keine Liebe, Marylou. Ich brauch eine Klimaanlage.«
»Romantik«, sagte Marylou und verteilte gelassen Hüttenkäse auf einer Schwarzbrotschnitte. »Leidenschaft, Erregung, Herzensnot.«
Stoner ächzte. »Die Leute sind verrückt. Kannst du dir vorstellen, wie Disney World bei diesen Temperaturen sein muss?«
»Du warst nicht mehr verliebt seit dieser Wie-hieß-sie-doch-gleich?«
»Agatha.« Stoner rumorte in ihrer Schreibtischschublade. »Hast du den Fahrplan von United?«
»Nein. Wie lange ist es her?«
»Heute Morgen war er noch da.«
»Seit du verliebt warst!«
»Nicht lange genug«, sagte Stoner. »Bist du ganz sicher, dass du ihn nicht hast?«
»Zwei Jahre? Drei? Viel zu lange.« Marylou fegte einen Krümel weg, der sich in ihrer Rüschenbluse eingenistet hatte. »Es ist nicht gesund für dich, so lange nicht verliebt zu sein.«
Stoner warf ihr einen verärgerten Seitenblick zu. »Himmel, Marylou, ich habe einen Job!«
»Ja, und du bist schon ganz abgestumpft davon geworden.«
»Herzlichen Dank.«
Marylou seufzte. »Spaziergänge im Mondlicht am Ufer des Charles, nächtliches Nacktbaden am Crauestrand …«
»Es ist zu heiß, um verliebt zu sein, selbst wenn ich eine wüsste, in die ich mich verlieben wollte, was nicht der Fall ist … also, wenn es dir nichts ausmacht, ich muss …«
»Stumpf, stumpf, abgestumpft«, sagte Marylou. »Nimm einen Cracker.«
»Ich will keinen Cracker. Ich will mich nicht verlieben. Alles, was ich will, ist der Fahrplan von United Airlines.«
»Vielleicht kennt meine Mutter ein paar nette Frauen in Wellfleet, die noch zu haben sind.«
»Marylou …« Sie war nicht in der Stimmung für so etwas. Mordgelüste begannen sich zu regen.
Ihre Freundin und Geschäftspartnerin sah sie lammfromm an. »Vielleicht ist es in Wellfleet kühler als in Boston.«
»Vielleicht ist es«, sagte Stoner ruhig, »in der Hölle kühler. Den Fahrplan von United, bitte!«
»Ich hab ihn nicht. Ehrlich. Du wirst sie anrufen müssen.« Sie füllte einen Plastikbecher mit Wein für Stoner und einen für sich selbst. »Sie werden dich auf ›Bitte warten Sie‹ schalten, du weißt schon.«
»Was bleibt mir übrig? United Airlines sind nicht mit meinen Gehirnzellen verkabelt.«
»Und auch nur geringfügig mit unserem Telefon«, bemerkte Marylou.
Stoner rief die Zentrale an und wurde auf ›Bitte warten Sie‹ geschaltet. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, schlug den Hörer gegen ihre Handfläche und wippte ungeduldig vor und zurück.
»Du solltest dich wirklich entspannen«, mahnte Marylou ernsthaft. »Das ist nicht gut für dich.«
»Von irgendetwas müssen wir leben. Dies hier ist kein Non-Profit-Verein.«
»Es ist Sommer. Du machst dir zu viele Sorgen. Wir kommen über die Runden.«
»Kaum«, sagte Stoner. Sie nahm einen Schluck Wein und rieb sich mit dem Handrücken die Stirn. »Ich möchte nur einmal genug Geld haben, um etwas Besonderes für Tante Hermione besorgen zu können. Weißt du, in den zwölf Jahren, die ich bei ihr lebe, habe ich nie mehr tun können, als meinen eigenen Kram zu bezahlen.«
»Oh, Stoner, darauf gibt sie doch nichts.«
»Aber ich.« Sie trank ihren Wein aus. »Sieh mich doch mal an. Einunddreißig Jahre alt und zu nichts anderem fähig, als irgendwie ›über die Runden zu kommen‹.«
Marylou füllte ihr Glas auf. »Meine Mutter meint, diese Gedanken sind normal in unserem Alter.«
»Irgendwie tröstet mich das auch nicht.« Stoner lauschte einen Augenblick in den Telefonhörer. »Verdammt, wenn sie mich schon auf ›Bitte warten Sie‹ schalten, könnten sie mir wenigstens dieses Gedudel ersparen. Ich komme mir vor wie beim Zahnarzt!«
Marylou zupfte an ihrem Rock. »Ich glaube, ich hab schon wieder ein Pfund zugenommen.«
»Das wundert mich nicht. Seit heute Morgen um neun hast du drei Brötchen mit Hüttenkäse gegessen – ganze Brötchen, nicht etwa halbe – und eine halbe Schachtel Cracker.«
»Frauen können nicht von Luft allein leben, so voll diese auch mit nährstoffreichen Pollen sein mag.«
»Und wir waren Mittagessen.«
»Mittagessen ist Mittagessen«, sagte Marylou.
»Dann beschwer dich nicht über dein Gewicht.«
»Ich kann nichts für mein Gewicht, es ist geerbt.«
Stoner schüttelte hilflos den Kopf. »Marylou, deine Eltern sehen beide wie die personifizierte chronische Magersucht aus!«
»Die Natur verschmäht Wiederholungen.«
»Eines Tages«, sagte Stoner, »werden sie mich hier um mich schlagend und schreiend heraustragen, in einer Zwangsjacke.«
Marylou prüfte ihren wohlgerundeten Busen und runzelte die Stirn. »Findest du mich abstoßend?«
»Oh, Marylou, natürlich nicht!«
Im Telefon klickte es und eine verbindliche Stimme gurrte: »Guten Tag. United Airlines. Was kann ich für Sie tun?«
Stoner legte eine Hand über die Sprechmuschel. »Das ist sie«, flüsterte sie. Marylou stürzte sich auf das Mithörgerät auf ihrem Schreibtisch.
»Einen Moment bitte«, sagte Stoner mit Sekretärinnenstimme, dann räusperte sie sich. »Hallo. Hier ist Stoner Mc Tavish, von Kesselbaum & Mc Tavish.«
»Oh.« Die Stimme wurde eisig. »Sie wünschen, bitte?«
Marylou wand sich in lautlosen Zuckungen und legte auf. »Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es!«
Stoner kippte ihren Stuhl nach hinten, stützte einen Fuß auf ihrer Schreibtischkante ab und verbrachte die nächsten zehn Minuten damit, Flugtickets durchzugeben. Als sie fertig war, brüllte Marylou: »Rufen Sie nächste Woche bei uns an. Wir machen operative Geschlechtsumwandlungen.«
Stoner lachte. »Also wirklich, Marylou!«
Marylou fegte United Airlines mit einem Schlenker ihres Handgelenks fort. »Was soll’s, sie hasst Frauen. Ich wette, wenn sie mit Crimsons Reisebüro zu tun hat, überschlägt sie sich.«
»Was meinen Tag rettet«, sagte Stoner grinsend, »ist, dass ich ihren ruiniert habe.«
»Ich hab eine Idee. Ruf noch mal an und frag, ob sie mit dir ausgeht.«
»Niemals!«
»Warum nicht?«
»Sie könnte zusagen.« Stoner fasste sich ein Herz und nahm die Post in Angriff. Wie üblich bestand sie fast nur aus Werbebroschüren. Drei neue Ferienhotels auf den Jungferninseln, ein Trans-Amerika-Las-Vegas-in-zwei-Tagen-mit-Flug-und-Mietwagen-Sonderangebot (Frühstück, Casino-Spielchipsund Cocktail auf dem Zimmer inbegriffen) und Annoncen von Weihnachtskreuzfahrten nach Rio. »Das ist ja toll.« Stoner hielt einen Hochglanzprospekt in die Höhe.
»Was?«
»Eine Hundeschlittentour um den Polarkreis.«
Marylou sah auf. »Vielleicht solltest du das ausprobieren?«
»Ist erst im Januar.« Stoner stand auf, um die Ordner wieder in ihren angestammten Lücken zu verstauen.
»Ich war mal in dich verliebt«, sagte Marylou.
Stoner sah sie an. »Du?«
»Während meiner polymorph-perversen Adoleszenz.«
»Marylou, ich hatte keine Ahnung!«
Marylou seufzte. »Es passierte, als ich dich zum ersten Mal sah. Erinnerst du dich an den Abend, als meine Mutter dich zum Essen mit zu uns brachte?«
Stoner erinnerte sich. Sie fand damals, dass es für eine Psychotherapeutin ein ungewöhnliches Verhalten sei. In den vergangenen Jahren war ihr dann klar geworden, dass es für Dr. Kesselbaum nichts Ungewöhnliches gab.
»Himmel, du warst anbetungswürdig«, sagte Marylou. »Die Art, wie du dich an der Tür herumdrücktest, in deinen ausgewaschenen Jeans und dem ollen Hemd, den Blick auf deine mottenzerfressenen Turnschuhe gesenkt.«
»Motten fressen keine Turnschuhe.« Stoner merkte, wie sie rot wurde.
»Und als du schließlich hochsahst, mich mit diesen grünen Augen anblicktest, dachte ich, der Halleysche Komet schlüge in Boston ein.«
Stoner warf mit einer nervösen Bewegung ihre Haare nach hinten.
»Und es ging den ganzen Abend so. Ich weiß noch jedes Wort, das du in dieser Nacht gesagt hast. ›Das ist sehr gut‹ über die Big Macs – glaube ich. ›Nein Danke‹ zu einer zweiten Portion Pommes frites. Und ungefähr dreiundzwanzig Mal ›Tut mir leid‹.« Marylou klopfte mit ihrem Bleistift auf den Schreibtisch. »Weißt du, ich hatte immer den Verdacht, dass Edith uns verkuppeln wollte.«
»Ich dachte, du bist hetero«, sagte Stoner.
»Ja, jetzt. Aber damals galt: Nichts ist unmöglich. Ihr war es egal, in welche Richtung meine Triebe gingen, solange sie nur irgendwohin gingen und dort blieben.«
»Du hast nie irgendwas gesagt.«
Marylou zuckte die Achseln. »Jede, die für zwei Pfennig Verstand hat, kann sehen, dass eine Beziehung mit dir ernst sein muss. Ich war nicht so weit, mich auf so was einzulassen.«
Stoner stand wie ein nicht abgeholtes Gepäckstück mitten im Raum und fragte sich, wohin mit ihren Händen. »Bist du – äh – ich meine, willst du noch …«
»Natürlich nicht, Dummchen. Glaubst du wirklich, ich hätte hier sieben Jahre lang herumgesessen, Tag für Tag, und mich vor Sehnsucht verzehrt? Ich hätte dich längst in den Garderobenschrank gelockt und dir die Kleider vom Leib gerissen!« Sie öffnete einen Umschlag mit einem silbernen Brieföffner. »Mist. Die Stromgebühren sind schon wieder erhöht worden. Jedenfalls sind mir Männer im Bett lieber, weiß der Teufel warum. Willst du eigentlich den ganzen Tag da stehen bleiben?«
Mit glühenden Ohrläppchen huschte Stoner an ihren Schreibtisch zurück und ließ sich auf den Stuhl fallen. »Ich hoffe …«, sagte sie zögernd, »ich habe dich nicht abgeschreckt.«
»Nein, Liebes, du hast mich nicht abgeschreckt. Ich kann genauso wenig für meine sexuellen Vorlieben wie du.« Sie betrachtete Stoner eine Weile. »Weißt du, du hast dich kein bisschen verändert.«
Stoner schleuderte einen Stift in ihre Richtung. Daneben. »Doch, hab ich.«
»Inwiefern?«
»Ich bin älter.«
»Nichts davon zu sehen. Unter diesem fraulichen – und ich möchte betonen, immer noch schrecklich attraktiven – Äußeren schlägt das Herz eines neugeborenen Lämmleins.«
Das ging zu weit. Stoner stand auf. »Ich gehe.«
»Das kannst du nicht. Ich komme zum Abendessen mit zu euch. Tante Hermione hat gesagt, es ginge um einen Notfall. Ich frage mich, welchen Wein man zu einem Notfall reicht.«
Stoners Magen formte sich zu einem Knoten. »Meine Eltern sind hier.«
»Ach, Stoner, du weißt genau, dass sie dich vorgewarnt hätte!«
»Vermutlich.«
»Aber es ist und bleibt seltsam«, sinnierte Marylou. »Deine Tante hat seit 1970, als die Katze diese Bohnen, diese Blue-Runners oder wie sie heißen, gefressen hatte, keinen Notfall mehr ausgerufen.«
»Häh?«
»Weißt du nicht mehr? Das war die Nacht, wo sie mir beibrachte – wenn man es so nennen kann –, wie Mah-Jongg gespielt wird.«
Stoner grinste. »Sie nahm dir zehn Dollar ab.«
»Deine Tante«, verkündete Marylou, »ist eine sehr süße alte Dame. Und sie ist eine Gaunerin.«
Marylou wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Stoner betrachtete sie. Also Marylou war damals in sie verliebt gewesen. Sie fragte sich, was sie getan hätte, wenn sie es gewusst hätte. Stoner seufzte. Sie wusste nur zu gut, was sie getan hätte. Sie wäre geflohen, als ob der Teufel hinter ihr her sei. Zu der Zeit hatte die Tatsache, dass sie lesbisch war, sie mit Horror erfüllt, und das, obwohl ihre Sexualität noch in einem latenten, embryonalen Stadium steckte. Ans Tageslicht gebracht, hätte es sie glatt veranlasst, sich von der Spitze des Bunker-Hill-Denkmals zu stürzen. Jede Form von Sex hatte ihr Angst gemacht. Na ja, um ehrlich zu sein, es machte sie immer noch nervös. Und dann ihre Eltern, ihre Mutter, die entweder auf sie einbrüllte oder sich in hysterischen Nervenzusammenbrüchen erging, ihr Vater, der sie ansah, als sei sie ein schleimiges Etwas, das vom Grund des Ozeans abgekratzt worden war und nun übelriechende Flecken auf dem Wohnzimmerteppich hinterließ … Es half nichts, dass Tante Hermione ihnen vor Empörung schnaubend erklärte, sie sollten lieber froh sein, dass ihre einzige Tochter nicht mit einem ungewollten, illegitimen Kind im Bauch nach Hause gekommen sei, und wie sie das wohl vor den Nachbarn hätten geheim halten wollen, an deren Meinung ihnen ja offenbar weit mehr gelegen sei als am Glück ihrer eigenen Tochter … Aber sie verwiesen Tante Hermione nur darauf, dass diese Tochter ihnen gehöre, nicht ihr, und außerdem erst siebzehn sei, das wolle man doch mal klarstellen, und wenn sie sie unglücklich machen wollten, sei das ihr gutes Recht – um nicht zu sagen ihre Pflicht –, und Hermione solle ihre Nase aus ihren Angelegenheiten heraushalten, und überhaupt, was wisse sie schon, die keine eigenen Kinder habe und nicht mal verheiratet sei, und da sei sowieso irgendetwas faul, und wenn sie wüsste, was gut für sie wäre, würde sie besser bei ihrer Handleserei und ihrem Bohnenzeugs bleiben, denn es gäbe Orte, wo Leute wie sie enden könnten, und das seien nicht gerade Ferienheime, jawohl, und sie solle sich bloß vorsehen … woraufhin Tante Hermione in schallendes Gelächter ausbrach.
Teilweise musste sogar Stoner darüber lachen, nur, wenn sie den Hörer auf die Gabel geschmettert und Tante Hermione abgehängt hatten, war es nicht mehr komisch.
Eines Abends wusste Stoner, dass sie genug hatte. Wenn deine Mutter dir ununterbrochen erklärt, dass du sie krank machst, musst du es entweder irgendwann glauben, oder gehen, oder lernen, es zu ignorieren. Und Stoner war noch nie gut darin gewesen, irgendetwas zu ignorieren. Besonders nicht, wenn es etwas Unangenehmes war – was Dr. Kesselbaum ihr gegenüber ungefähr so ausdrückte, ›das soll keine Kritik sein, Stoner, Liebes‹, aber sie täte gut daran, dafür zu sorgen, dass sie sich in einer wohltuenden Umgebung und unter ihr zugetanen Menschen aufhalte. Doch in jener Nacht knisterte und qualmte die Luft vor Gewalt und nutzlosen Tränen, und Stoner hatte das Einzige getan, was ihr einfiel, ohne zu wagen, darüber nachzudenken. Sie war zu Tante Hermione geflohen.
Sie stopfte in einen alten Rucksack, so viel hineinpasste, und wartete, bis es im Haus still wurde. Starr vor Angst schlich sie die Treppe hinunter, stahl fünfzig Dollar aus dem Portemonnaie ihrer Mutter und stieg in den Bus nach Boston.
An der Bushaltestelle Park Square verließ sie der Mut. Tante Hermione würde sie hassen. Sie war feige, verantwortungslos und undankbar. Sie würde hinausgeworfen oder, noch schlimmer, zurückgeschickt werden. Sie konnte Tante Hermione nicht ins Gesicht sehen.
Zwei Tage lang drückte sie sich in der Stadt herum, schlief auf dem Busbahnhof, starrte durch den herbstgelichteten Park auf die Backsteinfestung ihrer Tante, und der Ausdruck verständnislosen Schmerzes in den Augen ihres kleinen Hundes, als sie ihn sanft ins Haus zurückschob und die Tür zuzog, verfolgte sie. Zu guter Letzt schleppte sie sich hungrig, erschöpft und zermürbt die Stufen hoch und klingelte.
»So«, sagte Tante Hermione. »Na, das wird aber auch Zeit!«
Stoner sah hoch in das weiche, runde Gesicht ihrer Tante, das von wuscheligen grauen Haaren umkränzt war, und brach zusammen. »Bitte, schick mich nicht zurück«, murmelte sie.
Tante Hermione zog sie in eine lavendelduftende Umarmung.
»Sei kein Esel«, sagte sie und wischte mit ihrem Ärmel die Tränen von Stoners Gesicht. »Komm in die Küche. Ich mache uns eine Kanne Tee.«
Stoner kauerte sich im Schneidersitz auf das verschlissene Plaudersofa, das eine Ecke der Küche zierte. Die Morgensonne fiel durch die Spitzengardinen in den Raum und zeichnete feine Licht- und Schattenmuster auf den polierten Dielenboden. Prismen in jedem Fenster warfen Regenbögen an die eierschalfarbenen Wände. Weidengeflochtene Vogelkäfige voller Hängepflanzen hingen an den Türen und über Tisch und Spüle.
»Meine Schwester ist schon immer ein widerliches Aas gewesen.« Tante Hermione wirtschaftete herum und knallte Schubladen und Schranktüren. Sie fand ein paar Dänische Pasteten und schob sie in den Backofen. »Wahrscheinlich ein bisschen altbacken, aber es wird schon gehen. Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?«
»Was? Oh … ich weiß nicht so genau.«
»Zweifellos irgendetwas Ekliges in einem Lokal. Ich sage dir, Stoner, die Zivilisation hat sich von diesem Teil Bostons verabschiedet. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo du, egal ob Tag oder Nacht, ein vollendetes Mahl bekommen konntest. Und mit Stil serviert, verstehst du? Sieh dich doch nur mal um. Blechschüsseln, Pappteller, McDonald’s. Nicht mal ein leidlicher Imbiss. Das Parker’sche Gasthaus ist eine Katastrophe. Kein Wunder, dass die Leute ihr Essen wie Schweine herunterschlingen. Ich habe seit Jahren kein akzeptables Omelette mehr bekommen.«
»Hast du schon mit ihnen gesprochen?«, fragte Stoner ängstlich.
»Ich versichere dir, ich habe mich laut und deutlich und ausgiebig beschwert, mit dem heutzutage üblichen Ergebnis.«
»Was?«
»Ich habe beim Büro des Bürgermeisters angerufen, bei der Kulturbehörde, im Gericht, sogar beim Gouverneur. Ich hätte auch im Schlaf sprechen können, der Effekt wäre derselbe gewesen.« Sie warf einen Seitenblick auf Stoner. »Ach, deine Eltern. Ich sagte, du seist nicht hier. Warst du ja auch nicht, oder?«
»Was haben sie gesagt?«
Tante Hermione stemmte ihre Hände in die Hüften. »Meine Liebe, selbst in meinem Alter sollte niemandem zugemutet werden, was die zu mir gesagt haben. Bitte, erwarte nicht, dass ich es vor deinen zarten Ohren wiederhole!«
Obwohl ihr nicht danach zumute war, musste Stoner lächeln. Ihr stieg der Muskatnussduft der Pasteten in die Nase.
»Soo!« Tante Hermione stürmte zum Backofen und holte die Pastetenröllchen heraus. »Auf geht’s.«
Sie reichte Stoner einen Teller, ein Töpfchen mit Butter und ein Messer. »Tee in einer Minute. Sie sind köstlich. Von einer Klientin. Wunderbare Köchin. Sie bezahlt mich in Kalorien.«
»Wie läuft das Geschäft, Tante Hermione?«, fragte Stoner höflich und versuchte, ihr Essen nicht wie ein Schwein herunterzuschlingen.
»Es boomt. Okkultismus liegt im Trend, deshalb. Plötzlich ist es schick, sich seine Handlinien deuten zu lassen. Ich für meinen Teil bevorzuge seriöse Schüler der Mysterien, nicht diese Eintagsfliegen. Nächstes Jahr wenden sie sich dann wieder ihren fetten Sparkonten zu und wählen die Republikaner. Mein Vater pflegte in solchen Fällen immer zu raten: Schmiede das Eisen, solange es heiß ist.«
Der Kupferkessel begann zu pfeifen. Tante Hermione schippte löffelweise losen Tee in eine vorgewärmte Kanne und goss heißes Wasser hinzu.
»Erdbeer, Minze und Kamille. Du brauchst etwas, was dich kräftigt.«
Stoner errötete. »Ich habe mich seit drei Tagen nicht gewaschen.«
»Schäme dich niemals des Drecks, der dir ehrlich zuteil wurde«, sagte Tante Hermione. Sie musterte Stoner von oben bis unten. »Ein bisschen Schlaf könnte dir auch nicht gerade schaden.« Sie stützte ihre Ellbogen auf den Tisch und nahm ihr Kinn in die Hände. Ihre Augen blickten wachsam wie die eines Spatzes durch die mit Strass verzierte Plastikgestellbrille. »So, nun hast du es also endlich getan. Stoner, ich bin stolz auf dich.«
»Wirklich?«
»Schließlich hat es lange genug gedauert. Selbst ein Hund hätte gemerkt, dass er dieses Horrorhaus verlassen muss. Ich habe Helen nie verstanden, und bestimmt nicht, weil sie zehn Jahre jünger ist als ich. Vermutlich hat sie dich glauben lassen, ich sei ungefähr hundert Jahre älter und sie das Wunder der Menopause. Alles musste immer nach ihrem Kopf gehen, alle um sie herum hatten sich gefälligst danach zu richten, wie es ihr genehm war.«
»Das trifft es in etwa«, sagte Stoner bitter.
»Fieser als Katzenpisse. Ich will gern zugeben, dass es mir Angst gemacht hat, dich zur Frau heranreifen zu sehen. Sie setzte alle Hebel in Bewegung, aus dir eine exakte Kopie ihrer selbst zu machen.« Tante Hermione schüttelte sich. »Ich hab versucht, mit ihr zu reden. ›Helen, wenn du dich so sehr liebst, häng dir das Haus mit Spiegeln voll. Aber lass das Kind in Ruhe!‹«
Sie goss Tee ein und reichte Stoner eine Tasse. »Und dieser Vater, den du da hast. Um es vornehm zu sagen, er würde sich nicht mal trauen, ›Scheiße‹ zu sagen, wenn er den Mund damit voll hätte. Der alte Angus muss sonst wo gewesen sein, als er ihn zeugte.«
Stoner rollte sich in einer Ecke des Plaudersofas zusammen und fühlte sich – versuchsweise – sicher. Tante Hermione reichte ihr ein weiteres Pastetchen.
»Hab ich dir je erzählt«, fragte sie, »wie ich dich mal beim Kartenspiel von ihr gewonnen habe?«
Stoner schüttelte den Kopf.
»Du warst eine Woche alt. Ich überredete sie zu einer Partie Gin-Rommé. Sie liebte es, zu spielen, aber hasste es, zu verlieren. Also mogelte ich und zog sie bis aufs Hemd aus. Nun würde deine Mutter ja selbst einen Pfennig so lange ausquetschen, bis er schreit. Ich ließ sie also verlieren und verlieren und machte ihr dann ein Angebot – zu bezahlen oder dich mir zu überlassen.«
»War sie schockiert?«, fragte Stoner, die selbst ein wenig schockiert war.
»Ihr Schlüpfer fing Feuer! Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, versuchte sie sich herauszuwieseln. ›Spielschulden sind Ehrenschulden‹, sagte ich. Aber ich ließ mich darauf ein, deine Patin zu werden und deinen Namen zu bestimmen. Vielleicht hätte ich hart bleiben sollen.«
»Davon hab ich nichts gewusst«, sagte Stoner.
»Nun, das überrascht mich nicht. Tja, ich nannte dich nach Lucy B. Stone. Ich war eine große Bewunderin von ihr. Helen war weiß vor Wut. Sie hasst Feministinnen, schon immer.«
»Was hat es dich gekostet?«
»Fünfhundert Mäuse.«
Stoner pfiff.
»Es war geschenkt für das Vergnügen, zu wissen, dass sie jedes Mal, wenn sie dich rief, an Lucy B. Stone erinnert wurde.« Tante Hermione setzte eine unschuldige Miene auf. »Hätte ich gewusst, was ich heute weiß, hätte ich auf Gertrude Stein bestanden.«
Stoner sah auf ihre Hände hinunter und wurde rot.
»Ach, sei doch nicht so«, meinte Tante Hermione. »Es wärmt mir das Herz in den langen kalten Winternächten, zu wissen, dass ausgerechnet Helen eine Sappho hervorgebracht hat.« Sie rührte in ihrem Tee herum. »Wir brauchen einen guten Schlachtplan, Stoner. Diese Geschichte wird nicht ganz leicht für uns.«
»Ich möchte dir keine Schwierigkeiten machen, Tante Hermione.«
»Schwierigkeiten! Ich liebe Schwierigkeiten.« Sie warf einen Blick auf ihre Taschenuhr. »Aber jetzt muss ich meditieren gehen. In zwanzig Minuten habe ich eine Klientin.«
»Ich such mir einen Job«, meinte Stoner eifrig. Tante Hermione sah sie streng an. »Das tust du nicht. Morgen gehen wir runter zur Uni und schreiben dich fürs Sommersemester ein. Meine Nichte wird keine Hippie-Aussteiger-Laufbahn einschlagen.«
Stoner fühlte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Und jetzt«, sagte ihre Tante fest, »isst du diese Pastete auf, nimmst ein Bad und ruhst dich aus. Ich brauche den Salon vorne für die Sitzungen. Ansonsten gehört das Haus dir.«
»Danke«, murmelte Stoner. »Ich glaube, ich bleib hier noch ein Weilchen sitzen.«
»Auch gut. Geh nicht ans Telefon.« Sie stand auf, um zu gehen, dann hielt sie inne und drehte sich noch mal um. »Stoner, niemand wird dich zwingen, wieder dahin zurückzugehen. Nie mehr.«
***
Stoner seufzte schwer. Noch vier Wochen bis zum ersten Montag im September, dem Labour Day. Der Countdown lief. Sie machten immer in den letzten beiden Augustwochen Urlaub und krönten ihn unausweichlich mit einer Stippvisite inklusive Abendessen in Boston bei ihrer fahnenflüchtigen Tochter. Vielleicht waren sie ja der Meinung, ein Urlaub ohne Verdruss sei kein Urlaub.
»Ich sollte sie einfach ausladen«, sagte sie laut.
»Vielleicht hilft das«, meinte Marylou. »Wen ausladen?«
»Meine Eltern.«
Marylou sah auf. »Ist es schon wieder so weit? Ich hab noch gar keine Weihnachtskarten besorgt.«
»Du verschickst nie Weihnachtskarten.«
»Wir schicken welche. Geschäft, unser. Du erinnerst?« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Sieh mal, Liebes, warum lässt du mich nicht einfach eine Tour für sie buchen? Ich könnte es so arrangieren, dass man nie wieder etwas von ihnen hört oder sieht.«
»Es würde ja doch nicht klappen.«
»Nach acht Jahren Erfahrung mit dem Verlieren von Gepäck sollten wir doch wohl imstande sein, deine Familie verschwinden zu lassen.«
»Das kann ich nicht«, sagte Stoner. »Ich hätte viel zu viele Schuldgefühle.«
»Du brauchst keinen Finger zu rühren! Sag nur ein Wort zu mir, ich kümmere mich um alles, und wir brauchen es nie mehr zu erwähnen. Ich habe Beziehungen.«
»Mafia?«
»Die Heerscharen der Finsternis erwarten meine Befehle.« Marylou wandte sich wieder ihrem Schreibtisch zu.
Das ist doch alles lächerlich. Normale einunddreißigjährige Frauen verbringen nicht ihre Zeit damit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie sie mit ihren Eltern zurecht- oder von ihnen wegkommen können. Normale einunddreißigjährige Frauen zerbrechen sich den Kopf über Ehemänner (beziehungsweise das Fehlen derselben), Karrieren, Kalorien, Beziehungskrisen, Badezimmereinrichtungen, die Saugkraft der Nässepuffer in Papierwindeln, Doppelkinne, Intimsprays, Schweißgeruch und ungewollte Schwangerschaften.
»Worüber brütest du denn da?«, fragte Marylou.
»Doppelkinne.«
»Hast du eins?«
»Ich glaub nicht.«
»Ich?«
»Nein.«
Marylou seufzte. »Fein, würde es dir etwas ausmachen, dich um diese Bustour nach Tanglewood zu kümmern? Wir haben ihnen Previn versprochen, und was werden sie kriegen? Linda Ronstadt.«
»Vielleicht merkt es niemand.«
»Bei fünfunddreißig Musikliebhabern muss es einer merken.«
Voll Überdruss langte Stoner nach dem Tanglewood-Katalog. »Du bist dir doch im Klaren, was das bedeutet? Es bedeutet fünfunddreißig Telefonate!«
»Sechsunddreißig. Besser, du sprichst erst noch mal mit den Veranstaltern.«
Stoner verglich den Katalog mit ihrem Kalender. »Es ist Previn. Guck!«
Marylou spähte über ihre Schulter. »Das ist der Katalog vom letzten Jahr, Liebes.«
»Gütiger Himmel«, sagte Stoner und warf ihn von sich, »müssen wir denn alles aufheben, was über unseren Schreibtisch geht?«
»Ich nicht, Kumpel. Du bist hier diejenige, die alles fürs Archiv aufbewahren will.«
»Na ja, man kann ja nie wissen.«
Vielleicht hat Marylou recht. Vielleicht ist Verliebtsein das, was ich brauche. Gott weiß, wie sehr ich irgendetwas brauche. Ich bin ruhelos, gelangweilt, entscheidungsunfähig und ein Feigling. Gut, ich war schon immer ein Feigling. Und vielleicht hier und da auch mal ein wenig entscheidungsschwach. Aber nicht so. Oder doch? Herrje, nicht einmal darüber bin ich mir im Klaren.
Zwei Jahre. Das ist nicht sehr lange, oder? Es tut nicht mehr weh. Aber wenn es nicht mehr wehtut, warum will ich mich dann auf keine Frau mehr einlassen? Weil ich keine getroffen habe, auf die ich mich hätte einlassen wollen, ganz einfach. Ich beschließ doch nicht einfach, dass ich mich auf etwas einlassen will, und gehe los und such mir eine aus, wie eine frische Zucchini. Man schreibt nicht einfach »Liebe« auf den Einkaufszettel und saust los zum nächsten Flirtkeller, Himmel noch mal! Ich habe kein Interesse, und damit gut. Das ist doch kein Film hier, das ist das Leben. Und im Leben gibt es ja wohl noch andere Dinge als nur Liebe.
Nenne drei. Also gut, es gibt Arbeit. Sogar Freud hat das zugegeben. Liebe und Arbeit. Und es gibt … es gibt … es gibt … die Red Sox. Red Sox! Ich finde Baseball nicht mal amüsant! Der drohende nukleare Holocaust. Na also, das ist doch etwas, worin ich wirklich verstrickt werden könnte. Ha, es macht einen richtig froh, am Leben zu sein, wenn man daran denkt.
Worein ich mich jetzt wirklich verstricken sollte, ist Linda Ronstadt in Tanglewood. Sechsunddreißig Telefonate? So schlimm kann es nicht werden. Nichts könnte so schlimm werden. Oder doch?
***
»Jetzt reicht’s«, sagte Marylou mit Nachdruck. »Wir machen den Laden dicht für heute.«
Stoner sah auf. »Wie spät ist es denn?«
»Viertel nach drei.« Marylou schloss den Wachspapierdeckel der Schachtel ihrer Dreischicht-Biskuittorte mit dem Ausdruck der Endgültigkeit.
»Das können wir nicht machen.«
»Wir sind selbständig.«
»Warum?« Stoner ging zu Marylous Schreibtisch hinüber und pappte den zugeklappten Deckel mit einem Stück Klebeband fest.
»Weil wir mit niemand anders auskommen.« Marylou starrte die Schachtel an. »Herr im Himmel, du hast aber auch einen Perfektionstick.«
»Warum machen wir zu?«
»Du brütest. Das ist schlecht fürs Geschäft. Man erwartet von uns, dass wir hemmungslosen Spaß und die Romantik des Reisens in ferne Länder versprühen.«
»Du kannst mir viel erzählen. Ich weiß nicht mal, wann du zum letzten Mal außerhalb der Stadt warst.«
»1973 war ich oben am Kap.«
»Unter Zwang.«
»Nein, mit dem Bus.«
»Du besuchst nicht mal deine Mutter, dabei sind es nur zwei Stunden bis Wellfleet.«
»Reisen«, sagte Marylou bedeutungsvoll, »ist geschmacklos. Wenn du es schick findest, von Sandflöhen durchgekaut zu werden, besuch du doch meine Mutter.«
»Du siehst deinen Vater von April bis Oktober nicht.«
Marylou fegte die Krümel von ihrem Schreibtisch. Einige davon schafften es, im Papierkorb zu landen. »Max ist vollständig glücklich mit seinen Seealgen und seinen organischen Düngemitteln.«
»Seealgen sind organische Düngemittel.« Stoner warf einen finsteren Blick auf die Krümeln am Boden. »Willst du sie da liegen lassen? Vielleicht locken sie Ratten an.«
»Prima!«, rief Marylou. »Ratten wären angenehmere Gesellschaft als du.« Sie griff nach Stoners Hand. »Meine liebe alte Freundin«, sagte sie sanft, »du weißt, wie gern ich dich hab. Aber deine Launen sind grauenhaft.«
Stoner ließ den Kopf hängen. »Tut mir leid.«
»Was ist denn los mit dir?« Sie wartete einen Moment. »Los, raus damit, Stoner.«
»Ich … ich hab Angst.«
»Wovor?«
»Was, wenn sie nun hier sind?«
»Deine Eltern?«
Stoner nickte.
»Ach, Liebes, sie können dir doch gar nichts tun. Du bist über einundzwanzig!«
»Und eine missratene Aussteigerin.«
»Du bist keine Aussteigerin«, sagte Marylou bestimmt. »Die Kesselbaums lassen sich nie mit Aussteigerinnen ein.«
Stoner musste lachen. »Ihr Kesselbaums seid doch selber geborene Aussteiger.«
»Genau deswegen lassen wir uns nicht mit Aussteigerinnen ein«, sagte Marylou und schloss ihre Schreibtischschublade ab. »Das wäre zu viel des Guten, man muss irgendwo Grenzen setzen.« Sie ließ den Schlüssel in ihre Brieftasche gleiten. »Kommst du, oder soll ich dich hierlassen, um den Nachtwächter zu erfreuen?«
***
Sie erreichten das alte Haus oberhalb des Parks. Die Luft hing über der Stadt wie regungsloses Wasser. Selbst der Verkehr wirkte beklommen. Ahorn- und Buchenblätter ließen sich erschöpft von den Zweigen fallen. Auch die Tauben regten sich kaum, führten gurrend Selbstgespräche, während sie halbherzig an den Rissen im Pflaster herumkratzten. Am Fuß der Treppe gefror Stoner zur Salzsäule.
»Sie sind hier. Ich weiß es.«
»Tante Hermione würde dir das nicht antun«, sagte Marylou.
»Vielleicht blieb ihr nichts anderes übrig?«
»Wenn das der Fall ist, machen wir vielleicht besser, dass wir reinkommen, denn dann haben sie sie wahrscheinlich gefesselt und geknebelt im Garderobenschrank verstaut.«
Verängstigt, elend und mit dem Gefühl, sich vollends lächerlich zu machen, setzte sich Stoner auf die unterste Treppenstufe. »Ich hasse mich.«
»Warum?«
»In meinem Alter Angst vor meinen Eltern zu haben.«
Marylou glättete ihren Rock, der es fertiggebracht hatte, sich in Wülsten um ihre Taille zu rollen. »Na ja, sie können ziemlich scheußlich sein. Ich persönlich weiß nicht recht, warum du dich jedes Mal dazu überreden lässt, mit ihnen essen zu gehen, wenn sie sich dazu herablassen, einen Abstecher in die Großstadt zu machen.«
Stoner fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Sie würden einen Riesenaufstand machen, wenn ich mich weigern würde.«
»Soweit ich diese Mahlzeiten nach deiner Beschreibung beurteilen kann, verlaufen sie auch nicht gerade idyllisch.«
»Du hältst mich bestimmt für fürchterlich feige?« Stoner wagte nicht aufzusehen.
»Stoner, ich habe eine Mutter, die Gerüchten zufolge eine Psychoanalytikerin von ziemlicher Bedeutung ist. Sie fährt einen weißen Lincoln Continental mit Faltdach, tankt nur an freien Selbstbedienungstankstellen, um Pfennigbeträge zu sparen, und müllt das ganze Haus mit Plastikverpackungen aus Schnellrestaurants voll. Mein Vater ist so sanftmütig, dass er Depressionen bekommt, wenn er Unkraut zupfen muss, obwohl sonst in den Beeten nichts mehr wachsen könnte. Und das einzige Lebensziel meiner Schwester besteht darin, weiterhin friedlich in ihrem Bungalow auf Hawaii vor sich hin zu leben, mit ihren vier Kindern, die nicht wissen, was es bedeutet, wenn man Kleidung tragen muss, und mich mit Kona-Kaffee und Schotternüssen zu versorgen.« Sie zuckte die Achseln. »Was weiß ich denn darüber, wie es ist, vor seiner Familie Angst zu haben?«
Stoner schwieg.
»Als du vorigen April mit ihnen essen warst, kamst du anschließend nach Haus und betrankst dich bis zur Besinnungslosigkeit. Und die folgenden drei Tage hast du dann damit verbracht, wie ein verlorenes Kalb herumzulaufen und dich permanent dafür zu entschuldigen, dass du überhaupt existierst. Davon ausgehend kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass sie keine liebenswerten Leute sind.«
»Sie haben versucht, Tante Hermione ins Gefängnis zu bringen, weil sie mich aufgenommen hat.«
»Ich weiß.«
»Sie hätten es beinahe geschafft, mich in eine Irrenanstalt zu stecken. Wenn deine Mutter nicht gewesen wäre …«
Marylou packte sie an den Schultern und schüttelte sie. »Stoner, jetzt hör mir mal zu. Das ist lange her. Sie haben es damals nicht geschafft und hätten heute nicht die geringste Chance. Sie können dafür sorgen, dass du dich mies fühlst, aber sie können nicht mehr in dein Leben eingreifen.«
Stoner sah zu ihr hoch und seufzte. »Tut mir leid.«
»Los jetzt«, sagte Marylou und zog sie hoch. Sie schob Stoner vor sich her die Stufen hinauf. »Oh, Scheiße«, murmelte sie, »ich hab den Wein vergessen.«
***
Stoner kochte Kaffee, während Marylou den Brotkasten durchstöberte. »Ich fürchte, es ist nicht viel da«, erklärte Stoner. »Mrs. Bakhoven ist im Urlaub.«
»Wie rücksichtslos von ihr«, sagte Marylou und ging zum Kühlschrank über.
»Tante Hermione hat ihr geweissagt, sie werde eine große Reise machen, also macht sie eine.«
»Ach, es kann nur besser werden als das, was ich zu Hause hab. Mutter kam voriges Wochenende runter und bombardierte mich mit all dem Zeug, was sie im Laufe des vorigen Sommers eingekocht hat.« Marylou hatte ein übriggebliebenes Stück Kirschtorte ergattert und trug es triumphierend zum Tisch. »Weißt du, was ich an deiner Tante liebe? Auf sie ist Verlass.«
Stoner goss Kaffee ein und setzte sich hin. »Wenn der Notfall nicht meine Eltern sind, was ist es denn?«
»Hat sie nicht gesagt.«
»Hast du sie nicht gefragt?« Sie begann, eine Art Kälte auf der Innenseite ihrer Gesichtshaut zu verspüren, ein sicheres Zeichen aufkommender Panik.
»Nun, offenbar ist es nicht so ernst, dass es nicht bis zum Abendessen warten könnte.«
»Bis nach dem Abendessen. Wir besprechen nie etwas während des Essens. Sie sagt, das wirft die Elektrolyten aus dem Gleichgewicht.«
»Wahrscheinlich tut es das«, meinte Marylou.
Tante Hermione schoss durch die Schwingtür herein, ihre Perlenketten und Armbänder klingelten. »Rasch«, rief sie laut, »Kaffee!« Sie warf sich auf das Plaudersofa, und Stoner stand auf, um eine Tasse zu holen. »Hast du frischen gemacht, Stoner?«
»Ja.«
»Die Thermoskanne ist noch voll.«
»Oh«, sagte Stoner etwas betreten. »Daran hab ich nicht gedacht.«
Marylou wedelte mit der Gabel durch die Luft. »Tante Hermione, du solltest diese Dinger nicht benutzen. Sie sind barbarisch. So was stellen sie immer in Motelzimmern auf.«
»Woher willst du denn das wissen?«, fragte Stoner.
»Ja, ich weiß«, sagte Tante Hermione. »Aber diese hier kam eines Tages mit der Post. Ich hatte sie natürlich nicht bestellt. Ich würde nie so ein hässliches Ding bestellen, am allerwenigsten in einem Versandhaus. Aber es kam einfach. Also dachte ich, vielleicht ist es ein Zeichen.«
Stoner hielt es nicht länger aus. »Meine Eltern sind hier, ja?«
»Oh, mein Gott«, sagte Tante Hermione, »ich dachte, wir würden sie wenigstens ein halbes Jahr nicht zu Gesicht bekommen, und es ist doch erst« – sie zählte an den Fingern rückwärts bis April – »vier Monate her!«
»Ich dachte, das sei der Notfall«, sagte Stoner. »Ich dachte, sie sind hier.«
Tante Hermione starrte sie ungläubig an. »Hier? In diesem Haus? Also wirklich, Stoner!«
»Sie hat heute einen schlechten Tag«, sagte Marylou.
»Vermutlich prämenstruelle Spannungen. Ich danke den Göttern für die Menopause.«
»Ich glaube, was sie braucht, ist eine Liebesaffäre«, verkündete Marylou.
»Marylou …«, sagte Stoner warnend.
»Aber, Marylou, was für eine absolut entzückende Idee! An wen hast du dabei gedacht?«
Stoner rubbelte sich verzweifelt mit beiden Händen das Gesicht. »Ich brauche keine Liebesaffäre. Ich hatte nur Angst, meine Eltern wären hier. Ich hatte Angst, du hättest sie zum Abendessen eingeladen.«
Tante Hermione wechselte einen Blick mit Marylou. »Weißt du, Marylou, manchmal fürchte ich, Stoner ist ein wenig … angeschlagen. Hat deine Mutter jemals von der Möglichkeit eines Gehirnschadens gesprochen?«
»Tante Hermione«, presste Stoner zwischen den Zähnen hervor, »was ist der Notfall?«
»Du wirst es abwarten müssen.« Ihre Tante hob erzieherisch einen Zeigefinger in Stoners Richtung. »Es hat mit einer Klientin von mir zu tun, Eleanor Burton. Ich finde, sie sollte es selbst vorbringen.«
»Ach«, Stoner fühlte, wie der Druck von ihr wich und sich ihr Körper entspannte. »Ist es die Person, die gerade bei dir war?«
Tante Hermione stieß einen Seufzer des Überdrusses aus. »Nein, das war ein Neuer. Ein junger Mann. Sehr bemüht, sehr offen und sehr, sehr mystisch. Aber die ödesten Handlinien, die ich je gesehen habe. Dieser Junge hat ein Leben vor sich, das selbst einen Buchhalter langweilen würde. Meine Vorstellungskraft ist bei ihm völlig überfordert.«
»Nimm etwas Kirschtorte«, sagte Marylou teilnahmsvoll.
»Nein danke, Liebes, sie ist nicht mehr frisch genug, um daraus zu lesen.«
Marylou ließ ihre Gabel fallen und griff sich an die Kehle. »Ich bin vergiftet!«
Stoner lachte. »Sie ist in Ordnung. Ich hatte etwas davon zum Frühstück.«
»Äääh«, sagte Marylou, »ihr seid widerlich.«