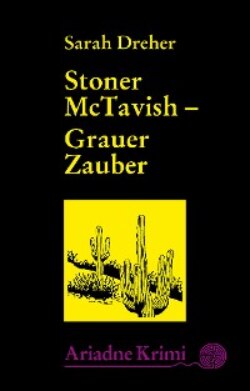Читать книгу Stoner McTavish - Grauer Zauber - Sarah Dreher - Страница 7
Kapitel 2
ОглавлениеNach abschließender Zählung waren auf dem Sky Harbor-Flughafen von Phoenix, Arizona Mitte August um zwölf Uhr mittags achthundertneunundfünfzig Reisende ohne Sonnenbrille aus einer Trans-Continental Airlines-Maschine gestiegen. Niemandem ist das je zweimal passiert.
Mitte August um zwölf Uhr mittags lässt die Wüstensonne einen Schauer silberner Nadeln herabregnen. Der Himmel brennt weiß. Die Gebirge, die die Stadt umgeben – Maricopas, White Tanks, Superstitions – werden zu flachen, staubigen, zweidimensionalen Hügeln. Wüstenpflanzen erbleichen. Alle kriechenden, krabbelnden und sich ringelnden Geschöpfe kapitulieren vor der Hitze, verbergen sich. Die Luft flimmert am Horizont und fließt in trägen Schwaden über den Asphalt des Flughafens. Reifen werden weich. Der Geruch von schmelzendem Teer liegt schwer über dem Boden. Glitzersterne aus Licht prallen von beweglichen Glas- und Chromoberflächen. Die Bewohner von Phoenix drängen sich in ihren Wohnungen um die Klimaanlage und warten auf die Zeit der langen Schatten.
Der Sky Harbor-Flughafen von Phoenix, Arizona ist Mitte August um zwölf Uhr mittags eine weißglühende Hölle.
Stoner zuckte zurück. Die Muskeln rund um ihre Augen verkrampften sich. Ihre Pupillen schmerzten. Sie tastete sich stolpernd zu einem Sessel in der Wartehalle und setzte sich. Rings um sie ergoss sich ein stetiger Strom von beweglichen dunklen Umrissen. Ich bin blind, dachte sie. Geblendet. Blinded by the Light, hallelujah.
Na ja, auch wenn sie selbst nichts sehen konnte, Stell würde sie sehen. Aber niemand trat aus den Schatten hervor. Stoner kaute nervös auf ihrer Unterlippe.
Vielleicht will sie uns gar nicht hierhaben.
Vielleicht haben wir den falschen Tag erwischt.
Oder den falschen Flughafen.
Was ist, wenn sie sich gar nicht blicken lässt?
Oder wenn sie draußen wartet?
Nein, sie sagte drinnen. Drinnen, im TCA-Warteraum. Ich bin sicher, dass sie das gesagt hat.
Vielleicht hat TCA zwei Warteräume.
Blödsinn, Fluglinien haben keine zwei Warteräume.
Fluglinien haben Dutzende von Warteräumen. Habe ich ihr die richtige Flugnummer gegeben? Sei nicht albern, wenn sie mich verpasst, lässt sie mich eben ausrufen.
Vielleicht sollte ich sie ausrufen lassen.
Sie machte sich daran aufzustehen.
Aber ich müsste ein Telefon finden, um sie ausrufen zu lassen, und in der Zwischenzeit könnte sie auftauchen und denken, dass sie sich geirrt hat, und weggehen.
Sie setzte sich wieder hin.
Ich hätte alles selbst organisieren sollen. Ich hätte es nicht Marylou überlassen sollen. Ich hasse es, wenn andere Leute meine Reise organisieren. Ich meine, woher soll ich wissen, ob sie keinen Mist gebaut haben? Wenn ich Mist baue, habe ich wenigstens eine ungefähre Ahnung davon, an welchem Punkt Mist passiert ist. Ich bringe Daten und Zeiten durcheinander. Verbindungen und Zielorte bringe ich nicht durcheinander. Wenn ich alles selbst reserviert hätte und Stell sich nicht blicken ließe, würde ich wissen, dass ich den falschen Tag oder die falsche Zeit erwischt habe, aber am richtigen Ort bin. Was mehr ist, als ich jetzt weiß.
Marylou sagt, wenn Reiseveranstalterinnen ihre eigenen Reisen buchen, ist das, wie wenn Psychotherapeuten Familienmitglieder und enge Freunde behandeln. Oder wie wenn Rechtsanwälte sich in einem Prozess vor der Anwaltskammer selbst vertreten. Marylou sagt …
Marylou verreist nie. Marylou hasst reisen.
Offensichtlich verfügt Marylou über eine Erkenntnis, die ich nicht habe und die ich mir partout auf die harte Tour aneignen muss.
»Hol’s der Teufel«, sagte eine vertraute Stimme, »du hast besorgt ausgesehen, als ich dich das letzte Mal sah, und du siehst immer noch besorgt aus.«
Sie blinzelte in das gleißende Licht. »Stell?«
»Jedenfalls nicht Dale Evans.« Ein langer dünner Schatten pflanzte sich vor ihr auf, die Hände in den Hüften, und lachte. »Ich könnte wetten, du hast allen Ernstes geglaubt, ohne Sonnenbrille durchzukommen.«
»Ja«, sagte Stoner mit einem schiefen Grinsen, »hab ich.«
»Schön, lässt du dich jetzt endlich umarmen? Oder willst du da sitzen bleiben und mir das Herz brechen?«
Zu ihrer großen Verlegenheit fühlte sie, wie ihr die Tränen kamen. »Gott, ich hab dich so vermisst«, sagte sie und warf ihre Arme um die ältere Frau.
»Ich dich auch, Kleines.« Stell drückte sie an sich. »Hab schon gedacht, ihr kommt nie an.«
Stoner legte den Kopf an ihre Schulter. »Du duftest immer noch nach frischem Brot.«
»Das sollte ich wohl. Ich backe es schließlich.« Sie hielt Stoner ein Stück von sich weg und besah sie sich von oben bis unten. »Du bist so ziemlich die Alte geblieben. Wo ist deine Liebste?«
»Sammelt die Koffer ein. Sie kommt dann nach draußen.«
Stell griff nach Stoners Handgepäck. »Dann können wir uns ja Zeit lassen. Was du an Reisezeit einsparst, verlierst du wieder, wenn du auf dein verstreutes Gepäck wartest.« Sie ging voran Richtung Ausgang. »Hoffe, du hattest dich nicht zu sehr auf Timberline gefreut. Diesen Sommer geht alles ein bisschen drunter und drüber.«
»Mir macht das nichts. Ich war noch nie in der Wüste.«
»Ich muss zugeben«, sagte Stell, während sie mit langen Schritten weiterging, »es gab in den letzten vier Wochen Augenblicke, in denen ich meinen rechten Arm für eine Lungenfüllung Wyoming-Luft gegeben hätte. Aber Familie ist Familie, und du tust, was du musst.« Sie trat zurück, um Stoner als Erste durch die Tür gehen zu lassen. »Vorsicht. Diese Sonne ist mörderisch.«
Ein Schwall sengender Luft warf sie fast um. »Himmel!«
»Heiß genug, um Farbe zum Kochen zu bringen«, sagte Stell. »Bleib dicht bei mir, bis ich den Wagen gefunden habe. Wenn du auf dem Parkplatz verloren gehst, bist du in zehn Minuten krankenhausreif.«
Die Hitze des Pflasters brannte sich durch die Sohlen ihrer Schuhe. Sie blinzelte in die Sonne und schnappte nach Luft. »Das ist ja unfassbar.«
»Man gewöhnt sich dran.« Stell schlängelte sich durch die parkenden Autos hindurch. »In Spirit Wells hilft die Höhe. Tagsüber lässt du dir das Gehirn backen, aber du hast wenigstens die Garantie, dir nachts den Hintern abzufrieren.«
»Spirit Wells? Ich dachte, die Handelsstation wäre in Beale.«
»Beale ist das nächste Postamt. Spirit Wells war vor rund hundert Jahren irgendeine Art von Siedlung, und niemand weiß, warum sie es Geisterbrunnen nannten. Vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Ich jedenfalls hab bisher keine Spur von Städten oder Geistern oder Brunnen gesehen.« Sie blieb neben einem hellbraunen, rostigen, staubüberzogenen Chevy-Lieferwagen stehen, der schon bessere Tage gesehen hatte, allerdings vor sehr langer Zeit.
Stoner fasste nach dem Türgriff.
»Moment!« Stell schob schnell ihre Hand weg. Sie nahm ein großes Taschentuch aus ihrer Hosentasche. »Nimm das. Metall wird verdammt heiß hier draußen.«
»Alles ist heiß hier draußen.« Sie zog mit einem Ruck die Tür auf und ließ die stehende Luft herausfallen.
Stell schwang sich hoch auf den Fahrersitz und kramte im Handschuhfach. »Nimm die«, sagte sie und drückte ihr eine zerkratzte, angeschlagene Sonnenbrille in die Hand. »Sie ist nicht gerade schick, aber sie wird dir die Netzhaut retten.«
Stoner setzte die Brille auf und seufzte vor Erleichterung. »Wie geht’s deiner Cousine?«
»Scheint etwas besser zu sein«, sagte Stell, während sie den Motor anließ. »Sie wissen immer noch nicht, was mit ihr los ist. Fürchterliche Sache, sie schien von einem Tag auf den anderen auszutrocknen. Wär ja auch kein Wunder, bei dem Klima. Bis auf den Umstand, dass Claudine und Gil die Handelsstation seit über dreißig Jahren haben, und Claudines Familie schon vorher. Die Sommer in Arizona sind nicht gerade was Neues für sie.«
Sie prügelte den Rückwärtsgang rein, setzte zurück, wobei sie nur knapp einen gelben Mercedes verfehlte, und fuhr langsam auf die Rampe zu.
»Es gibt Gerüchte, dass oben im Norden der Reservation die gleiche Sorte Krankheit umgeht, was irgendeine Art Strahlung vermuten lässt. Vor allem, weil Anaconda und Kerr-McGee die Uranschlacke aus den Minen unter freiem Himmel abladen. Aber sie haben Claudine daraufhin untersucht und nichts gefunden. Tatsache ist, sie haben von Leukämie bis Extrauterinschwangerschaft absolut alles getestet – wobei Letzteres in ihrem Alter ein mittleres Wunder wäre.«
»Vielleicht ist es das Wasser«, überlegte Stoner. »Oder sogar das frische Gemüse. Wenn in dem Boden hier draußen irgendwas fehlt …«
»Nicht sehr wahrscheinlich. Gil zeigt keine Symptome. Jedenfalls haben sie sie zur Beobachtung dabehalten. Eine ziemlich hochgestochene Art zu sagen, dass die Ärzte nicht weiterwissen und einen schon mal bezahlen lassen, während sie’s rausfinden.«
Sie schnitt einem Flughafentaxi den Weg ab und blieb im Parkverbot stehen.
»Wer kümmert sich um Timberline?«, fragte Stoner.
»Ted junior und sein Schatz.« Stell lachte. »Ich bin sehr gespannt, wie gewisse Stammgäste damit klarkommen. Na ja, es dürfte die Spreu vom Weizen trennen.«
»Oh … magst du seinen Schatz?«
»Bis jetzt schon. Rick scheint ein netter junger Mann zu sein.« Sie warf Stoner einen wissenden Blick zu. »Hör auf, das Terrain zu sondieren. Du weißt genau, dass ich das völlig in Ordnung finde.«
»Tut mir leid. Wir hatten in letzter Zeit unsere Probleme.«
»Klar.« Stell tauchte auf dem Boden hinter dem Sitz nach einem Cowboyhut und setzte ihn auf. »Und, wie steht’s inzwischen?«
Stoner zuckte die Schultern. »Geht so. Gwen scheint nicht zu wissen, was ihr nächster Zug sein sollte. Ich glaube, sie hofft auf eine Versöhnung, aber bis jetzt hat sie noch nichts von ihrer Großmutter gehört. Es muss sie scheußlich bedrücken, aber das ist bei ihr manchmal schwer zu sagen. Sie ist besser im Verdrängen als ich.«
»Wahrscheinlich ganz gut, dass sie mal rauskommt. Hilft ihr vielleicht, die Dingen in neuem Licht zu sehen.« Sie trommelte mit den Fingern aufs Lenkrad. »Wie viel weiß ich offiziell? Ich will mich nicht gleich ins Fettnäpfchen setzen.«
»Sie weiß, dass ich’s dir erzählt hab. Das geht in Ordnung.«
»Ich könnte den unwiderstehlichen Drang haben, meine Meinung zu äußern.«
Stoner lächelte. »Deine Meinung ist immer willkommen.«
»Sag das mal meinem ewigliebenden Gatten. Er darf meine Meinung schon seit fünfunddreißig Jahren über sich ergehen lassen.«
Wenn Gwen nicht bald auftaucht, dachte sie, ist von uns nichts mehr übrig als Fett und Knochen. Das Führerhaus des Lastwagens fühlte sich an wie ein Hochofen.
»Macht es dir Spaß, hier den Laden zu schmeißen?«, fragte sie.
»Es ist eine Herausforderung.« Stell öffnete ihre Tür und streckte ein Bein auf dem Trittbrett aus. In dieser Pose sah sie ein bisschen wie eine in die Jahre gekommene Rodeo-Queen aus. »Die meisten Indianer vertrauen uns genug, um weiterhin dort zu kaufen, schließlich sind wir mit Gil und Claudine verwandt, und Verwandtschaft zählt viel bei ihnen. Aber es ist schwer zu vergessen, dass wir sichtbare Vertreter einer Rasse sind, die sie seit vierhundert Jahren fürchterlich bescheißt. Das macht einen wohl übervorsichtig und übersensibel.« Sie warf Stoner einen Blick zu. »Warum erklär ich Idiotin dir das eigentlich? Du weißt, wie es ist, gehasst zu werden, ohne dass du was dafür kannst.«
»Ach, Stell, ich bin froh, dass wir uns entschlossen haben zu kommen. Es wird Gwen guttun, mit dir zusammen zu sein.«
Stell johlte. »Das ist das erste Mal, dass mir jemand einen guten Einfluss auf die Jugend zutraut.« Sie lugte unter der Krempe ihres Hutes hervor und wedelte mit dem Daumen in Richtung des Schalters. »Dreh dich nicht um. Jetzt gehen die Ferien richtig los.«
Gwen kam rückwärts durch die Tür, schwankend unter dem Gewicht ihres Gepäcks.
Stoner hechtete aus dem Wagen.
»Himmel!«, rief Stell. »Muss wohl Liebe sein.«
Gwen ließ einen Koffer fallen und hielt sich die Hand über die Augen. »Die wollen uns umbringen!«, keuchte sie. »Hallo, Stell.«
»Selber hallo. Komm, quetsch dich neben mich. Eng, aber besser, als hinten in der Sonne zu sitzen.«
Stoner warf die Koffer auf die Ladefläche. »Soll ich die festbinden?«
»Allerdings. Wir haben noch ein ordentliches Geholper vor uns bis Spirit Wells.«
Stoner sicherte die Koffer und kletterte auf den Sitz neben Gwen. Gwen langte rüber und wackelte an ihrer Sonnenbrille. »Ganz schön kerlig.«
»Lass das«, sagte Stoner und gab ihr einen Klaps auf die Hand.
Stell knallte ihre Tür zu, drehte die Klimaanlage voll auf und brachte den Motor auf Touren. »Haltet euch an euren BH-Trägern fest, Mädels. Es geht los.«
»Wie weit ist es?«, fragte Gwen, als Stell über die Rampe hinausholperte.
»Ungefähr dreihundertfünfzig Kilometer Luftlinie. Wir sind am späten Nachmittag zu Hause.«
Stoner rechnete. »Dreihundertfünfzig Kilometer – das sind fast vier Stunden.«
»Mehr oder weniger. Wir haben hier draußen eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich muss in Beale noch schnell was einkaufen. Dauert nur ’ne Minute.«
»Toll«, sagte Gwen, »dann werd ich mir noch einen niveaulosen Schmöker besorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so was bei euch gibt.«
»Auf keinen Fall. Wir lesen hier draußen nur die Großen Werke der Westlichen Welt.«
Wolkenkratzer, Monolithe aus Beton und Glas, säumten die Straße in hässlicher Nüchternheit. Familienkutschen und Taxis wälzten sich zentimeterweise auf die Ampeln zu, die Motoren knurrten Drohungen, die Fahrer tauschten finstere, feindselige Blicke. Fußgänger liefen im Zickzack hindurch. Teenager jagten mit wilder und lebensgefährlicher Hingabe auf Skateboards vorbei. Busse verpesteten die Luft. Nur gelegentlich unterbrach ein Fleckchen Rasen, ein Stück Kolonial- oder viktorianische Architektur die Eintönigkeit und ließ einen Hauch von Atmosphäre aufblitzen.
»Was ist euer erster Eindruck?«, fragte Stell.
»Es ist sehr sauber«, sagte Stoner höflich.
Stell lachte. »Ich werd euch Phoenix erläutern: Fünf von den sechs höchsten Gebäuden der Stadt sind Banken. Das sechste ist das Hyatt Regency-Hotel.«
»Das ist alles, was du weißt?«, fragte Gwen.
»Das ist alles, was ich wissen muss.« Sie bremste vor einer roten Ampel und kurbelte rasch das Fenster herunter, um die sich trotz der Klimaanlage sofort stauende Hitze herauszulassen.
Das ist also Arizona. Puebloland. Viehland. Goldland. Indianerland. Kaktusland.
Die einzigen Pueblos, die sie sehen konnte, waren fünfzehnstöckige Wohnhäuser. Es gab kein Vieh, das zum Markt getrieben wurde, nur teure Autos mit angeberischen Spezialnummernschildern. Die einzigen Indianer waren zwei kleine Kinder in Faschingsmontur. Und anstelle von Kakteen gab es Palmen, die so künstlich aussahen wie Requisiten für ein Zwanziger-Jahre-Musical.
Sie beobachtete die Leute, die vor dem Lieferwagen die Straße überquerten. Beliebige Leute in einer beliebigen Stadt – ein bisschen abgestumpft, als wollten sie lieber nicht zu viel sehen oder hören oder denken. Als hätten sie es irgendwie geschafft, sich selbst zu löschen. Auf einer Typische-Großstadt-Skala von eins bis zehn würde sie Phoenix eine Sieben geben.
Das ist provinziell, wies sie sich zurecht. Es gibt Tausende, vielleicht Millionen von Menschen, die Großstädte wirklich mögen. Die es genießen, oder zumindest nichts dagegen haben, Schlange zu stehen. Die in Lärm und Hektik aufblühen. Deren Vorstellung von der Hölle ein kleines Kaff ohne 24-Stunden-Supermärkte ist.
»Stoner«, sagte Gwen, »du knirschst mit den Zähnen.«
»’tschuldigung.«
»Wird dir schlecht?«
»Ich hoffe nicht.«
»Willst du noch ein Dramamin?«
Sie schüttelte den Kopf. Zu wenig Schlaf, sie konnte kaum noch klar denken. Zum Teufel mit Marylou. Kein normaler Mensch würde freiwillig um vier aus dem Bett stolpern, sich um fünf mit dem Logan Airport anlegen, dann den halben Kontinent und drei Zeitzonen überfliegen, um sich von Flugzeugmahlzeiten und der Mittagsstunde in Phoenix drangsalieren zu lassen – und dabei noch versuchen, die Landschaft zu genießen. ›Nimm den Tag noch mit‹, also wirklich. Wenn mal wieder ein Tag mitzunehmen war, konnte Marylou Kesselbaum ihn gerne selbst aufsammeln.
»Was gibt’s Neues in Boston?«, fragte Stell, als sie durch einen Vorort Richtung Norden fuhren. Spanische Adobeziegelhäuser mit roten Dächern, rasensprengergrünen Vorgärten, wartenden Grillstellen und Kühlschränken voll eiskaltem Weißwein.
»Tante Hermione ist in die Hexenrunde aufgenommen worden. Sie haben ihr den Nachweis in Kräuterheilkunde schließlich erlassen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie schafft sie es nicht, die Kräuter auseinanderzuhalten.«
»Sie hat aber niemanden vergiftet, oder?«
»Noch nicht«, sagte Gwen.
»Na, das ist doch mal ’ne gute Nachricht.«
»Im Reisebüro herrscht Saure-Gurken-Zeit. Marylou ist jetzt in einer Selbsthilfegruppe gegen Diskriminierung von Dicken.«
»Marylou ist eine Inspiration für uns alle«, sagte Stell.
»Jetzt führen wir eine Liste von Unterkünften, in denen Dicke diskriminiert werden, und buchen dort prinzipiell nicht mehr.« Sie lachte. »Mit Marylous und meinen politischen Überzeugungen zusammengenommen katapultieren wir uns irgendwann einfach aus dem Geschäft.«
»Also«, sagte Stell, »solltest du feststellen, dass ich in Timberline irgendwas falsch mache, wäre ich dankbar für einen Hinweis.«
»Glaub mir«, sagte Stoner, »an deiner Küche ist nichts Unterdrückerisches.«
»Bis auf den Salat«, sagte Gwen, »du dürftest wohl den jämmerlichsten Salat der Welt servieren.«
Stell brummte. »Sag das unserem Lieferanten. Ich versuche seit Jahren, ihn zu fassen zu kriegen. Ich werde den Verdacht nicht los, dass sie das Zeug in Laramie auf ein Nebengleis schieben und ein, zwei Wochen rumliegen lassen. Hab schon überlegt, selbst welchen anzubauen, aber irgendwie liegt mir Gärtnern nicht.«
Sie überquerten ein trockenes Flussbett und waren plötzlich in der Wüste. Hier und da klammerte sich etwas Grünholz oder ein Kreosotbusch am steinigen Boden fest. Saguaro-Kakteen ragten hoch wie dornige Telefonmasten. Gelblich braune Felsblöcke, verwittert vom Wind und bar jeder Vegetation, reckten sich einem endlosen Himmel entgegen.
»Dies ist die Salt River-Indianerreservation«, sagte Stell. »Pima und Maricopa. Die Pima waren ein wilder Stamm. Jetzt leben sie Tür an Tür mit dem reichen weißen Gesindel, und es gibt kein bisschen Ärger. Das zeigt, wie man ihnen den Schneid abgekauft hat.« Sie wies auf das trockene Flussbett. »Dieser verdorrte Schutt hier war mal der Salt River, bevor die Anglos ihn gestaut haben. Wenn hier irgendwann doch mal ’ne Revolte losgeht, sollten sie als Erstes die Dämme in die Luft jagen. Das Wasser hier in der Gegend hat Befreiung echt nötig.«
Sie blickte zu ihnen rüber. »Hört euch das an, ich stänkere schon wieder rum. Jedes Mal, wenn ich nach Phoenix komme, gehe ich durch die Decke. Es macht mich so verdammt wütend, und ich schäme mich. Aber ich sollte nicht wütend werden, jetzt, wo ich meine Mädchen wieder bei mir habe.«
»Danke, Stell«, sagte Gwen ernsthaft, »mir wird rundherum warm, wenn du das sagst.«
»Das letzte Mal, als mir rundherum warm wurde«, sagte Stell, »war es eine Hitzewallung.« Sie schob sich mit dem Zeigefinger den Hut hoch. »Mist, ich weiß auch nicht, warum es mir so schwerfällt, zu sagen, was ich sagen will. Ihr zwei habt mir gefehlt, und das ist ’ne Tatsache. Auch wenn ihr mich letzten Sommer fast umgebracht habt vor Sorge.«
»Das tut mir wirklich leid«, sagte Gwen. »Ich –«
Stell unterbrach sie. »Ich will keine Entschuldigungen. Hoffe nur, dass ihr nicht vorhabt, mich dieses Jahr wieder solche Ängste ausstehen zu lassen.«
»Ich werd versuchen, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen«, sagte Gwen.
»Um dich bin ich gar nicht so besorgt.«
Stoner sah sie an. »Ich?«
»Ja, du.«
»In was für Schwierigkeiten könnte ich hier draußen schon kommen?«
Stell schüttelte den Kopf. »Du wirst schon was finden. Ich traue dir viel zu.«
Das Land stieg sanft an. In der Ferne schmiegte sich eine Bergkette dicht an die Erde. Kleine, graugrüne Büsche standen verstreut wie grasende Schafe. Der Himmel war von einem blassen, verwaschenen Blau.
Es ist schön, dachte Stoner.
Schön und grausam.
***
Großmutter Adlerin schwebte hoch über dem Colorado-Plateau und ließ sich vom Wind tragen. Ihre Zeit war nah. Seit Tagen schon hörte sie Masaus sanfte Stimme, die sie zu ihren Ahnen heimrief. Die Sonne tat ihren müden Knochen gut, diesen Knochen, in denen die Winterkälte saß und sie selbst an brüllend heißen Sommertagen nicht verließ. Sie hatte ihr letztes Niman Kachina erlebt, mit den Tänzen, den Zeremonien und der Heimkehr der Hopi-Geister zu den Heiligen Bergen. Bald würde auch sie sich zur Ruhe legen und wieder mit den Geistern ihrer abgeschlachteten Jungen vereint sein. Ihre Knochen würden zu Pfeifen werden, auf denen ein Dineh-Kind spielen würde. Ihre Federn, ihre langen, schönen Federn, die das Lied des Windes sangen, würde man sammeln für Gebetsstäbe, um die Bitten des Stammes über die Regenbogenbrücke zu den Ohren der Geister zu tragen. Der Gedanke gefiel ihr.
Nun nahm sie Abschied. Abschied von den weiten Schluchten und Hügeln und Mesas ihrer irdischen Heimat. Abschied von den tiefen Felseinschnitten, in denen während der Frühlingsregenfälle schokoladenbraune Wassermassen schäumten. Abschied von den hohen Sandsteingipfeln, den windumbrausten Bergen, in denen sie ihre Nester gebaut und ihre Jungen aufgezogen und sich mit ihrem faulen, übellaunigen Gefährten gezankt hatte.
Sie lächelte vor sich hin, als sie an den Alten Adler dachte, ihre Streitigkeiten und ihre Paarungen, ihre Jagdflüge, das Leuchten des Sonnenlichts zwischen seinen Flügelspitzen, seine starke Gegenwart in den Stunden der Dunkelheit. Aber sie erinnerte sich auch an das weißblaue Aufblitzen aus dem Gewehr des Wilderers, das den schönen Körper zerschmetterte, und daran, wie seine Federn durch die stille Luft zu Boden sanken, an das Echo des Schusses, der ihr Herz zerspringen ließ, an die langen, schweigenden Jahre, die folgten.
Sie würde ihn bald sehen, ihren Alten, und sie würden wieder zur Sonne aufsteigen, emporgehoben von den Geistern der Winde, um zwischen den Wolkenleuten zu spielen. Wieder würden sie sich paaren und streiten. Sie hatte die Paarungen vermisst, aber die Streitereien hatten ihr noch mehr gefehlt.
Der Wind-Fluss trug sie über Indianerland, über zusammengedrängte Lehmhütten und kleine, aus zwei Räumen bestehende Farmhäuser, über Wohnwagen-Abstellplätze und etwas abseits stehende hogans, über uralte Ruinen. Er trug sie über Pfirsichpflanzungen und dunkelgrüne Reihen von Hopimais. Über die misshandelten Windungen des San Juan River, die scharfen Biegungen und tief eingeschnittenen Schluchten des Colorado. Über die Abraumhalden der Uranminen, die die furchtbare Graue Krankheit brachten. Über die schwarzgefiederten Kernkraftwerke, die die heiligen Vier Ecken entweihten.
Ihr Herz fühlte ein Ziehen, und sie wandte ihre Aufmerksamkeit nach Süden. Neugierig flog sie langsam über das Dorf-das-seinen-Namen-vergessen-hat, vorbei an dem rauen Schiefer der Long Mesa, vorbei an der Dineh-Rinne und am Big Tewa, über dem die Sonne aufgeht. Die Handelsstation von Spirit Weils lag noch in der Nachmittagshitze. Ihre empfindlichen Ohren nahmen den grölenden Fernseher aus Larch Begays Texaco-Tankstelle wahr.
Alles schien wie immer.
Sie zog einen Bogen nach Westen über die Farbige Wüste, auf der Suche nach … sie war nicht sicher, wonach. Ihre Augen nahmen eine schwache Bewegung im Schatten eines Felsens wahr. Klapperschlange. Eine Delikatesse, aber sie hatte nicht mehr oft Hunger. Glück gehabt, Bruder Schlange, wohl unvorsichtig geworden in der Hitze. Sie stieß einen Schrei aus, um ihn in seine Grenzen zu weisen, und zog einen noch größeren Kreis.
Als sie wieder die alte Stadt überflog, erspähte sie etwas, das ihr vorher entgangen war. Ein Zweibein, eine alte Indianerin. Sie hatte noch nie eine so alte Frau gesehen. Älter als die Zedern. Älter als die verfallene Stadt. Vielleicht sogar älter als die Long Mesa.
Zweibein schaute nach Süden, wartete.
Adlerin glitt etwas näher heran. Vorsicht, es könnte eine Falle sein, warnte ihre Erfahrung. Vielleicht ist das alte Zweibein auf der Jagd nach schönen, frischen Federn für ihre Gebetsstäbe.
Ein leichtes Schaudern durchfuhr sie. In einer Zeremonie geopfert zu werden mag eine Ehre sein, ein Vergnügen ist es jedenfalls nicht.
Die Neugier nagte an ihrem Misstrauen. Sie kreiste noch einmal.
Zweibein sah auf. Ihre Blicke trafen sich.
»Ya-ta-hey, Großmutter Kwahu.« Zweibein sandte ihr Gedanken zu.
»Ya-ta-hey, Großmutter.« Adlerin erwiderte den Navajo-Gruß, hielt aber sicheren Abstand.
»Etwas wird hier geschehen«, sandte Zweibein. »Fühlst du es?«
»Alles, was ich dieser Tage fühle, ist der Winter in meinen Knochen. Ich halte einen Zwiegesang mit Masau seit der Zeit des Saatmondes.«
Zweibein brummte Zustimmung. »Dies hier wird mein letzter Kampf und meine Heimkehr.«
»Kampf?« Großmutter Kwahu schwebte in die Höhe und ließ sich auf einem Windstoß wieder hinabgleiten. »Alte Frau, dein Verstand ist schon heimgekehrt. Ein Sack voll morscher Knochen, wie du es bist, gibt einen armseligen Speer zum Kampf.«
»So oder so«, sagte Zweibein, »vielleicht hat diese alte Welt doch noch eine Überraschung für dich auf Lager.«
»Oder noch eine Enttäuschung für dich.« Adlerin wandte sich zum Aufbruch.
Die alte Frau hob eine Hand zum Abschied. »Wenn du deinen Freund Masau siehst, sag ihm, dass Siyamtiwa zu ihm kommen wird, wenn das hier vorbei ist.«
Sie schnaubte entrüstet. »Der Wächter der Unterwelt nimmt von abgerissenen Indianerinnen keine Anordnungen entgegen.«
»Der Wächter der Unterwelt ist Siyamtiwa noch nicht begegnet.«
Großmutter Adlerin schlug mit ihren arthritischen Flügeln und zog eine Schau ab, indem sie an einem Sonnenstrahl hochflog.
Der Austausch von Beleidigungen hatte sie verjüngt. Vielleicht lässt mich Masau doch noch ein Weilchen länger bleiben, dachte sie und schlug einen Salto. Ich würde gerne noch einen letzten Kampf erleben.
In ihrer Aufregung übersah sie beinahe den Lieferwagen, der in einer Staubwolke die Reservationsgrenze überquerte.
***
Sie spürte es ungefähr ab dem Moment, als sie an dem von Kugeln durchlöcherten Schild vorbeifuhren, das den Rand der Navajo-Reservation kennzeichnete:
KEIN ALKOHOL
KEINE SCHUSSWAFFEN
HIER GILT STAMMESGESETZ
ANWEISUNGEN DER STAMMESPOLIZEI SIND ZU BEFOLGEN
Eine merkwürdige, gebündelte Ruhelosigkeit, als ob all ihre Nervenimpulse sich in ihrem Magen sammelten.
Es war wahrscheinlich eine verspätete Reaktion auf den Flug, sieben Stunden ›Sardine spezial‹, eingezwängt in einen Sitz, der offenbar für Schoßtiere konstruiert war.
Oder es lag an der Luft, ausgedörrt wie in einem Wäschetrockner.
Oder am Licht, das jetzt durch die schrägstehende Abendsonne aufdringlich golden war.
Oder an der Art, wie der Wind den Staub aufwirbelte und tanzen ließ.
Oder vielleicht an der Landschaft, der endlosen Leere, dem Boden, der sich auf beiden Seiten der Straße erstreckte, so kahl, als ob eine Flutwelle darübergefegt wäre und das Land freigeschrubbt hätte von Salbeigestrüpp und Bäumen und Büschen und allen anderen Lebensformen, die hier noch zu existieren versuchten.
Nach Westen hin erstreckten sich niedrige Hügel aus gepresstem Ton und Schiefer, voll purpurner Schatten, aufgefaltet, von tiefen Rinnen durchschnitten, dabei weich wie Schlagsahne. Im Osten Berge. Im Norden die Silhouetten von Mesas, die sich vor dem Himmel abzeichneten.
Ein kleines Blockhaus, achteckig, mit dem Eingang nach Osten, stand im Schatten eines einzelnen Felsens. Ein Blechschornstein ragte aus dem Lehmdach. Eine ausgefranste Decke hing über der Tür. In der Nähe pickte ein Rabe nach etwas Unsichtbarem.
»Hogan«, erklärte Stell, »ein Navajo-Haus. Wahrscheinlich leer. Sie gehen im Sommer mit den Schafen in die Canyons. Navajo machen herrliche Teppiche, wisst ihr. Sie weben und färben die Wolle selbst. Nördlich und westlich von hier, entlang der Straße zum Grand Canyon, könnt ihr sie an der Fahrbahn sitzen und weben sehen. Stellen ihre Webstühle mitten in die knallende Sonne, Bäume gibt’s da ja kaum. Von Zeit zu Zeit baut mal einer der Männer seiner Frau einen Schirm, der die Sonne abhält, aber solche Männer sind selten. Was beweist, dass die Völker sich ähnlicher sind, als wir oft denken.«
Sie waren jetzt tief in der Wüste, hatten die asphaltierte Straße längst hinter sich gelassen, runter von der Navajo Route 15, auf festgefahrenen Sand und Erde. Der Himmel dehnte sich über ihnen und um sie herum, nahm kein Ende. In weiter Entfernung stand eine Windmühle, reglos. Ein Wolkenfetzen hing in der blauen Luft wie ein verschmierter Fingerabdruck. Weit und breit kein Zeichen von Leben.
»Wir haben euch in der Baracke untergebracht«, sagte Stell, »es ist eng und nichts Tolles, aber ich dachte mir, eure Ruhe ist euch lieber als irgendwelche anderen Vorzüge. Wenn’s euch nicht gefällt, könnt ihr gerne ins Gästezimmer umziehen.«
»Es ist sicher genau richtig«, sagte Gwen.
Stell warf ihr einen Blick zu. »Eine Sache möchte ich noch klarstellen, bevor ein Problem daraus wird. Stoner ist für mich wie Familie, und damit bist du auch Familie. Lassen wir also unnötige Höflichkeitsformen weg.«
»Sie kann nichts dafür«, sagte Stoner, »sie ist in Georgia erzogen.«
Gwen schwieg und schaute auf ihre Hände hinunter.
»Hab ich was Falsches gesagt?«, fragte Stoner.
Gwen schüttelte den Kopf. »Ich dachte gerade an meine Großmutter. Sie würde mich in die Baracke stecken und Stoner ins Gästezimmer. Oder umgekehrt.«
»Ich werde nie verstehen«, sagte Stell und drückte Gwens Handgelenk, »wie erpicht manche Leute darauf sind, um alles ein Riesengetue zu machen. Verflixt, ich hab doch genug damit zu tun, meinen Tag auf die Reihe zu kriegen.«
»Tja«, sagte Gwen, »du bist aber die Ausnahme.«
Links von ihnen tauchte ein heruntergekommenes Durcheinander von Gebäuden auf. Eine Hütte aus Kiefernlatten, direkt daneben eine Doppelgarage mit einem Blechdach, das über die Straße ragte und ungefähr einen halben Meter Schatten bot. Geweihe und Kuhschädel und andere Souvenirs des Todes hingen zwischen den Dachrinnen. Ein Fuchsfell war an die Garagenwand genagelt. Draußen rosteten zwei Texaco-Zapfsäulen ihrem Ende entgegen. Ein handgeschriebenes Schild, das an der Hüttenwand lehnte, verkündete ›Begays Texaco, Reifenreparatur‹. Verstreute Reifen und Felgen zeugten davon, dass bei Begay jedenfalls irgendwas mit alten Reifen passierte.
Stell sauste in einer Staubwolke und mit einem freundlichen Hupen vorbei. »Mr. Begay ist eine ziemliche Schande, aber wir versuchen miteinander auszukommen, weil dieser Müllhaufen und die Handelsstation das ganze Dorf Spirit Wells bilden. Und er hat das einzige Benzin zwischen hier und Beale.« Sie lachte. »Wo wir gerade von Getue sprachen …«
»Es gibt für alles Grenzen«, sagte Stoner. Die abgerissene Gittertür, die zu der Hütte führte, war schwarz von Fliegen gewesen.
Ein langes, niedriges Gebäude erschien in der Ferne, eng an den Fuß einer Mesa geschmiegt. Die Sonne schimmerte kupferfarben in den Fenstern. Eine lange Veranda säumte die Westseite. Als sie näher kamen, konnte sie dort Bänke und Schaukelstühle erkennen, eine Tür, die nach innen offenstand, und ein verwittertes Schild. Spirit Wells Handelsstation. Gegr. 1873. Inh. Gil und Claudine Robinson. Eine Rauchfahne stieg kerzengerade aus dem steinernen Schornstein hoch.
»Da wären wir«, sagte Stell. Sie rümpfte die Nase. »Der Rauch da gefällt mir gar nicht.«
Gwen blinzelte durch die staubige Windschutzscheibe. »Glaubst du, irgendwas stimmt nicht?«
»Schlimmer. Ted macht dieses Feuer immer nur dann vor der Dunkelheit an, wenn er irgendwas brät, das ihm die Indianer als Bezahlung gegeben haben. Das könnte so ziemlich alles sein.«
»Wild?«, fragte Stoner, in der Hoffnung auf die essbarste einer ganzen Reihe von Möglichkeiten.
»Wild, Kaninchen, Klapperschlange. Schwer zu sagen.«
»Ich hab schon sushi gegessen«, sagte Gwen mit schwacher Stimme, »aber nur einmal.«
Sie bogen von der staubigen Straße in die staubige Einfahrt, die kaum von dem staubigen Hof zu unterscheiden war. Flammend blühender Salbei füllte die Blumenkästen. Rote Paprikaschoten hingen an einer Schnur aufgereiht zum Trocknen an der Wand. Die Temperatur fiel im Schatten um fünfzehn Grad.
Die Ruhelosigkeit, die Stoner in ihrem Magen gespürt hatte, zog sich zu einer Art weicher Kugel zusammen, die warm in ihre Schultern und Arme ausstrahlte. Sie hoffte, dass sie sich nichts eingefangen hatte.
Stell hielt vor einer groben Scheune, die gleichzeitig als Garage diente. Neben der Scheune war ein umzäuntes Viehgehege. Es enthielt Pferde.
Sehr große Pferde.
Große, braune, energisch aussehende Pferde.
Stell bemerkte den Ausdruck von Entsetzen in ihrem Gesicht und lachte. »Das sind Maude und Bill. Du brauchst sie nicht zu reiten. Betrachte sie einfach als Teil der Landschaft.«
»Sie lassen sich nicht reiten?«, fragte Gwen.
»Du kannst sie reiten«, sagte Stell, »und ich kann sie reiten. Sie kann sie nicht reiten.«
»Macht euch keine Sorgen um mich«, sagte Stoner, »mir geht’s wirklich prima zu Fuß.«
»Aber«, sagte Stell, als sie aus dem Wagen stieg, »ich wette, wir haben etwas hier, das du mögen wirst.« Sie steckte zwei Finger in den Mund und ließ einen ohrenbetäubenden Pfiff los.
Der größte Hund der Welt, mit dem riesigsten, kantigsten Kopf der Welt, wühlte sich unter der Scheune hervor und warf sich in Stells ungefähre Richtung. Sein Fell war kurz und scheckig. Ein Ohr stand spitz hoch, das andere lag schlaff über seiner Stirn.
»Das hier«, sagte Stell, während der Hund ihr die Vorderpfoten auf die Schultern legte und ihr Ohr ableckte, »ist mein Freund Tom Drooley, halb Deutsche Dogge, halb Bernhardiner und ganz Schosshund.«
»Ich trau mich kaum zu fragen«, sagte Gwen, »aber warum heißt er Tom Drooley?2«
Stell schob den Hund mit dem Knie auf den Boden zurück und wischte sich das Ohr an ihrem Hemdärmel ab. »Dreimal darfst du raten.«
Tom Drooley trottete um den Wagen herum und begann eine sorgfältige Schnüffelinspektion von Stoners Hosenbeinen. Zufriedengestellt setzte er sich hin, fegte zweimal mit dem Schwanz über den Boden, sah ihr in die Augen und sagte: »Wuff.«
»Er mag dich«, sagte Stell.
Stoner nahm den Kopf des großen Hundes zwischen ihre Hände und schüttelte ihn vor und zurück. »Ich liebe ihn.«
Tom Drooley gab tiefe, kehlige, sinnliche Laute von sich.
Gwen sah leicht erstaunt aus. »Ich mag Hunde ja durchaus gern. Aber bitte sag mir, dass er nicht in der Baracke schlafen darf.«
»Er schläft in unserem Schlafzimmer«, sagte Stell. »Ehrlich gesagt glaube ich, er fürchtet sich im Dunkeln.« Sie zog gefüllte Einkaufstaschen von der Laderampe des Wagens und drückte sie ihnen in die Hand. »Jetzt werdet ihr gleich meinen Herzallerliebsten kennenlernen. Hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Gary Cooper ist er nicht gerade.«
Die Küche war groß und roch nach Linoleum und der Asche des Kaminfeuers. Sonnenlicht strömte durch die Westfenster. Über der Spüle gaben karierte Gardinen den Blick auf Salbeibüsche, die Mesa, die kleine Baracke und einen von Kalkfelsen gesäumten Fußweg frei. Auf den Fensterbänken wuchsen Kräuter in Tontöpfen. An der Rückwand knisterte das Feuer in einem alten Holzofen. Darauf stand ein gusseiserner Kochtopf, unter dessen Deckel hervor ringsum Dampfschwaden entwichen. In der Mitte des Zimmers war ein langer Massivholztisch zum Essen gedeckt.
Jenseits des Tisches, abgetrennt durch einen bogenförmigen Durchgang, wurde der Raum zum Wohnzimmer. Es war dunkel und sah kühl aus, möbliert mit Polstersesseln, Bücherregalen und Tischlampen. Ein prächtiger Navajoteppich in Grau- und Blautönen lag auf dem rohen Holzfußboden. Die Kiefernholzwände waren übersät mit bräunlichen Fotos in handgefertigten Rahmen. Ein Wandschrank beherbergte einen Stapel Bücher, Spielkarten, einen Flickkorb und – wie in letzter Minute noch dazugestellt – einen winzigen Fernseher.
Ein mit einer Decke verhängter Durchgang führte zum eigentlichen Laden.
Hinter einer der drei Türen in der Ostwand der Küche waren Hammerschläge zu hören.
»Ted«, brüllte Stell, um den Lärm zu übertönen, »die Mädels sind hier.«
Er war vielleicht nicht gerade Gary Cooper, aber es fehlte nicht viel. Ted Perkins schlenderte ins Zimmer, groß, muskulös, langsam grau werdend, mit dem rauen Charme und dem blauäugigen Zwinkern eines Mannes, der draußen arbeitet, und das hart. Er hielt in der einen Hand einen Hammer, in der anderen eine Blechtasse voll Wasser.
»Ha«, sagte Stell, als sie ihre Tüte auf dem Tisch absetzte. »Sobald ich dir den Rücken zudrehe, fängst du an, Blödsinn zu machen.« Ted brummte und nickte Gwen und Stoner einen Gruß zu.
Stell stellte sie vor. Er setzte die Tasse ab und gab ihnen die Hand. »Schon viel von euch gehört«, sagte er. »Stimmt das alles?«
»Wahrscheinlich schon.«
Er wandte sich an Gwen. »Tut mir leid wegen deinem Mann, diesem Schweinehund.«
»Ja«, sagte Gwen, »das war er.«
»Was hast du Grauenvolles in dem Topf da?«, fragte Stell.
»Kesselfleisch. Das ist doch ein Kessel, oder nicht?«
»Zur Ausstattung hier gehört eigentlich ein Gasherd, wie du weißt. Oder versuchst du, die Frischlinge zu beeindrucken?«
»Dich versuch ich zu beeindrucken, Stell.«
Sie küsste ihn auf die Wange. »Mein Alter, du beeindruckst mich seit über fünfunddreißig Jahren.«
Gwen schlich sich an Stoner heran. »Meinst du, das ist unser Zeichen, uns diskret zu verziehen?«
»Noch nicht«, sagte Stell, »aber wenn wir anfangen, unanständige Sachen zu sagen …«
Ted wandte seine Aufmerksamkeit der Einkaufstüte zu, fand eine Apfelsine und fing an, sie zu schälen. »Hast du Claudine heute Morgen noch besucht?«
»Ziemlich unverändert«, sagte Stell. »Ich wünschte, Gil würde irgendwas tun. Er sitzt nur da wie ein Stein.«
»Ach komm, Gil hat es schon vor Jahren aufgegeben, zu Wort kommen zu wollen. Wie es mir wohl eines Tages auch ergehen wird.«
Stell funkelte ihn an. »Ich hätte damals was wesentlich Besseres nehmen können als dich. Warum hab ich’s bloß nicht getan?«
Er strich mit der Hand an ihrer Hüfte hinunter. Stell gab ihm einen Klaps.
»Na ja, mag sein, dass sie heute Morgen noch unverändert schien, aber heute Nachmittag ist sie aufgestanden und hat das Krankenhaus verlassen.«
»Sie hat was?«
»Das Krankenhaus verlassen«, sagte Ted. »Behauptete, sie fühlte sich plötzlich wieder prima, und sie würden dort sowieso nichts Sinnvolles mit ihr anstellen.«
Stell lehnte sich gegen das Waschbecken. »Ich glaub es nicht. Du weißt, wie sie letzte Woche aussah. Heute Morgen war es fast genauso schlimm.«
Ted zuckte bedeutungsschwer mit den Schultern. »Was immer sie hatte, es hat sich einfach wieder verzogen. So urplötzlich, wie es über sie kam.« Er warf die Apfelsinenschalen in den Müll und verteilte die Frucht an alle. »Sie wollen nach Taos rüberfahren und für eine Weile ihre Kinder besuchen, wenn wir nichts dagegen haben, noch hierzubleiben. Ist dir das recht?«
»Klar. Zu Hause ist ja alles unter Kontrolle.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann es immer noch nicht glauben.«
»Tja, das ist nicht überraschend bei deinem halsstarrigen Temperament. Sie ruft dich heute Abend noch an.«
Sie erwischte ihn dabei, wie er nach einer Handvoll Weintrauben griff. »Lass das Zeug in Ruhe.«
Ted gab einen riesigen Seufzer von sich. »Du bist eine harte Frau, Stell. Hast du dran gedacht, diese Flachkopfschrauben zu besorgen, um die ich dich schon seit mindestens drei Wochen bitte?«
»Ich hab sie mitgebracht.«
Er lümmelte sich gegen die Wand. »Wird Zeit, die Kartoffeln aufzusetzen, oder muss ich das auch noch machen?«
Stell warf einen Blick ins Waschbecken. »Du hast sie noch nicht mal geschält.«
»Wollte nicht die ganzen Vitamine runterkratzen.«
»Was haben der Herr denn mit seiner ganzen Zeit angefangen, hm?«
Er klaute sich eine Traube, als Stell ihm den Rücken zudrehte. »Die jungen Lomahongvas kamen vorbei, um ein Pfund Kaffee und weißes Garn zu holen. Sagten, der Großmutter geht’s schlechter. Tomas ist der Meinung, dass sie an demselben Übel leidet wie Claudine.«
»Und das wäre?«
»Zauberei.«
Stell blitzte ihn ungeduldig an.
»Sie sind Traditionalisten«, erläuterte Ted. »Könnte sogar was dran sein.«
»Vielleicht bei der Lomahongva-Frau, aber Claudine ist so weiß wie frisch gefallener Schnee.« Sie drehte sich wieder zum Waschbecken um.
Ted stibitzte noch eine Traube. »Mr. Larch Begay hat mir die Ehre eines Besuchs erwiesen.«
»War er nüchtern?«
»Nicht so, dass man es bemerkt hätte.«
Gwen griff nach dem Kartoffelschäler. »Lass mich das machen, Stell.«
»Vorsichtig«, sagte Ted. »Du willst doch nicht die Vitamine wegschälen.«
Stell drehte sich gerade rechtzeitig um, um ihn beim Griff nach einer weiteren Weintraube zu erwischen. »Du weißt, dass ich das hasse, Perkins. Wenn du so verflixt ruhelos bist, trag doch das Gepäck der beiden in die Baracke.«
Er schlurfte auf die Tür zu. »Übrigens, ich hab die quietschende Bettfeder repariert. Vielleicht können wir heute Nacht ein bisschen Spaß haben, ohne die gesamte Navajo-Nation davon in Kenntnis zu setzen.« Er ließ die Fliegengittertür hinter sich zuknallen.
»Männer«, rief Stell. »Weiß nicht, warum ich bei ihm bleibe, außer dass er so einen süßen Hintern hat.«
Stoner griff in die Einkaufstasche und reichte Stell eine Schachtel Pfeffer hinüber. »Eins muss man dir zugute halten, Stell. Du ziehst wirklich nette Männer an.«
»Na ja, ich hab’s auf die harte Tour gelernt, wie alle anderen auch. Hab schon eine ganze Menge Frösche geküsst früher.« Sie schüttelte den Kopf. »Zauberei, ach du heiliger Strohsack.«
»Worum ging es da?«, fragte Stoner.
»Es ist eins von diesen Gerüchten, die von Zeit zu Zeit hochkommen. Die meisten der Leute hier glauben nicht mehr daran. Als ich als Kind hierher zu Besuch kam, gab es immer eine Menge Gerede darüber. Ich frag mich, was das jetzt wieder losgetreten hat.«
Gwen ließ die Kartoffeln in den Kochtopf fallen. »Da seid ihr jetzt, vitaminlos.« Sie trug eine Tasche mit Einkäufen zum Kühlschrank und fing an, sie wegzuräumen.
Mit den Händen in den Hüften marschierte Stell zu ihr hinüber. »Was machst du da, Owens?«
Gwen sah hoch. »Ich helfe.«
»Lass das.« Stell nahm ihr die Tasche weg. »Du wirst es sowieso falsch machen.«
Stoner schloss die Hand um die Oregano-Dose, die sie gerade aufs Regal stellen wollte, und ließ sie auf den Tisch zurückgleiten.
Stell ertappte sie dabei. »Mein Gott, wenn ich zu Hause in Timberline diese Art von Anarchie hätte, wär ich schon bankrott.«
»Du bist ganz schön gereizt«, sagte Gwen.
»Tut mir leid.« Stell gab ihr die Tasche zurück. »Von diesem Zauber-Gerede könnt ich Zustände kriegen. Beleidigt meinen Sinn für Ordnung.«
Gwen räumte den Inhalt des Kühlschranks um. »Ich verstehe nicht, wie du von Ordnung reden kannst. In diesem Kasten herrscht völliges Chaos.«
»Das reicht!«, rief Stell. »Raus. Alle beide.« Sie wedelte mit den Armen. »Raus, raus, raus!«
»Lass mich das nur noch kurz ordnen«, sagte Gwen. »Es dauert keine Minute …«
Stell schnappte sie am Kragen und zog sie vom Kühlschrank weg. »Raus! Bevor mein Temperament mit mir durchgeht.«
»Komm schon«, sagte Stoner und zupfte sie am Ärmel. »Sie meint es ernst.«
Stell scheuchte sie zur Tür hinaus. »Und kommt nicht wieder, bevor ich euch rufe, habt ihr gehört?«
»Ja, Chef«, sagte Gwen und salutierte.
Tom Drooley kroch unter der Scheune hervor, folgte ihnen bis zur Baracke und ging zurück unter die Scheune.
»Hey«, sagte Gwen. Sie sah sich in der Baracke um. »Das ist ja süß.«
Es war ein einziger großer Raum mit einem dickbäuchigen gusseisernen Ofen und Sackleinen-Vorhängen vor den Wandschränken. Ein Fenster ging nach Westen und eins nach Osten. Der Boden bestand aus abgetretenem Linoleum über groben Holzlatten. Die ursprünglichen Wandkojen waren entfernt und durch ein Doppel- und ein Einzelbett ersetzt worden. Das Doppelbett war bezogen.
Gwen zog die Tagesdeckezurück. »Sehr subtil. Sie geht offensichtlich davon aus, dass wir im Doppelbett schlafen.«
»Natürlich tut sie das.«
Gwen seufzte. »Meinst du, wir könnten für immer hierbleiben?«
Stoner schaute sich zu ihr um. »Geht’s dir sehr an die Nieren?«
»Zwischendurch immer mal.« Sie hob ihren Koffer aufs Bett. »Wenigstens brauche ich hier draußen nicht darüber nachzudenken, was ich dagegen tun soll.«
Das Licht der untergehenden Sonne fiel auf ihre sonnengebräunten Arme und sanften Hände und vergoldete die Spitzen ihrer Wimpern. Stoner verliebte sich in diesem Moment noch einmal von neuem. Sie nahm sie in die Arme. Auf Gwens Haut lag der salzige, verbrannte Geruch des Sommers. »Oh Himmel«, sagte sie rau, »ich liebe dich.«
Gwen hielt sie ganz fest. »Egal, was passiert, mich wirst du nicht mehr los, höchstens indem du mich wegschickst.«
»Was ungeheuer wahrscheinlich ist.«
Gwen fuhr mit den Händen unter Stoners Hemd und ihren nackten Rücken hinauf. »Du bist angespannt. Stimmt irgendwas nicht?«
»Ich fühl mich ein bisschen seltsam. Vielleicht ist es die Höhe.«
Die Berührung von Gwens Händen, das Gefühl ihrer Arme erweckte einige schlafende Bedürfnisse wieder zum Leben. Sie streckte die Hand aus, um Gwens Gesicht zu streicheln.
Ein Energiestoß übertrug sich zwischen ihnen.
»He!«, sagte Gwen. »Was war das?«
»Wahrscheinlich statische Elektrizität.«
Gwen schüttelte den Kopf. »Statische Elektrizität fühlt sich anders an.«
»Ehrlich gesagt, es erinnert mich an das Gefühl, das ich bekomme, wenn ich plötzlich hochschaue und dich sehe.«
Gwens Augen wurden ganz dunkel. »Das ist eins der nettesten Dinge, die mir je ein Mensch gesagt hat.«
Stoner spielte mit Gwens Gürtelschnalle. »Na ja«, sagte sie verlegen, »es stimmt eben.«
Sie fühlte, wie Gwen ihr Haar berührte. »Lass uns was futtern gehen und dann ganz schnell hierher zurückkommen.«
»Also ehrlich«, lachte Stoner. »Du bist schamlos.«
Gwen fing an, Hemden aus ihrem Koffer zu ziehen und sie in die Schubladen der Kommode zu stopfen. »Ich hoffe nur«, sagte sie, »wir können ein bisschen Spaß haben, ohne die gesamte Navajo-Nation davon in Kenntnis zu setzen.«