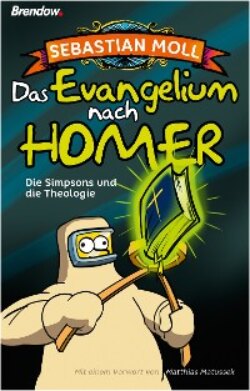Читать книгу Das Evangelium nach Homer - Sebastian Moll - Страница 8
Kapitel I
ОглавлениеDIE HEILIGE SCHRIFT UND
IHRE AUTORITÄT
„Ich habe alles getan, was in der Bibel steht, selbst den Mist,
der an anderer Stelle widerrufen wird.“
Ned Flanders
Die Bibel bildet für alle Christen auf der Welt die Grundlage ihres Glaubens, wobei ihre Bedeutung innerhalb der protestantischen Kirchen sogar noch ein wenig höher ist als bei den übrigen Konfessionen. Bei der Kirchengemeinde von Springfield handelt es sich ohne Zweifel um eine protestantische Gemeinde. Erst in Staffel 16 (2005) wird eine präzise konfessionelle Zugehörigkeit genannt, als Reverend Lovejoy den zum Katholizismus übergetretenen Bart zum einzig wahren Glauben des „Western Branch of American Reform Presbylutheranism“ zurückbringen will. Hierbei handelt es sich selbstverständlich um eine satirische Pseudokonfession, mit der die unzähligen protestantischen Kleinfamilien innerhalb der amerikanischen Gesellschaft aufs Korn genommen werden sollen. Trotz dieser Aufsplitterung zählen die protestantischen Gemeinden etwa 40 % der Amerikaner zu ihren Mitgliedern und bilden somit die größte religiöse Gruppierung des Landes. Dass die Gemeinde von Springfield diesem Mainstream ebenfalls angehört, wird anhand mehrerer Aspekte deutlich, beispielsweise durch die recht lockere Ordnung der Liturgie, den hohen Stellenwert der Predigt oder die Tatsache, dass Reverend Lovejoy verheiratet ist. Einzig eine baptistische Prägung der Gemeinde kann ausgeschlossen werden, da in Springfield die Kindertaufe praktiziert wird, wie man in der Folge „Bei Simpsons stimmt was nicht!“ (Staffel 7, 1995) sehen kann, als Bart und Lisa notgedrungen zu den Flanders ziehen müssen. Bei einem aufregenden biblischen Gesellschaftsspiel während ihres Besuches dort, bei dem die Spieler Fragen beantworten müssen wie „Welcher persische König hat die Leviter von der Besteuerung ausgenommen?“, findet Ned heraus, dass die Kinder der Simpsons nicht getauft sind. Warum das so ist, bleibt allerdings unklar, denn schließlich achtet Marge für gewöhnlich sehr auf die religiöse Erziehung der Kinder. Jedenfalls greift Ned sofort zu seiner Nottaufausrüstung und macht sich auf zum nächsten Fluss, wird jedoch im letzten Moment von Homer an der Taufe gehindert.
Zum protestantischen Profil der Gemeinde von Springfield gehört ohne Zweifel auch der hohe Stellenwert, den die Bibel im Leben der Einwohner von Springfield einnimmt. Am deutlichsten macht sich dieser Einfluss im Leben von Ned Flanders bemerkbar. Ned hat, nach eigener Aussage, „alles getan, was in der Bibel steht, selbst den Mist, der an anderer Stelle widerrufen wird“. Er hat sogar koscher gelebt, „um auf Nummer sicher zu gehen“. Mit dieser Selbsteinlassung hat Flanders auf ein Problem hingewiesen, das viele Menschen beim Lesen der Bibel verspüren: Die Heilige Schrift der Christenheit bietet nicht immer ein einheitliches Bild und enthält zu vielen Themen tatsächlich widersprüchliche Aussagen. Ned Flanders versucht dieses Problem ganz einfach dadurch zu lösen, dass er sich auch an die gegensätzlichen Anweisungen hält, was natürlich Unsinn ist, denn niemand kann gleichzeitig sich widersprechende Forderungen befolgen. Wie aber können Christen sinnvoll mit diesen Gegensätzen umgehen? Hierzu muss zunächst sorgfältig zwischen verschiedenen Arten von Widersprüchen unterschieden werden.
Zunächst gibt es die echten Widersprüche innerhalb der Bibel, insbesondere zwischen Altem und Neuem Testament. Wenn es im Alten Testament „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ heißt, im Neuen Testament aber gefordert wird, die andere Wange hinzuhalten, so haben wir es mit einem klaren Gegensatz zu tun. Diese Gegensätze sind aber mitnichten ein Versehen, sondern im Plan der göttlichen Offenbarung angelegt. Für uns Christen bildet die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus den Höhepunkt dieser Offenbarung. Daher ist die gesamte Bibel, auch und gerade das Alte Testament, auf ihn hin bzw. von ihm her zu lesen. Wenn also Christus spricht: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar“ (Matthäus 5,38 - 39), so stellt er ganz bewusst sich selbst als das lebendige Wort Gottes über die Autorität der alttestamentlichen Überlieferung. Ebenso verhält es sich beispielsweise mit den alttestamentlichen Speisevorschriften, die Jesus mit seinen berühmten Worten „Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte; sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist“s, was den Menschen unrein macht“ (Markus 7,15) für nichtig erklärt. Wenn Ned Flanders also sagt, er habe koscher gelebt, um auf Nummer sicher zu gehen, dann hat er in seinem Übereifer, alle Gebote der Bibel gleichermaßen zu erfüllen, das Entscheidende übersehen, nämlich, dass Christus ihn von dieser Notwendigkeit befreit hat. Paulus spricht von solchen Menschen sogar als den Schwachen im Glauben (Römerbrief 14). Ironischerweise offenbart Ned durch sein Verhalten also keine Glaubensstärke, sondern eher Züge eines Pharisäers.
Die zweite Gruppe von Widersprüchen bilden solche, die sich aus dem Charakter der Bibel als Schriftensammlung ergeben. Die Bibel ist kein in einem Mal von einer Person durchgeschriebenes Buch, sondern eine riesige Bibliothek verschiedener Bücher, zwischen deren Abfassung mitunter Jahrhunderte liegen. Aber nicht nur das: Manchmal sind auch einzelne Bücher aus verschiedenen Texten zusammengesetzt worden. Ein gutes Beispiel hierfür findet sich gleich zu Beginn der Bibel. Ursprünglich handelte es sich bei der Schöpfungsgeschichte um zwei voneinander unabhängige Erzählungen, die erst später zu einer einzigen zusammengefügt wurden. Die erste berichtet von der Schöpfung der Welt in sechs Tagen (Genesis 1 - 2,4a), die zweite beschreibt den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies (2,4b-3,28). Die zweite Erzählung ist eigentlich die ältere der beiden, wurde aber hinter die andere platziert, da sich nur so ein Übergang von der Erschaffung des Menschen innerhalb des Sechstagewerks zu den Ereignissen im Paradies herstellen ließ. Tatsächlich lassen sich gewisse Brüche trotzdem nicht leugnen, so zum Beispiel der Umstand, dass die Tiere in der ersten Erzählung vor dem Menschen geschaffen werden, in der zweiten aber erst nach ihm. Auch der Schöpfungsakt ist ein völlig anderer. Während Gott im ersten Bericht durch das Wort die Dinge erschafft, legt er in der zweiten Erzählung persönlich Hand an.
Es ist völlig offensichtlich, dass nicht beide Versionen korrekt sein können. Deshalb sollte man sich auch davor hüten, von der Irrtumslosigkeit der Bibel zu sprechen. Die Bibel ist nicht irrtumslos im wissenschaftlichen Sinne, sie enthält ganz zweifellos Texte, die selbst mit großer Kreativität nicht glaubwürdig unter einen Hut zu bringen sind – was bedauerlicherweise nicht heißt, dass es nicht immer wieder versucht würde. Beim Lesen dieser Versuche hat man zuweilen allerdings den Eindruck, als befände man sich mitten in einer Folge der Simpsons!
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Schöpfungsberichte vor allem in ihrer Chronologie unterscheiden. Zwar sind beide Erzählungen auf den Menschen ausgerichtet, doch während er in der ersten als Krönung am Ende geschaffen wird, geht die zweite vom Menschen als Mittelpunkt aus, um dessentwillen die übrige Schöpfung (Pflanzen, Tiere etc.) erfolgt. Diejenigen, die solche Widersprüche nicht anerkennen wollen, argumentieren nun beispielsweise, dass es sich bei den Pflanzen, die Gott laut zweitem Schöpfungsbericht nach dem Menschen wachsen ließ, nicht um die laut erstem Schöpfungsbericht am dritten Tage geschaffene Vegetation handele, sondern dass damit Kulturpflanzen gemeint seien, die nicht zur ursprünglichen Schöpfung innerhalb der sechs Tage gehörten. Nun, das ergibt zweifellos Sinn – nicht für mich, aber anscheinend für andere. Meiner Ansicht nach sollte man, anstatt seine Zeit mit fragwürdigen Glättungsversuchen zu verschwenden, sich lieber an der theologischen Tiefe der Erzählungen erfreuen. Die Erkenntnis von Gut und Böse, durch die sich der Mensch von allen übrigen Geschöpfen abhebt und sich von der Herrschaft Gottes emanzipiert, durch die er aber zugleich des paradiesischen Urzustandes verlustig geht und die schwere Bürde ethischer Verantwortung auf seine Schultern lädt – diese existentzielle Erfahrung wird in der Schöpfungserzählung in sonst nie erreichter Schönheit und Einfachheit beschrieben.
Auch beim Umgang mit den gelegentlichen Ungereimtheiten des Neuen Testamentes sollte man auf ähnliche Weise verfahren. Die Evangelisten waren nicht die Stenographen Jesu, die mit Notizblock hinter ihm herrannten, um seine Predigten und Gleichnisse wortgenau mitzuschreiben. Was wir heute in den Evangelien an Worten Jesu finden, entspringt zum Teil der eigenen Erinnerung der Autoren, zum Teil der Überlieferung, zu der sie Zugang hatten. Dass es dabei zu Unterschieden in ihren Darstellungen kommt, sollte wenig überraschen. Da darüber hinaus keiner von ihnen bei der Geburt Jesu dabei war, kommt es insbesondere in dieser Frage zu großen Unterschieden. Markus verzichtet gänzlich auf eine entsprechende Erzählung, bei Matthäus finden wir die Weisen aus dem Morgenland sowie den Kindermord des Herodes, Lukas berichtet von der Volkszählung des Augustus, und das Evangelium des Johannes beginnt mit einer kosmologischen Betrachtung.
Auch wenn sich die Berichte nicht direkt widersprechen, sondern eher Einzelaspekte berichten (oder eben nicht), ist es dennoch nicht ganz leicht, etwa die Wiedergaben von Matthäus und Lukas in Einklang zu bringen. Wir haben es hier also mit einer ähnlichen Situation zu tun wie bei den unterschiedlichen Schöpfungsberichten des Alten Testaments.
Betrachtet man hingegen beispielsweise die Gleichnisse Jesu, so finden sich bei ihnen nur geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Evangelisten, sodass hier nicht von echten Widersprüchen gesprochen werden kann. Große Künstler wie Vincent van Gogh, der sich sein gesamtes Leben lang von Jesu Gleichnis vom Sämann inspirieren ließ, haben sich an solchen Abweichungen bei der Wiedergabe dieser wunderschönen Geschichte jedenfalls wenig gestört. Anstatt also auf den Abweichungen herumzureiten und diese zu Tode zu analysieren, sollten auch wir wieder lernen, die Schönheit der Worte zu genießen.
Bei der dritten Art von Widersprüchen, die immer wieder gegen die Autorität der Bibel ins Feld geführt werden, handelt es sich nur um scheinbare Widersprüche. Sie werden deshalb auch nur von solchen Leuten vorgebracht, die nicht zwischen verschiedenen Arten von Texten unterscheiden können. Nicht alles, was in der Bibel geschrieben steht, gehört in die Kategorie ethischer Anweisungen. Deshalb ist auch ein Satz wie „Das steht aber in der Bibel“ für sich genommen völlig bedeutungslos. Vielfach werden einfach nur Geschehnisse berichtet, die aber nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen sind. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Beziehungen und Sexualität, wie das folgende Beispiel von den Töchtern Lots (Genesis 19,31 - 36) beweist:
Eines Tages sagte die Ältere zur Jüngeren: Unser Vater wird alt und einen Mann, der mit uns verkehrt, wie es in aller Welt üblich ist, gibt es nicht. Komm, geben wir unserem Vater Wein zu trinken und legen wir uns zu ihm, damit wir von unserem Vater Kinder bekommen. Sie gaben also ihrem Vater am Abend Wein zu trinken; dann kam die Ältere und legte sich zu ihrem Vater. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Am anderen Tag sagte die Ältere zur Jüngeren: Ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Geben wir ihm auch heute Abend Wein zu trinken, dann geh und leg du dich zu ihm. So werden wir von unserem Vater Kinder bekommen. Sie gaben ihrem Vater also auch an jenem Abend Wein zu trinken; dann legte sich die Jüngere zu ihm. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Beide Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger.
Es wäre mehr als fatal, aus dieser Begebenheit nun einen Widerspruch zum biblischen Inzestverbot zu konstruieren, ebenso wenig, wie man aus dem Bericht, dass König Salomo 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen gehabt habe, einen Gegensatz zum Gebot der Monogamie sehen sollte. Denn wer die Geschichte zu Ende liest, weiß, dass diese Frauen Salomo zum Verhängnis wurden. Auch die Geschichte von Tamar, die sich als Hure verkleidet, um ihren Schwiegervater zu verführen, sollte besser nicht als Aufwertung der Prostitution verstanden werden. Diese Art von vermeintlichen Widersprüchen löst sich also bei genauerem Hinsehen in Luft auf. Aber auch mit den anderen in der Bibel zu findenden Gegensätzen lässt sich, wie wir gesehen haben, auf sinnvollere Weise umgehen, als es der übereifrige Flanders tut.
Neben denjenigen, die krampfhaft versuchen, jeden einzelnen Buchstaben der Schrift haargenau zu befolgen, gibt es in Springfield aber auch Charaktere, die dazu neigen, bestimmte Passagen der Bibel einfach zu ignorieren, wenn sie ihnen nicht in den Kram passen. Ein gutes Beispiel hierfür ist Reverend Lovejoy, der geistliche Leiter der Gemeinde. Als seine Tochter Jessica, die hinter ihrer unschuldigen Fassade eine kleine Teufelin ist, das Geld aus dem Klingelbeutel nimmt, schiebt sie die Schuld für diesen Diebstahl Bart in die Schuhe. Daraufhin darf dieser die Kirche nur noch in einem fahrbaren Gefängnis betreten. Lisa ermahnt Lovejoy daher mit den Worten: „Lehrt uns die Bibel nicht: Richtet nicht, auf dass ihr selbst nicht gerichtet werdet, Reverend?“ Dieser reagiert widerwillig: „Das muss wohl ganz hinten, irgendwo am Schluss stehen.“ Solch eine Reaktion ist charakteristisch für Menschen, die sich mit eindeutigen Aussagen der Schrift konfrontiert sehen, die sie auf ihr eigenes Fehlverhalten hinweisen. Schon Jesus selbst machte die Erfahrung, dass sich die Menschen von ihm abwandten, sobald seine Forderungen zu radikal wurden bzw. er konkrete Ansprüche stellte. Man denke nur an den reichen Jüngling, der vorbildlich alle Gebote zu erfüllen meinte, es aber nicht übers Herz brachte, sich von seinem Reichtum zu trennen.
Im Laufe der Kirchengeschichte hat es immer wieder, auch und gerade von offizieller Seite, den Versuch gegeben, bestimmte Passagen aus der Heiligen Schrift zu streichen, weil diese nicht mit der eigenen theologischen Überzeugung übereinstimmten. Martin Luther hätte am liebsten den gesamten Jakobusbrief aus dem Neuen Testament entfernt, weil er in ihm eine Propagierung der Werkgerechtigkeit sah, die seiner eigenen Betonung der Erlösung aus Glauben zu widersprechen schien. Tatsächlich hat er sich hier aber getäuscht, denn Jakobus widerspricht Luther bzw. Paulus, auf den sich Luther stützte, überhaupt nicht, sondern betont lediglich, dass ein Glaube ohne Liebe tot ist, wozu ihm Luther beigepflichtet hätte.
In der jüngeren Vergangenheit waren es vor allem die Deutschen Christen, eine am Nationalsozialismus orientierte Strömung innerhalb des deutschen Protestantismus, die sich um eine „Reinigung“ der Bibel bemühten. Insbesondere störten sich die Antisemiten natürlich an der Tatsache, dass Jesus ein Jude war. Deshalb erfanden sie eine alternative Geburtsgeschichte, der zufolge Jesus der Sohn des römischen Hauptmanns Pandira gewesen sei – eine Geschichte, die sie ausgerechnet aus dem Talmud übernahmen, in dem sich diese Version bereits fand. Gegen diese nationalsozialistische Vereinnahmung Jesu fand sich 1934 die Barmer Bekenntnissynode zusammen und formulierte in ihrer berühmten Erklärung:
Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen.
Allerdings sind derartige ideologische Verirrungen keineswegs zusammen mit dem Dritten Reich untergegangen. Auch in den aktuellen theologischen Debatten finden wir sie, wenngleich mit völlig anderer Thematik. Heute sind es die feministischen Theologinnen, die nicht glauben wollen, Paulus habe tatsächlich gesagt, dass die Frau in der Gemeinde schweigen solle (1. Korinther 13,33 - 34), weshalb es sich bei diesem Satz um eine spätere Fälschung handeln müsse – was allerdings durch die historische Forschung nicht belegt werden kann. In der so genannten „Bibel in gerechter Sprache“, der größten Verzerrung des Gotteswortes in der Geschichte der Christenheit, wird aus dem Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ die Weisung „Verletze keine Lebenspartnerschaft“, da man sich offensichtlich nicht mit der biblischen Ablehnung der Homosexualität abfinden kann.
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard bemerkte einmal überaus zutreffend: „Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert.“ Anstatt also bestimmte biblische Inhalte, mit denen man sich nicht anfreunden kann, einfach zu streichen oder umzuschreiben, sollte man sich lieber fragen, ob nicht die eigene Einstellung vielleicht falsch sein könnte. Die Botschaft von Barmen ist somit nicht einfach nur ein mutiges Zeugnis einer vergangenen Epoche, sondern eine ständige Mahnung, dass die Verteidigung des unverfälschten Evangeliums zu jeder Zeit Mut erfordert.
Als Pendant zu jenen Christen, die aus Angst vor der Autorität der Bibel ihren Aussagen am liebsten ausweichen, gibt es aber auch solche, die einfach biblische Aussagen erfinden, um ihrer eigenen Position mehr Geltung zu verschaffen. In Springfield ist Homer Simpson der unbestrittene Meister dieser Disziplin. Als Lisa ihn beim Wetten erwischt, was in den USA illegal ist, rechtfertigt sich Homer damit, dass sogar die Bibel sage, dass es okay sei. Auf ihre Nachfrage, wo genau das denn stünde, antwortet er nur: „Im vorletzten Kapitel.“ Weil Homer den obdachlosen Schulbusfahrer Otto nicht bei sich zu Hause aufnehmen will, kontert er Marges (korrektes) Bibelzitat „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ mit den Worten: „Ja, aber steht in der Bibel nicht auch: Du sollst keine Penner aufnehmen in deinem Haus?“ Der Plan seiner Frau, eine Stelle im Atomkraftwerk anzunehmen, also am selben Ort zu arbeiten wie er selbst, gefällt Homer ebenfalls nicht, weshalb er Marge folgendes „Bibelzitat“ vorhält: „Du sollst nicht malochen in deines Ehemannes Firma.“ Auch der Idee seiner Tochter Lisa, sich einer Eishockeymannschaft anzuschließen, steht Homer ablehnend gegenüber, weshalb er sie darauf hinweist: „Wenn uns die Bibel auch sonst nichts gelehrt hat, und das hat sie nicht, dann, dass Mädchen sich an Mädchensportarten halten sollen.“
Glücklicherweise verhält sich Homer beim Erfinden von Bibelzitaten derart plump, dass keinerlei Gefahr besteht, seine Gegenüber könnten tatsächlich darauf hereinfallen. Das ist nicht zuletzt deshalb der Fall, weil jeder die Möglichkeit hat, selbst zu überprüfen, ob diese Dinge tatsächlich in der Bibel stehen oder nicht. Doch dies war keineswegs immer so. Die eigenständige Lektüre der Bibel war einem Großteil der Menschen lange Zeit nicht möglich, was ihrem Missbrauch natürlich Tür und Tor öffnete. Tatsächlich verhinderte die römisch-katholische Kirche des Mittelalters ganz bewusst, dass Laien die Bibel lesen konnten, damit die Praktiken der Kirche nicht als unbiblisch durchschaut werden konnten. Natürlich wurden hierbei nicht einfach Bibelstellen erfunden, wie Homer es tut, wohl aber einige recht weit hergeholte Interpretationen angeboten, beispielsweise in Bezug auf den Ablasshandel. Damals wie heute gilt: Wer die Deutungshoheit über die Bibel hat, hat auch Macht über die Gewissen der Gläubigen. Daher sollte man diese Deutungshoheit niemals einer einzigen Institution überlassen, weder dem Papst noch den Professoren der Theologie.
Wie jede gute Satire liefern auch die Simpsons keine wirklichen Antworten, werfen aber auf humorvolle Weise die richtigen Fragen auf. In Bezug auf die Bibel konfrontieren uns die gelben Bewohner von Springfield mit den vielen menschlichen Schwächen, die den Umgang mit der Heiligen Schrift erschweren können, sei es der undifferenzierte Gehorsam, das Ignorieren wichtiger Botschaften oder das Erfinden von Inhalten. Der irische Schriftsteller Jonathan Swift spottete einmal, die Satire sei wie ein Spiegel, in dem der Betrachter jeden erkenne außer sich selbst. In seiner Bergpredigt fand Jesus ganz ähnliche Worte: „Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?“ (Matthäus 7,3) Bitten wir den Heiligen Geist darum, dass wir die Fehler bei der Handhabung der Schrift, die für uns alleiniger Maßstab des Glaubens bleibt, nicht nur bei den anderen, sondern auch bei uns selbst finden mögen. Vielleicht können uns die Simpsons dabei eine kleine Hilfe sein.