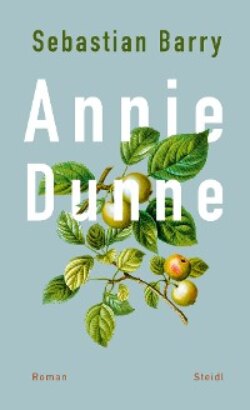Читать книгу Annie Dunne - Sebastian Barry - Страница 7
Drittes Kapitel
ОглавлениеIch stehe so reglos im Hof wie eine Kuh mit ihrem Kalb bei drückender Sommerhitze. Der Eimer in meiner Hand gibt leise quietschende Geräusche von sich.
Was ist das für ein Altwerden, wenn selbst der Motor, der unsere Verzweiflung und unsere Hoffnung im Gleichgewicht hält, anfängt, uns im Stich zu lassen?
Sie ist alt, Sarah Cullen, o ja, genau wie ich. Geboren in den letzten Zuckungen des vergangenen Jahrhunderts, im Winter 1898. Ich kam zwei Jahre später zur Welt, zufälligerweise der gleiche Altersunterschied wie bei den Kindern.
Sie war ein wunderschönes kleines Mädchen, mit zerzaustem weizenblondem Haar. Nichts bekümmerte sie, stets war sie guter Dinge.
Zwischen damals und heute ist nur ein Hauch von Zeit vergangen, scheint mir. Die Uhr des Herzens schlägt anders als die auf dem Kaminsims.
Ach, ich danke Gott für Sarah Cullen. So viele Jahre habe ich nun schon mit ihr verbracht, seit Matthew mich in Dublin aus dem Haus gejagt hat. Ein Verbrechen, das ich ihm ewig vorwerfen werde. Sich auf eine andere Frau einzulassen, wo meine Schwester Maud gerade mal zwei Jahre unter der Erde lag. Für kurze Zeit hatte ich die Hoffnung, er wäre damit zufrieden, dass ihm eine Frau den Haushalt führt, nun, da die arme Maud von uns gegangen war. Aber das war nicht der Fall. Er wollte wieder heiraten und war an seiner Schwägerin mit ihrem verkrümmten Rücken offenbar nicht interessiert. Als Maud noch lebte, sagte er immer scherzhaft: »Annie, du trägst ja den Mond auf dem Rücken«, ein netter Spruch. Aber ich glaube nicht, dass er ihm noch wie der Mond vorkam, als er sich mit dem Gedanken trug, ein zweites Mal zu heiraten. Sei’s drum. Es ist eine schlimme, vielleicht sogar eine schmutzige Geschichte. Es war eine schreckliche Zeit, und Sarah Cullen nahm mich auf.
Was mich in den letzten Jahren gequält hat, war die Angst, meine letzte Zuflucht in dieser Welt zu verlieren, die linke Seite von Sarahs Bett und dieses kleine Gehöft. Nur ein paar von den Hennen habe ich mitgebracht, diese Rhode Island Reds, die im Hof umherstolzieren, was fast zum Lachen ist, und die Kraft meines Körpers. Mein jetziges Vermögen besteht nur aus der Kraft, die mir geblieben ist, und aus der Erfahrung, die ich mit den täglichen Verrichtungen habe, mit dem Stall, der Milchkammer, dem Misthaufen, dem Brunnen, dem Kaminfeuer. Wäre das alles nicht, ich hätte keinen Wert mehr.
Die Anstalt ist ein grausiger Ort. Dorthin kommen die Obdachlosen und die Notleidenden, die verwelkten Mädchen und die alten Junggesellen, die der Regen am Ende um den Verstand gebracht hat. Das weiß ich, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Es ist schrecklich für mich, dass mein armer Vater dort gestorben ist, ganz allein und wirr im Kopf.
Der Regen von Wicklow trägt den Irrsinn in sich wie eine Krankheit, wie ein Fieber.
Diese Gedanken gehen mir durch den Kopf, während ich wie festgenagelt mit dem Jungen im Hof stehe. Den Eimer habe ich in der Hand, aber ich kann mich nicht fortbewegen.
Auf der anderen Seite unserer Grundstücksgrenze, die von einem Feldweg markiert wird, sehe ich die gebeugte Gestalt Mary Callans, die vom Brunnen zurückkehrt.
Sie ist eine wahre Meisterin, wenn es darum geht, Schlamm und Zweige vom Boden eines Brunnens aufzuwirbeln. Es ist eine Strafe, sich einen Brunnen mit ihr teilen zu müssen, so wie wir das tun. Früher hieß es, mit dem ersten Wasser am Morgen schöpfe man das Glück des Brunnens in seinen Eimer. Mary Callan ist sicher alt genug, um daran zu glauben, denn sie muss schon in ihren Neunzigern sein. Sie hat ein Feld und eine Milchkuh und ein Haus, das nur aus einem Raum besteht, und jetzt hat sie das Glück dieses Tages in ihrem randvollen Eimer. Es wird mindestens eine Stunde dauern, bis sich der Unrat wieder gesetzt hat.
Manchmal geht sie auch direkt mit ihrem alten geschwärzten Kessel zum Brunnen und füllt ihn. Was eine richtige Schmiere auf dem Wasser hinterlässt. Ein Gefäß, das über dem Feuer hängt, bekommt man nicht wirklich sauber, und ich bin sicher, dass sie es gar nicht erst versucht. Sie ist eine böse, altmodische Frau.
Aber das ist nicht das Einzige, was mich aufhält. Ich fühle mich wie eine Frau, die ihre Handschuhe im Bus vergessen hat, schöne weiche Lederhandschuhe im Bus aus Dublin, und es nicht gleich merkt, ihren Verlust aber schon deutlich spürt. Was mich aufhält, ist, dass ich Sarah mit Billy Kerr allein gelassen habe.
Der Junge sieht mich verwundert an.
»Kind, wir müssen wieder reingehen.«
Und so gehe ich wieder hinein, den Jungen noch an der Hand, trete aus dem angenehmen Sonnenlicht in die Küche mit ihren vielen Schatten. Das kleine Mädchen hat sich schon davongemacht.
Sarah steht mit dem Rücken zum Torffeuer und wärmt sich die langen Knochen, Billy Kerr sitzt lässig und wie selbstverständlich auf einer der Steinbänke neben dem Kamin. Keiner von beiden spricht. Es herrscht jene Art Schweigen, wie die Leute auf dem Land es in Jahrhunderten beim Teetrinken kultiviert haben. In diesem Schweigen kann vieles zur Sprache kommen, es ist gefährlich.
»Was gibt’s, Annie?«, fragt Sarah.
»Ich kann gerade kein Wasser holen. Mary Callan ist mir zuvorgekommen. Das ist der Preis, den man fürs Trödeln zahlt«, sage ich mit einem Kopfnicken in Sarahs Richtung. »Und dann noch ihre Kuh«, sage ich, aber Billy Kerr unterbricht mich mit einem erstaunten Blick.
»Was ist mit ihrer Kuh?«, fragt Sarah.
»Was, Annie Dunne?«, fragt Billy Kerr skeptisch.
»Blut in der Milch«, antworte ich bestimmt. »Die gehört von Rechts wegen geschlachtet.«
»Meinst du wirklich, Annie Dunne?«, fragt er. »Das ist ein bisschen unchristlich. Die Kuh ist alles, was sie besitzt. Sie braucht sie zum Leben.«
»Sie ist eine schmutzige alte Frau, die im Dreck haust, das ist die Wahrheit«, sage ich und ärgere mich sofort über den Zorn, der in mir aufgestiegen ist. Mein Vater sagte immer, manche Leute verwechseln Freundlichkeit mit Dummheit. Nicht, dass das bei mir zu befürchten wäre. Aber es gibt eine andere Art von Dummheit, die Dummheit einer zornigen Frau.
»Du wunderst dich vielleicht, dass ich mich für sie einsetze«, sagt Billy Kerr. »Ich kenne sie kaum, das stimmt, auch wenn sie schon mein ganzes Leben lang auf der anderen Seite von eurem Feldweg lebt. Ihre Kuh kenne ich auch nicht besonders gut, hab sie nur aus der Ferne gesehen. Aber sie ist nun mal die Cousine meiner Mutter und eine anständige, vernünftige Frau. Bei uns nennen wir sie Nanny Callan.«
»Blut in der Milch«, sage ich noch einmal, aber nicht weil ich Spaß daran hätte, sondern nur, weil ich so dumm gewesen war, selbst das Gespräch anzufangen. »Ich fürchte mich davor, was sie im Brunnen zurücklässt. Sie hat nur den einen Eimer, das weiß ich, zum Melken und zum Wasserholen.«
»Ich bin mir sicher, dass Mary Callan mehr als nur den einen Eimer hat«, sagt Billy Kerr. »Verkaufen die Kesselflicker sie nicht für zwei Pence an den Haustüren? Jedenfalls ist sie meine Cousine. Das sollte Grund genug für dich sein, nicht mehr über sie herzuziehen.«
»Hier ist doch jeder mit jedem verwandt«, sage ich aufgebracht, mehr über mich selbst als über ihn. Was geht mich seine verdammte Verwandtschaft an? Nichts.
»Er könnte sogar mit dir verwandt sein, Annie«, sagt Sarah in einem vernünftigen, arglosen Ton, an dem nichts Gespieltes ist.
»Hoffentlich nicht allzu eng, bei dem, was er vorhat!«
»Was meinst du damit, Annie?«, fragt sie, und ein Schleier der Furcht legt sich über ihr offenes, unschuldsvolles Gesicht.
»Er weiß genau, was ich meine.«
»Tu ich nicht«, sagt er auf eine Art, die jeden Richter überzeugen würde.
»Tut er wohl«, sage ich.
Aber sicher bin ich mir nicht. Und Sarah sieht mich nicht an. Sie kann nichts dafür. Sie ist in eine Träumerei versunken. Das ist ein Trick von ihr, ihre Art – ich weiß auch nicht, vielleicht, mich zu ertragen. Gott steh mir bei! Typisch Billy Kerr, einen so durcheinanderzubringen. Ich muss ihn irgendwie aus dem Haus bekommen. Oh, wie er es genießt, mich auf die Palme zu bringen.
»Mary Callan hat mit zwei Pence oder mit irgendwelchen Eimern von Kesselflickern nichts am Hut«, sprudele ich hervor wie ein undichter Wasserhahn. Die höfliche Verachtung in meiner Stimme würde selbst einer Löwin die Kraft rauben. »In ihrem Haus gab’s nie Geld, so viel steht fest. Ihre Vorfahren waren Pachthäusler. Das kleine Haus mit dem einen Raum besteht nur aus Lehmwänden. Die Hungersnöte des letzten Jahrhunderts haben ihr die Familie genommen. 1872, man erinnert sich noch gut daran, als viele hier den Hungertod starben, hat es fast ihre ganze Verwandtschaft erwischt, sieben oder acht, die hier in der Gegend wohnten. Nur sie und ihr Vater blieben übrig. Damals war sie ein kleines Ding von fünfzehn Jahren. Angeblich ist sie jetzt hundertzwei.«
Was rede ich da? Das reinste Gänsegeschnatter.
»Annie Dunne«, sagt Billy Kerr. »Eigentlich hast du richtig Humor.«
»Nachher fahren wir runter nach Kiltegan«, sage ich zu Sarah. »Halt dich ein bisschen ran.«
»›Die Hungersnöte des letzten Jahrhunderts‹«, sagt Billy Kerr, »sehr witzig! Den Ausdruck bekommt man heutzutage nicht mehr oft zu hören.«
»Ich muss hinaus, das Pony anschirren«, sage ich und muss fast weinen – meiner eigenen Dummheit wegen.
»Das übernehme ich und spann es vor den Wagen«, sagt Billy Kerr, plötzlich ganz artig, was mir ungelegen kommt.
»Bitte nicht«, sage ich.
»Ganz wie du willst. Wäre schön, wenn ihr mich mitnehmen könntet«, sagt er mit derselben gespielten Höflichkeit. »Im Pub liegt ein Paket für eine meiner Frauen, das mit dem Bus aus Dublin gekommen ist.«
Eine meiner Frauen. Er ist doch nichts als der Sklave der Dunnes in Feddin. Wenn Lizzie Dunne das gehört hätte. Eine meiner Frauen. Natürlich könnte man seine Worte ganz unterschiedlich auslegen, darauf kann er sich hinausreden. Oh, seiner Cleverness bin ich nicht gewachsen. Ganz wie du willst. Er bringt mich zur Weißglut. Ich werde es auf keinen Fall dulden, dass er in unserem alten Wagen den vornehmen Herrn spielt.
»Du wirst schon so runtergehen müssen, wie du raufgekommen bist«, sage ich so gleichgültig wie möglich, »es wird ’ne ganze Weile dauern, bis wir so weit sind.«
»Aber du hast doch gerade erst gesagt –«, setzt er an, zum ersten Mal aus dem Gleichgewicht gebracht, aber ich bin schneller als er.
»Wo ist denn das kleine Mädchen?«, frage ich. Der abrupte Themenwechsel wird seinen Zweck erfüllen.
»In ihrem Zimmer«, sagt Billy Kerr, obwohl ich die Frage gar nicht ihm gestellt hatte.
»Gut«, sage ich und marschiere mitsamt dem Jungen hinein. Hinter meinem Rücken macht Billy Kerr eine Bemerkung zu Sarah, die ich aber nicht verstehe.
Das kleine Mädchen steht mit dem Rücken zu mir auf dem Bett. Sie trägt ihr geblümtes Sommerkleid und eine grüne Strickjacke, die ihr bereits zu klein wird.
Das Sonnenlicht, das durch das schmale Fenster fällt, strahlt auf sie herab wie eine Hoflaterne. Ein kleines Geschöpf, dem man beim Wachsen zusehen kann. Sie weiß nichts von der Welt. Sie weiß nicht, was vor ihr liegt.
Schon in dem Augenblick, als ich den Kopf zur Tür hineinstecke, kommt es mir vor, als laste eine Bürde auf ihrem Rücken. Kein Buckel wie bei mir, eine Folge der Kinderlähmung, eher ein schwerer Schatten. Dann bewegt sie sich, und das Bild ist verschwunden, eine Täuschung des Sonnenlichts und meines eigenen Verstandes.
Sie wendet den Kopf, um mich anzusehen, und in ihren Augen funkeln winzige Sterne. Ich kann mich nicht vom Fleck rühren. Und selbst der Junge, der, typisch für einen Vierjährigen – auch wenn er fast fünf ist –, nicht anders kann als herumzuzappeln, ahmt meine Reglosigkeit nach. Dann auf einmal lächelt sie, und es ist, als würde die Sonne scheinen. Ein kristallklares, ungetrübtes, unschuldiges Lächeln.
»Was machst du denn da? Auf Betten stehen und bis über beide Ohren grinsen?«
»Ich bin froh, dich zu sehen, Tante Anne«, sagt sie. »Ich hab mich einsam gefühlt.«
»Na, so weit weg war ich doch gar nicht«, sage ich. »Wir sind nur zum Brunnen gegangen. Und selbst daran wurden wir gehindert. Nächstes Mal läufst du mir einfach hinterher.«
»Ich bin froh, dass wir in Kelsha sind«, sagt sie. »Richtig froh.«
»Da bin ich aber froh, dass du froh bist«, sage ich. »Komm, hilf mir, Billy anzuschirren, diesen wilden Kerl.«
»Den interessanten Kerl, der bei Sarah ist?«, fragt der Junge.
»Nein, dem Kerl ein Geschirr anzulegen ist unmöglich. Nein, Billy dem Pony. Wir werden eine halbe Stunde brauchen, um ihn fertig zu machen. Bis dahin wird Billy Kerr ja wohl hoffentlich gegangen sein.«
Doch als ich in die Küche zurückkomme, schickt er sich bereits zum Gehen an. Sein mysteriöser Besuch scheint beendet, und er stolziert über den Hof in Richtung Feldweg. Ich stehe in der Halbtür und sehe ihm nach, wie er gleichmütig dahinstapft. Seine Hüften bewegen sich wie die eines Mannes, der zwei Eimer trägt.
Ich blicke mich zur Küche um, aber Sarahs langes, ausdrucksloses Gesicht verrät mir nichts. Sie räumt das benutzte Geschirr weg, um es später abzuwaschen, und fängt an, den Küchentisch zu scheuern. Billy Kerr hat kaum den Ellbogen darauf gestützt, umso mehr erstaunt mich ihre übertriebene Sorgfalt. Ihre langen Arme fahren über die bleiche, glatte Oberfläche, die Bürste macht ein Geräusch, als würde Stroh zusammengerecht, auf und ab und hin und her. Dann und wann taucht sie die Bürste in Salzwasser und beginnt wieder von vorn, ihre nackten Arme leuchten im Dämmerlicht.
All das ist ziemlich vielsagend, doch ich weiß nicht, was es mir sagen will. Ich beschließe, sie später zu fragen, im Bett, wenn sie entspannt ist und bevor sie sich die Decke über das Gesicht zieht. Ich habe großen Respekt vor ihrem Schweigen. Möchte sie nicht bedrängen. Wenn ich es zufällig doch tue, schlägt sozusagen die Tür ihres Gesichts im Wind, und sie fängt an, Unsinn zu reden, angsterfüllten Unsinn.
»Ich glaube, ich werde die Kinder nach Kiltegan mitnehmen und unsere Packung Tee abholen.«
»Du hättest dir Billy Kerrs Hilfe ruhig gefallen lassen sollen«, sagt sie im Plauderton.
»Na ja«, sage ich. »Für die Kinder wird es spannend sein, mir zu helfen. Der soll so runtergehen, wie er raufgekommen ist.«
»Mir egal, ob er geht oder fährt«, sagt sie. »Ich habe an deinen Rücken gedacht.«
»Mein Rücken ist völlig in Ordnung«, sage ich und erröte bis zu den Haarwurzeln.
»Natürlich ist er das«, sagt sie.
»Soll ich auch Zucker besorgen?«
»Nein«, sagt sie. »Wir haben noch reichlich.«
»Zucker und Tee. Wir leben doch wahrlich wie die Lords, Sarah, oder?«
Sarah lacht. Ihr Lachen ist kräftig und dunkel, wie die Brombeeren, die in dem großen Topf brodeln, wenn wir im Herbst Marmelade kochen. Mein Lachen hingegen, meinte der alte Thomas Byrne, der vor langer Zeit im Dublin Castle den Hof gefegt hatte, klingt wie das Bellen eines Hütehunds.
Sie steht in der Küche, aufrecht wie eine Rohrdommel in Pfahlstellung, und schwingt die Scheuerbürste. Wieder fängt sie an zu lachen.
»Du weißt doch, Annie, die einzigen Leute, die wie die Lords leben, sind die Lords«, sagt sie.
Sie legt die Scheuerbürste auf den Tisch, stützt die Hände auf die Knie und lacht. Ihr Körper biegt sich geradezu vor Lachen: So sehen Unbeschwertheit und Freude aus. Die Kinder sind vor lauter Überraschung selbst ganz aufgekratzt, sie schauen zu mir auf und fangen ebenfalls an zu lachen. Ich lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen und lache ebenfalls, laut und herzhaft, ich lache und lache, ja, genau wie Thomas Byrne gesagt hat, wie ein verdammter Hütehund: »Wau, wau, wau.«
In Wahrheit nehmen sie sich nichts, Billy Kerr und Billy das Pony, nur dass ich Ersteren nicht vor unseren zweirädrigen Pferdewagen spannen muss. Anspannen ist ein ziemlich schwieriges Geschäft.
Im Hof kommen die Kleinen und ich an einem zotteligen Fellknäuel vorbei. Es ist Shep, der in der Sonne ein Nickerchen macht. Er ist so schläfrig, dass er kaum die Schnauze hebt. Fauler als ein Faultier, aber wir haben ja ohnehin keine Schafe, die er hüten könnte.
Als wir das dunkle Rechteck der Stalltür erreichen, werfen die Kinder bewundernde Blicke auf Billy. Seine wahre Natur begreifen sie nicht, darin liegt die Barmherzigkeit von Kindern. Aus dem Dämmerlicht des Stalls erwidert Billy ihren Blick, die flache Stirn von einer Art gedämpfter Wut gezeichnet.
Billy ist ein kräftiger, eher kleinwüchsiger Welsh Cob, den Sarah auf einem Pferdemarkt in Baltinglass erstanden hat. Sie verehrt ihn, weil sie ihn mit barem Geld bezahlt hat, mit den Pfundnoten, die ihre Mutter ihr hinterlassen hatte. Er ist ein Grauer, von einem vollkommenen Grau, das muss man ihm lassen, ohne auch nur den Tupfer, den Hauch einer anderen Farbe. Aber in letzter Zeit fürchte ich mich vor seiner Kraft. Er strahlt eine Art Hass aus, die mir Unbehagen bereitet.
Der Hass steht in seinen Augen, zwei schwarzen Steinen. Was immer er sich erträumt hat, das Leben mit uns scheint ihm nicht genehm zu sein. Vielleicht lassen wir ihn nicht oft genug hinaus. Vielleicht ist das Landleben unter seiner Würde.
Behutsam hieve ich das schwere Geschirr auf seinen Rücken und muss, ich gebe es zu, an Billy Kerrs Hilfsangebot denken, das ich in meinem Hochmut ausgeschlagen habe.
»Da ist ja überall Schleim auf dem Leder«, sagt das Mädchen.
»Nein«, sage ich keuchend. Mein Rücken schmerzt. »Das ist Fett zum Schutz gegen den Regen.«
»Es ist dreckig«, sagt sie, »und ich hab’s auf meiner Strickjacke.«
»Willst du denn nicht mit dem Wagen fahren?«, frage ich. Ich weise sie nur deshalb zurecht, weil ich Schmerzen habe.
»O doch«, sagt sie. »Ich möchte schon.«
Trotz allem sieht es schön aus, wie das Geschirr auf Billy sitzt. Über die Jahre hat es sich seiner Körperform angepasst. Ich mag seinen runden Leib, wie der eines wohlgenährten Mannes. Er riecht nach trockenem Stroh und feuchtem Dung. Haar und Haut haben einen ganz eigenen fremdartigen Geruch. Er hat etwas von einem Löwen. Jedenfalls hat er mehr Klasse als Shep. Abgesehen davon, dass er aussieht, als wollte er einen umbringen, muss man ihn bewundern.
Dann sind wir auf dem Feldweg. Die beiden Kinder sitzen einander gegenüber auf den Bänken hinter mir, und wir rollen durch das sanfte Auf und Ab der Felder und Wälder. Billys Hufe schleudern kleine Dreckbatzen hoch. Was ihn so richtig antreibt, ist das Schnalzgeräusch, das ich mit den Zähnen und der Zunge mache. Wir stürzen den grünen Fluss aus Gras hinab, und die Kinder klammern sich an ihren Sitzen fest.
Ich winke Mrs Kitty Doyle zu, die gerade über ihren Hof geht und den Schweinen eine Schürze voller Futter bringt. Ich kann sie in ihrem steinernen Koben quieken hören. In einer der Scheunen hält sich ein aufgegebener Pferdewagen versteckt. Ich kann ihn gerade noch ausmachen, als wir vorüberrumpeln, ein hohes Ding zwischen den Strohballen. Dort verrottet er, und die Lampen verlieren allmählich ihren Glanz. Wieder so eine von den Familien, die sich in den letzten Jahren ein Auto gekauft haben.
Aber der Weizen der Hannigans steht gut, wie ich sehe, die kräftigen Keimlinge überziehen die dunkle Erde wie eine schöne Häkelarbeit.
Wir kommen zu der Kreuzung, wo unser Feldweg der neuen Teertrasse weicht. Ich muss Billy zügeln. An dieser Stelle tänzelt er immer nervös, denn von der Aufregung, den Berg hinunterzurasen, ist er noch ganz aufgewühlt.
In der Ferne sehe ich Billy Kerr, der die letzten paar Meter zu den Kuhställen neben dem Haus meiner Cousinen entlangschlendert. Ihre Farm liegt hinter wuchernden Hecken verborgen. Das Haus sieht seltsam aus, so mitten auf der Weide, die die Kühe zu Schlamm zertrampelt haben. Die Wände ganz aufgeraut von Feuchtigkeit und Regen.
Trotzdem, in den moosbewachsenen Gräben drängen sich Schlüsselblumen und die grünen Fontänen des Fingerhuts. Das gelbe Feuer des Stechginsters auf dem Hügel dahinter ist gerade erst erloschen. Doch Billy das Pony hat keine Geduld für solche Wunder, mit einem Ruck ist er auf der Straße, die Räder folgen der neuen Melodie des härteren Straßenbelags, und unsere Wangen schwabbeln, so heftig werden wir durchgeschüttelt.
»Mach langsam, du wildes, verrücktes Pony, du«, sage ich und versuche, ihn zu bremsen. Zuinnerst weiß ich, dass er jetzt am liebsten in leichten, dann in wilden Galopp fallen würde, um uns alle davonzutragen, sich selbst und die unzulänglichen Menschen in dem Gefährt, in einem so irren Tempo, dass die Steinchen wegspritzen, und um die Welt in Gefahr und Ängste zu stürzen. Das kann ich nicht zulassen, und so stehe ich auf, lehne mich zurück und zwinge ihn zu einem unruhigen Schritt.
»Sche-ritt, du alter Halunke, du«, rufe ich und bearbeite die Trense mit den Zügeln herzlos mal von links, mal von rechts. Aber der niederträchtige Kerl veranstaltet noch mehr Theater als sonst und bockt. Das Gefüge aus Wagen und Pony biegt sich in der Mitte, und plötzlich habe ich Angst, dass wir im Graben landen. Die Kinder hinter mir schnappen nach Luft bei dem widrigen Schlingern und Ächzen der Scherbäume, die wie eine riesige Stimmgabel in Schwingung geraten sind.
»Weiter, geh weiter«, sage ich und würde ihn gern verfluchen, was ich mir jedoch verkneife, der Kinder wegen, für deren Erziehung ich verantwortlich bin. Und jetzt geht Billy weiter, nur um wieder einen Schritt rückwärts zu machen. Er ist fest entschlossen, mir übel mitzuspielen. Ich könnte ihm eins mit der Peitsche überziehen, müsste ich nicht die Wirkung fürchten, die ein Peitschenhieb bei seiner momentanen Gemütsverfassung hätte. Ich hüpfe auf dem hölzernen Sitz auf und ab und bin selbst schon ganz verrückt im Kopf vor lauter Sorge und Wut.
»Steh, steh, du Teufelsbraten«, rufe ich. »Steh! Kinder, macht den Wagenschlag auf und springt von den Metallstufen ab. Ich glaub, ich kann ihn nicht halten.«
Und das kleine Mädchen, das schon mehr von der Welt versteht, kümmert sich um den Jungen, öffnet die kleine Klappe aus Sperrholz und lässt sich und den Kleinen hinabgleiten, eine beachtliche Höhe für ein Kind. Doch dem Herrgott sei Dank, im Nu finden sich die beiden zu ihrer eigenen Verblüffung auf dem grasbewachsenen Straßenrand. Und die große Maschine, so muss es ihnen scheinen, des Pferdewagens, mit mir obenauf, buckelt und bäumt sich von neuem.
»Kinder, bleibt ganz ruhig stehen«, sage ich. »Gott im Himmel!«
Billy hat die Trense fest zwischen die Zähne genommen. Jetzt hat er mich.
Das ist die Katastrophe. Zum Fürchten. Sarah wird mir nie verzeihen, wenn ich ihn nicht wieder zur Vernunft bringe. Denn sie schätzt dieses törichte, gefährliche Tier. Der Schrecken hat von mir Besitz ergriffen, weil ich fast vorhersehen kann, was Billy als Nächstes tun wird. Ich kann’s vorhersehen, vielleicht noch bevor er es denkt, denn er ist ein Tier, das ganz in der Gegenwart lebt, im flüchtigen Augenblick. Oder er hat es schon vor Jahren ausgeheckt, immer wenn er mich mit diesen bösen Augen ansah. Und nun geschieht’s, der Sprung, die Raserei, die wie eine Feder gespannte Energie, das lodernde Feuer in seinem runden Bauch – und er ist auf und davon, in Richtung Kiltegan, und nur ich, diese Närrin, kann ihn daran hindern.
Wir preschen ein paar hundert Meter dahin, wobei er fröhlich ein Hufeisen verliert. Der harte Straßenbelag reißt es ihm vom Huf. Es fliegt über die Hecke von Humewood, dem alten Gutshof, der im Leben meiner Vorfahren eine so wichtige Rolle gespielt hat. Billy beachtet es nicht. Dann bricht, wie ein Feuerwerkskörper, aus dem Dickicht der niedrigen Bäume zu meiner Linken etwas hervor, das ich zunächst für einen Keiler halte, für einen Keiler mit stoßbereiten Hauern. Es ist wie eine Erscheinung – erst ist da nur die ungepflegte friedliche Hecke, und auf einmal ist ein Loch hineingesprengt, und das wilde Geschöpf landet vor mir auf der Straße.
Aber in Irland gibt es keine Keiler, außerdem ruft und lärmt dieses Geschöpf und wedelt mit den Armen. Es erhebt sich, offenbart rätselhafte Gliedmaßen und verwandelt sich zu meinem dankbaren Erstaunen in Billy Kerr.
Da steht er nun mitten auf der Straße nach Kiltegan, wirft die Arme in die Höhe, springt auf und ab und ruft dem wütenden Pferd »Ho! Ho!« zu. Das Pony reagiert auf seine typische Art, bleibt abrupt stehen, bäumt sich auf und zeigt die Vorderhufe, lässt sich dann wegen des Gewichts des Wagens schwer nach unten fallen, schlägt ein-, zweimal nach hinten aus, steigt wieder hoch und wiehert, die angespannten Kiefer so weit aufgerissen, wie es einem Pferd möglich ist. Der Wagen kippt nach links weg, neigt sich so weit, dass ich aus meinem gefährdeten Nest falle und im Ampfer lande oder was sonst noch im Straßengraben wächst.
»Steh auf, Annie Dunne, wenn du kannst«, brüllt Billy Kerr, »und versperr ihm den Weg nach hinten. Dann haben wir ihn.«
Zwar weiß ich nicht, ob ich noch lebe oder schon tot bin, aber ich rappele meine alten Knochen auf, pflanze meine Füße auf den Asphalt und hebe die Arme. Vor lauter Angst und Schrecken zittere ich am ganzen Leib. Meine blau-weiße Kittelschürze ist schlammverschmiert. Mir klopft das Blut im Kopf. Billy Kerr greift nach der wehenden Mähne des Ponys und packt mit düster grollenden Lauten das Halfter, dann wird seine Stimme plötzlich ganz besänftigend und weich.
»Schon gut, schon gut, ganz ruhig, ganz ruhig, bist ein guter Junge«, sagt er.
Er streichelt das Pony, als wäre es ein kleines Kind, das gerade etwas Schreckliches erlebt hat. Das zitternde Pferd, dessen Fell bebt und zuckt, lässt sich von den honigsüßen Worten beruhigen, tritt hierhin und dorthin wie ein Betrunkener. Billy Kerr reibt seinen kräftigen Hals.
»Die Kinder«, sage ich, drehe mich um und humpele die Straße entlang zurück zu der Stelle, wo sie noch immer gehorsam warten.
Alte Kelsha-Knochen können nicht einfach liegen bleiben und blaue Flecken zählen, so viel steht fest.