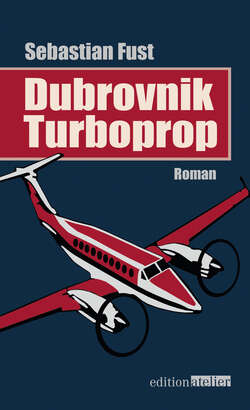Читать книгу Dubrovnik Turboprop - Sebastian Fust - Страница 7
I
ОглавлениеDas Gras war taubenetzt, die Wolken silbergrau und die Sonne brach dann golden durch, es war Sommer, August, und ich ging auf den weißgrauen Betonbau zu, die manifestierte Siebzigerjahre-Architektenfantasie, vielstöckig, die Außenstelle des Altersheims, das Gebäude für betreutes Wohnen, ich holte die Großmutter ab, die feine alte Dame mit ihrem kaputten Knie; allenfalls war Laufen mit einem Gehwagen möglich, aber umständlich, und wenn, dann nur kurze Strecken, ansonsten griff man auf einen Kassenrollstuhl zurück. Die Luft war frisch, und ich fuhr mit dem Aufzug in den dritten Stock, klingelte, und Frau Dresenkamp, eine Russlanddeutsche, eigentlich Deutschlehrerin von Beruf, hier in Deutschland aber ohne Arbeit, dafür mit elfjähriger Tochter und Ehemann, auch Russlanddeutscher, Ingenieur, jetzt Handwerker und teilzeit- oder schwarzbeschäftigt, also nur ab und an beschäftigt und sonst zu Hause, zu Hause vor dem Computer und spielsüchtig, passte jetzt auf die Tochter, oder die Tochter auf ihn, auf, denn es waren Schulferien, und Frau Dresenkamp öffnete die Türe, sie, die bezahlte Stütze meiner Großmutter im Alter, beim betreuten Wohnen, sie erledigte kleinere Einkäufe, wusch die Wäsche, spülte das Geschirr und war eigentlich nur zum Reden, zum Ansprechen, zur Unterhaltung der alten Frau dort und bezahlt, als Abglanz dessen, was es einst war, was es für die feine alte Dame gewesen war, das Leben, denn Dienstmädchen hatte sie immer gehabt, die Großmutter, und jetzt eben, im Alter, in ihrer Hinfälligkeit blieb eben nur noch die Frau Dresenkamp, als Stütze und Rückversicherung gegenüber dem einstigen Leben, als Zeichen des Vergangenen, Platzhalter des Vergangenen, ein Statussymbol, das sich die feine alte Dame leisten konnte und wollte, ja, leisten musste, um nicht ins Nichts zu fallen, noch nicht ins Nichts zu fallen, um zumindest einen kleinen Halt im Alter zu haben, eine Rückbindung an sich selbst und an das einstige Leben, von dem jetzt nur eine Erinnerung und eben dieser Rest, wie gesagt, als Rückversicherung – zumindest kam es mir so vor – übrig geblieben war, und jetzt öffnete sie, Frau Dresenkamp, die Türe und ein Schwall warmer, abgestandener Luft kam mir entgegen. Aus dem Wohnzimmer hörte ich die Stimme meiner Großmutter, hörte ich die alte Dame rufen:
»Alexander, bist du das?«
Ich antwortete »Ja!« und gab Frau Dresenkamp die Hand.
»Wollen wir los?«
»Wir können.«
Auf der Fahrt erzählte die Großmutter, wie sie sich freute, noch einmal, ein letztes Mal nach Dubrovnik zu reisen, mir diese Reise ermöglichen zu können, und sie erzählte von Ivo, dem Reiseleiter, den sie dort, nach dem Tod ihres Mannes, meines Großvaters, von dem sie immer nur als »der Vater« sprach, den sie also nach dem Tod des Vaters kennengelernt hatte, weil sie sich hatte ablenken und erholen müssen nach dem Tod des Vaters, und da war sie nach Dubrovnik gereist, Dubrovnik, warum auch immer, damals noch Jugoslawien und zwischen den Blöcken Ost und West, für sie unbekannt, Terra incognita, wie für mich Mumbai, Baku oder Taschkent, gleichviel, aber der Name Dubrovnik schien ihr etwas zu versprechen, hatte eine Sehnsucht in ihr ausgelöst, klang wie Gold in ihren Ohren und hallte in ihrer Fantasie wider und wurde größer und fantastischer, und so buchte sie eine Reise, flog dorthin, denn Geld spielte keine Rolle – Gott sei Dank! Der Vater hatte vorgesorgt –, und dann war sie dort angekommen, in Dubrovnik, das so schön geklungen hatte, und auf dem Flughafen wurde sie vom Reiseleiter, wurde die ganze westliche Touristengruppe, den sozialistischen Tourismusvorgaben entsprechend, vom Reiseleiter abgeholt. Der Reiseleiter hieß Ivo. Zwanzig Jahre jünger als sie und ein Gentleman, ein wahrer Gentleman, naturgemäß, und Dubrovnik hielt, was der Klang des Namens, dem Fallen einer Münze gleich, deren Klang auf dem Boden nicht bricht, sondern nur heller erklingt, versprochen hatte. Und von dort aus ging das Leben meiner Großmutter weiter, es ging ihr besser, sie flog ein- oder zweimal im Jahr dorthin, damit es ihr besser ginge, und ja, es tat ihr gut, die Menschen, die Stadt, die Luft, die frische Luft, immer direkt am Meer, und zum Meer hin ging das Zimmer; und sie, auf dem Balkon, schaute am späten Nachmittag bis in den Abend hinein, bis zum Abendessen, hinaus aufs Meer, das Mittelmeer, gegenüber Italien, irgendwo, unsichtbar. Die Wellen klatschten lustig und monoton und beruhigend an den Kieselstrand, nach dem Essen nahm sie ihren Digestiv auf dem Balkon, das Meer war schwarz und in der Ferne sah sie die Lichter der Fischerboote und manchmal die der Tanker, und immer ging das Meer ruhig, fast berechenbar, mathematisch beruhigend, und so schlief sie ein, bei offenem Fenster, um sie herum die frische, salzige Luft. Morgen würde sie wieder in die Stadt gehen, in die Altstadt, in einem Café einen Cappuccino trinken, dann über das Kopfsteinpflaster, den Marmor, das Marmorpflaster, über die Stadtmauern, die Schutzmauern, die Befestigungsmauern der Altstadt den Rundgang entlangspazieren, den Rundgang, früher für die Patrouillen gegen Feinde und Piraten, heute für Touristen, und morgen würde sie wieder diesen Weg gehen und der Reiseleiter, ja, Ivo würde sie begleiten, ihr dies und das über die Stadt und über die Geschichte der Stadt erzählen, und sie würde ihm nicht zuhören, auch morgen nicht zuhören, sondern einfach nur darauf achten, wie sich beim Sprechen, wenn Ivo zu ihr sprach, wenn er von der Stadt, von der Geschichte der Stadt und manchmal auch von der des Landes, oder wenn er einfach nur über das Wetter sprach, wie sich seine Nasenspitze bewegte, wie sich die Grübchen in seine Wangen schoben, das linke etwas stärker ausgeprägt als das rechte, und wie er mit seinen feisten Händen, auch wenn der restliche Körper sonst sportlich und kräftig, gerade für einen Mittsechzigjährigen sportlich und kräftig war, abwechselnd durch die kurzen, borstigen, teils grauen, aber kräftigen Haare fuhr, den Schädel vielleicht verlegen, vielleicht nachdenklich rieb, streichelte, unbewusst, aber entzückend – an solches und dergleichen vieles mehr denkend schlief meine Großmutter ein, bei offener Balkontüre, offenem Fenster, hin zum Meer, und die frische salzige Luft strömte ins Zimmer, die Wellen klatschten beruhigend monoton die Nacht hindurch an den Kieselstrand, und am Morgen, wenn die Sonne durch das Grau der Wolken sich erst silbern in den Wolken ankündigte und sie dann golden durchbrach, und die alte Dame mutmaßlich von den ersten Schreien der Seemöwen geweckt wurde und sie mit einem Seufzer erwachte, (denn alles war, wie sie es sich wünschte oder erträumte) wusste sie, dass sie ihm auch heute nicht zuhören würde, sie würde ihn einfach nur anschauen und anschauen können, denn er würde da sein, bei ihr sein und sie durch die Stadt führen, wie immer durch die Stadt führen, denn das ging jetzt schon ein paar Jahre so, und es ging immer gut. Manchmal lächelte man sich auch verlegen an, gerade, wenn man nicht sprach – auch dafür war er bezahlt worden.
Das erzählte die Großmutter auf der Fahrt zum Flughafen nach Augsburg, so oder zumindest in Teilen, den Rest konnte ich mir denken, denn die Geschichten hatte sie mir oft genug erzählt, auch, fuhr sie fort, dass ja dann der Krieg, der Bürgerkrieg gekommen war und sie deswegen nicht mehr nach Dubrovnik hatte reisen können, und dass sie in dieser schwierigen Zeit, der Kriegszeit, dem Ivo immer Carepakete geschickt hatte, Päckchen mit Kaffee, entkoffeiniert, und Süßigkeiten und Zigaretten und einem netten Brief, dass sie an ihn denke – und sobald der Krieg vorbei gewesen war, war sie noch einmal hingeflogen, und dann noch einmal – und jedes Mal war dort der Ivo gestanden, der treue Ivo, am Flughafen war er jedes Mal gestanden, nur um sie, diese Male nur sie alleine, abzuholen. Auch das wusste ich, und ich nickte freundlich, denn es war schön, wie sie es erzählte, es immer wieder erzählte, einer Litanei gleich wiederholte, geradezu heraufbeschwor, und wie ihre Bäckchen dabei rot wurden, ihr Gesicht von innen her zu leuchten begann, von innen her von einem Licht und einem Glück, einem glücklichen Gedanken, dieser schönen Erinnerung durchdrungen wurde. »Ja, der Ivo. Wenn ich jünger gewesen wäre, nur etwas jünger, wer weiß …«, und dann lachte sie, wie immer, wenn sie das erzählte, aber jetzt ein wenig aufgeregter, aufgekratzter als sonst, und sie fasste sich dabei an das kaputte, geschwollene Knie, denn jetzt, in nur wenigen Stunden, würde da nicht der Ivo wieder am Flughafen stehen, nur für sie am Flughafen stehen, fünf Jahre später, so, als wäre nichts gewesen, keine Zeit vergangen? Sie lachte, und dann, fast schüchtern, etwa wie ein kleines Mädchen es tun würde, schaute sie sich zur Rückbank um, wo Frau Dresenkamp saß, die Frauen schauten sich flüchtig an, und ich glaube, Frau Dresenkamp lächelte zurück, und dann schlief meine Oma ein.
Augsburg hat einen Flughafen, einen kleinen Flughafen, ich wusste, bevor wir den Flug gebucht hatten, nicht einmal, dass die Brecht-Stadt überhaupt einen hat, aber sie hat einen, einen Regionalflughafen, von dort gingen Ende der Neunzigerjahre die einzigen Direktflüge nach Dubrovnik, nicht billig, aber die einzige Möglichkeit, und Geld spielte keine Rolle, dem Vater sei Dank, und außerdem sollte es die letzte Reise der greisen Dame sein, zumindest, wenn es nach ihr ging, und als die kleine Propellermaschine Fahrt aufgenommen hatte, als wir starteten und hörten, wie das Fahrwerk eingezogen wurde und sich die vielleicht zwanzig Passagiere darauf vorbereiteten, darauf hofften, die Anschnallgurte lösen zu dürfen, denn dann wäre die gefährliche Phase des Abhebens überstanden, da sagte sie:
»Alexander, ich bin froh, dir diese Reise noch ermöglichen zu können.« Und ich lächelte sie an und sagte: »Schön, dass du das noch einmal machst. Hättest du nicht gedacht, oder?« »Ja. Ja.«, sagte sie, fasste mich an der Hand und nestelte mit der anderen an ihrer silbernen Halskette.
»Nervös?«
Sie schaute mich an und grinste. »Die Halskette. Weißt du, woher ich die hab? Die hab ich aus dem Krieg.« Und dann erzählte sie, wie in den letzten Kriegstagen ein Zug mit verwundeten Soldaten und mit Flüchtlingen, Frauen und Kindern, der Zug auf den Dächern der Wagons jeweils großflächig mit dem Roten Kreuz gekennzeichnet, also als Krankentransport ausgewiesen, durch die Genfer Konvention geschützt, von Tieffliegern beschossen worden war. (Als Kind sah ich noch die Einschusslöcher im Bahnhofsschuppen, kurz unterhalb des Giebels, glatte Löcher im gelb gestrichenen Holz, eine Salve.) Der Zug kam kurz hinter dem Bahnhof, hinter dem Bahnübergang, in der Schneise eines Hügels, zum Stehen, und sie erzählte, wie sie mit ihrem Hausmädchen eine der ersten an der Unfallstelle, ja, sie sagte Unfallstelle, der Krieg als Unfall, nicht einfach Unglück, nicht Schuld, sondern einfach Unfall, wie sie also eine der ersten gewesen sei an der Unfallstelle, und erzählte vom Schreien und Stöhnen der Verwundeten (der Flüchtlinge) und Doppeltverwundeten (der Soldaten, Verwundete der Ostfront, die nun durch Bayern lief) und Sterbenden (Soldaten wie Flüchtlinge) und dem Dampf, der aus dem Lokkessel wie aus Poren zischte und nutzlos pfiff und langsam, wie das Schreien und Stöhnen der Sterbenden leiser wurde, wie sie versuchten zu helfen, unsicher, in Angst, dass die Tiefflieger wieder zurückkehren würden, und in Angst, dass sie die Tiefflieger bei all dem Lärm der Verwundeten und Sterbenden und dem aus dem Lokkessel pfeifenden Dampf zu spät hören würden, zu spät, um selbst in Deckung gehen zu können, und wie sie, die beiden Frauen, die Dame mit dem blauen, dem fein geschnittenen blauen Kleid, dem Kleid aus gutem Stoff, einem Stoff, der weich fällt, in Wellen, einem Stoff, der wie Wellen über den Körper fällt, und ihr Hausmädchen, zwanzig Jahre alt vielleicht, die Haushaltsschürze, leuchtend weiß, umgebunden, um die schmale Taille gebunden, wie sie, die beiden Frauen, schließlich auf die erste Verwundete trafen. Sie fanden eine junge Frau neben den Bahngleisen, die sich aus dem Zug gerettet hatte, nur um jetzt, eben noch jung wie sie war, neben dem Gleisbett zu liegen, nicht viel älter als die Dame im blauen Kleid, eine Bäuerin vielleicht, rosa Kopftuch mit weißen Punkten, strähniges Haar, Bauchschuss, mit dunklem Blut auf dem blauen Bauernkleid (von anderem Blau, heller, fröhlicher, aber aus grobem Stoff, kratzendem Stoff, unmöglich geschnitten, gerade geschnitten, sackartig, mit einem hellbraunen, abgewetzten Ledergürtel (Schweineleder) in der Mitte zusammengerafft), das dunkle Blut, das nicht zu stoppen war und sich immer mehr und nutzlos verströmte, wie der Dampf aus dem Lokkessel, und als die Bauersfrau nach ihrem Kind fragte, die beiden Frauen nach dem Kind fragte, und, da es nun ans Sterben ging, trotz der Schmerzen ruhig, unbegreiflich ruhig war, wie sie da am Bahndamm, im Frühjahrsgras lag, wie sie dalag, drum herum Feldblumen, und als sie fragte, wie es ihrem Kind ginge und sich die beiden Frauen umschauten, auf den Dampf, den der Lokkessel ausstieß, energiegeladen, aber nutzlos, und das Blut aus der Bäuerin quoll und die Sterbenden schrien und dann wimmerten, nur um dann noch einmal, ein letztes Mal zu schreien, sich aufzubäumen oder schlicht in sich zusammenzusacken, und die beiden Frauen (jetzt, in ihrer Ratlosigkeit ohne Hierarchie, das Angestelltenverhältnis beinahe aufgehoben) ängstlich auf das Surren möglicher Tiefflieger lauschten und die Bäuerin im Gras liegen sahen, wo es für die Bäuerin keine Rettung, sondern nur ein Sterben gab, da schauten sich die beiden Frauen, die zur Hilfe geeilt waren (sicherlich war die Milch auf dem Herd längst übergekocht und der Topf, wenn überhaupt, nur schwer wieder zu säubern, aber wer wollte daran denken?), an und sagten, eine von beiden sagte, meine Großmutter sagte: »Deinem Kind geht es gut. Es ist dort hinten und wird gleich in Sicherheit gebracht. Sie retten zuerst die Kinder, dann die Verletzten.«, und die Bäuerin antwortete, dass es so gut sei. Eine der beiden Frauen sagte, dass gleich Hilfe kommen würde, und die Bäuerin lächelte und gab der Frau, die zu ihr gesprochen hatte, eine silberne Halskette, an der ein Hampelmann aus Silber hing, welcher zwischen den Beinen einen silber gewirkten Faden hatte, der, wenn man an ihm zog, die Arme und Beine des Hampelmanns bewegte, so bewegte, wie sich nur ein Hampelmann bewegen konnte, und die Bauersfrau sagte, sie solle es doch bitte ihrem Kind geben. »Ja«, sagte die Frau zur Bäuerin im Gras zwischen den Blumen, mit dem Blut auf dem blauen Bauernkleid. Dann hörten sie die Tiefflieger wiederkommen, und die beiden Frauen flohen über die Böschung hinter einen Baum, versteckten sich hinter dessen moosbewachsenem Stamm (und dachten: Nordwest!), hörten das Anschwellen der Propellergeräusche der Tiefflieger und dann das Rattern der Maschinengewehre, und als die Tiefflieger fort waren, gingen sie zur Bäuerin und fanden sie tot.
Meine Großmutter erzählte, dass niemand gerettet wurde. Auch die Kinder, die sich im Zug befunden hatten, waren umgekommen. Zwei im Zug, eines auf dem Bahndamm, zwei auf dem Weg ins Krankenhaus.
Seitdem trug sie immer diese silberne Kette mit dem silbernen Hampelmann.
Das sagte sie, und dann drückte sie meine Hand und schlief ein, den Kopf leicht zur Seite geneigt, und der Kopf mit dem silbernen, dauergewellten Haar vibrierte mit dem Körper des Flugzeugs, atmete mit den Geräuschen der Propeller, und so flogen wir, meine Großmutter, Frau Dresenkamp, die nervös eine Frauenzeitschrift durchblätterte, ohne zu lesen durchblätterte, nur um dann wieder, gleichfalls ohne zu lesen, von vorne anzufangen, und ich, über die Alpen, flogen etwas über das Mittelmeer und von dort nach Kroatien. Ich schaute aus dem Fenster und sah unter uns die Städte und Dörfer und die karstige Landschaft, kaum Grün, alles gelb und braun, dazwischen seltsame Wege, nicht Straßen, wie man sie kennt, die sich grau durchs Land schneiden, gewunden und verschlungen die Berge hocharbeiten, sondern schnurgerade Wege, durch die Berge, an Berghängen, alles erdig, nicht asphaltiert, scheinbar, von oben, aus der Propellermaschine heraus betrachtet, als wären die Wege mit einem Lineal gewogen worden, wären dort, als Ausdruck eines festen Willens oder einer fixen Idee, vielleicht auch einer logischen Konsequenz, die sich im Strich den natürlichen Anforderungen, Notwendigkeiten und Restriktionen der Möglichkeiten des Straßenbaus schlicht widersetzten und so der Kraft ihrer reinen Idee Ausdruck zu geben vermochten: In die Landschaft, durch das Tal, in den Berg hineingefräst. Ich konnte mir das nicht erklären, ich saß einfach staunend und betrachtend da, neben der schlafenden Großmutter, und blickte ungläubig nach unten, als wir dort oben in den Wolken hingen und die Propeller laut surrten, und ich dachte, dass diese schnurgeraden Wege vielleicht Relikte des Krieges seien, Versorgungsstrecken, eilig und dringlich dort hingebaut, hineingepflügt, und jede Linie Ausdruck des Willens, der Absicht hin zum Sieg, jetzt nutzlos und immer noch dort, einfach da, wie liegen gelassen oder wie Mahnmale: Für wen? Gegen wen?
Der Dubrovniker Flughafen, flach auf dem Boden ausgebreitet, drückte einen leeren sozialistischen Stolz aus. Hier und da kleinere Maschinen, von Tourismus nicht zu sprechen, nicht wirklich, alles in Ocker und Brauntönen, Lederimitat, Linoleum, dazu der aufgewirbelte Staub der Landefläche. Ich schob die alte Dame im Rollstuhl durch den Staub, über das Linoleum, zur Gepäckausgabehalle, sie hielt ihre Handtasche auf dem Schoß, draußen war es heiß, drinnen kalt, aber stickig. Frau Dresenkamp trottete hinterher, und wir holten das Gepäck vom Gepäckband, dann schob Frau Dresenkamp die alte Dame und ich den Gepäckwagen (Koffer, Taschen, Geschenke), bis wir zum Ausgang kamen, die elektronische Schiebetüre öffnete sich, und da stand er, der Mann, der Ivo. Meine Großmutter seufzte verzückt: »Hallo!«
Und: »Guten Tag.«
Und: »Freut mich.«
»Wie war der Flug?«
»Gut.«
»Schön.«
»Lange her.«
»Ja.«
Und: »Ja.«
Dann zum Hotel, dem alten Hotel, dem Hotel von früher, endlich. Auf der Fahrt dorthin in einem alten Mercedes 200D ohne Kühlergrill in Braun, das vielleicht einmal Metallicbraun gewesen sein mochte: noch ein alter Bekannter, Imre, der Taxifahrer, früher einmal Taxifahrer in Pforzheim, seit dem Zusammenbruch des Kommunismus wieder in Jugoslawien, seiner Heimat, und nach dem Krieg in Kroatien, seiner Heimat. Er sagte »Hallo« und freute sich, und meine Großmutter flüsterte mir zu: »Man kennt mich hier.« Ich lächelte sie an und kurbelte das Seitenfenster herunter, der Wind wehte mir durchs Haar und über das Gesicht. Imre wusste lustige Geschichten über den Krieg und die Unverwüstlichkeit seines Mercedes zu erzählen, und die alte Dame sagte, dass auf Mercedes eben immer Verlass sei. »Wir sind immer nur Mercedes gefahren«, als Besitzer einer Wurstfabrik, industrielle Schweineschlachtung. Mit den Tieren kam die alte Dame nie in Berührung, nur der Geruch, der Gestank hätte sie beinahe krank gemacht in den ersten Jahren: »Aber dann bauten wir das andere Haus, im Stile eines Landhauses, keine Villa – eine Villa, das wäre dem Vater zu viel, zu protzig gewesen. Da war er Schwabe durch und durch. Aber Hausmädchen hatten wir immer. Wie viele habe ich nicht ausgebildet! Dabei musste ich ja selbst die schwäbische Küche erst lernen! Habe ich Kartoffeln als Beilage bereitet, oh, da war’s aus! Du kannst einem Schwaben keine Kartoffeln servieren. Spätzle und Soß’ – und saure Kutteln, das liebte der Vater, ich konnte das nicht ausstehen, aber aus Liebe hab ich’s für ihn gemacht, und die Haushälterin hat mir dann was anderes gemacht. Jedem das Seine!« Sie zwinkerte mir zu und Ivo steckte sich eine Zigarette an, dann fiel ihm Imre ein und er reichte vom Beifahrersitz aus dem Imre die Schachtel, der nickte und sie rauchten, und Frau Dresenkamp betrachtete ihre Fingernägel, ihre in einem Metallicpastellrosa lackierten Fingernägel, und für einen kurzen Augenblick schien es, als sei sie enttäuscht, die Fingernägel nicht umdrehen zu können, und so betrachtete sie stattdessen ihre Handfläche und die Linien, die Lebenslinie, die Herzlinie und was da sonst noch ist oder war, dann entnahm sie der Handtasche eine Handcreme und cremte sich die Hände ein, penibel, langwierig, die Fingerglieder massierend, den Daumenballen drückend, den Handrücken mit kurzen Blicken, kurzen kritischen Blicken, wie ein Steak nach Altersflecken überprüfend und nur einen findend und diesen mit dem Daumennagel der anderen Hand kratzend, wobei sich die schwere Goldkette, die Goldkette mit den in sich gewundenen Gliedern, sanft an ihr Handgelenk der einen und weich auf die Haut der anderen Hand legte, und sie nach kurzem Reiben und Kratzen, als wäre der Altersfleck vielleicht Schmutz, der nicht weg ging und dem Daumennagel standhielt, instinktiv davon abließ und sich verstohlen, wie ertappt, umblickte, während ich das Meer riechen konnte durch das offene Fenster, riechen, bevor ich es sehen konnte, der Wind fuhr mir durchs Haar und über das Gesicht, die Großmutter sagte irgendetwas, das ich nicht verstehen konnte, und ich nickte, und dann sah ich das Meer und darüber den blauen Himmel mit nur wenigen Wolken, ganz vereinzelt, weit hinten, Richtung Horizont, klein, fern, weit weg, unerreichbar. Dort hinten schien die Sonne, golden.
So erreichten wir das Hotel, etwas außerhalb von Dubrovnik, an der Peripherie von Dubrovnik, Ausdruck ehemaligen touristischen Wertes und Wertstrebens, dafür direkt am Meer, weil außerhalb. Dann ein kurzes, scharfes Bremsen, das metallisch klang, und etwas Staub, der dem Mercedes hinterherwehte, und Stoßdämpfer, die kurz eintauchten, und Reifen, die im Staub blockierten, und wieder Stoßdämpfer, die ins Schwimmen gerieten – dann hielt das Taxi, dann hatte Imre den Mercedes schlingernd vor dem Hotel zum Stehen gebracht, und die Staubwolke erbrach sich ins offene Seitenfenster. Wild West. Früher hatte man hier Karl-May-Filme gedreht.
Ich stieg aus, denn mir wurde das Los zuteil, als Erster ins Hotel zu gehen, um uns dort, wie die feine alte Dame sagte, anzukündigen. Das Hotel war ein weiß gestrichener, vielstöckiger Betonbau mit verspiegelten Fenstern, einem riesigen Kreuzfahrtschiff nicht unähnlich, eben nur mit Ecken und Kanten, aber eben auch mit Balkonen ringsum. Deck für Deck, Zimmer für Zimmer. Und drum herum die Reling. Alles in allem: Gewaltig, ja, monumental stand es dort. Ein sozialistisch-feudales Versprechen – so wahr wie die Texte von Karl May.
Und auch hier, wie mir die Großmutter erzählt hatte, war der Krieg gewesen.
Ich stieg durch den Staub die Marmortreppen zur Empfangshalle und zur Lobby empor, öffnete die mit goldenem Messing besetzten Türen, das heißt, ich wollte sie öffnen, doch kurz bevor ich nach den prunkvollen Messingtürgriffen greifen konnte, stoben sie wie magisch, und doch nur auf ein elektrisches Signal des Bewegungsmelders hin, auseinander; ich trat ins kühle und nicht wirklich helle, sondern eher düstere Innere des Hotels und schritt Richtung Rezeption. Dort sprach ich vor dem sich mir gegenüber hinter seinem Desk aufbauenden Uniformierten den Namen meiner Großmutter aus, und, nachdem er zunächst nicht allzu freundlich dreingeschaut hatte, ja, beinahe hätte ich mich nicht getraut ihn anzusprechen, lächelte er doch oder verzog sein Gesicht zu etwas, das er dafür halten mochte (und vielleicht damit verwechselt werden konnte) und griff dabei zum Telefon, nahm den Hörer ab, wählte eine dreistellige Nummer auf der Wählscheibe des Telefons, und dann wartete er, bis am anderen Ende abgenommen werden würde, wobei er mir zwischenzeitlich durch einige durchaus ruckartige Gesten, die wahrscheinlich als freundlich-höflich gedeutet werden sollten, zu verstehen gab, mich etwas, wenn auch nur kurz, zu gedulden.
Kurz darauf erschien eine feiste, groß gewachsene Frau in einem Blümchenkleid (rote, gelbe und violette Blümchen, knielang, mit einem weißen Gürtel): feistes, gelblichrosafarbenes Gesicht, im Verhältnis zum Körper kurze Arme (so schien es mir) und kleine Augen, die aus eben diesem feisten Gesicht bestimmt herausschauten – sie schien kaum zu blinzeln, alles immer im Blick halten zu wollen, denn ihr Blick war nicht stierend oder starr, sondern agil, aufgeweckt, neugierig, prüfend. Dahinter mit etwas Abstand, einem Abstand, den man durchaus als höflich bezeichnen konnte, der aber auch etwas Repräsentatives haben mochte, zwei Mädchen, zwischen dreizehn und fünfzehn, schätzte ich, die eine, die Jüngere, mit einem kleinen Stapel Bücher und Hefte unter dem Arm, die andere mit einer Umhängetasche, auf der in roten Buchstaben »Puma« zu lesen war und die der Form nach einen Tennis- oder Badmintonschläger beinhaltete, verbarg oder schützte. Die im blümchenbemusterten Kleid gewandete Frau streckte mir energisch die Hand entgegen (sie fühlte sich rau, trocken und fleischigfest an), und wir schüttelten uns die Hände, vielleicht etwas zu lange, als es für ein wechselseitiges Bekanntmachen, Begutachten und Einschätzen zulässig zu sein mochte, dann sagte sie, die Worte dabei etwas versetzt fallen lassend:
»Hallo. Maria. Alexander?«
»Hallo.«
»Wo ist denn die Großmutter?«, fragte sie dann bestimmt und nahezu akzentfrei, als habe die feine alte Dame keinen Namen, und dabei schaute sie sich um, schaute raus, schaute an der Rezeption und am Rezeptionisten vorbei (der uns jetzt für jeden verständlich freundlich angrinste), schaute raus aus dem Hotel, durch die gläserne Eingangstüre.
»Draußen«, sagte ich.
»So. Ach, das sind …«, sie gab den beiden Mädchen einen Wink, »… meine Töchter. Anne und Franceska.«
Die Töchter gaben mir, eine nach der anderen, höflich die Hand und zierten sich dabei fast ein wenig – ich wusste nicht warum, aber es hatte den Anschein, als hätten sie kurz darüber nachgedacht, einen Knicks zu machen, einen Knicks!, als hätten sie das vorher eingeübt und als wären sie sich jetzt nicht mehr sicher, denn wozu einen Knicks machen, in der Lobby, vor dem kostümierten Rezeptionisten und vor jemandem, den sie nicht kannten, vor mir – dachte ich und dachte, was ich mir denn einbilden würde, überhaupt zu denken wagen würde, das, so was! gedacht haben zu können, aber jedenfalls, egal warum, da war etwas gewesen, oder nicht? Ein kurzes Zögern, eine Unsicherheit, ein Innehalten und Abbrechen, das Nichtausführen einer geplanten Bewegung … Ja, so kam es mir vor, aber die Frau, Maria, war schon an mir vorbei und die beiden Töchter folgten der Mutter schnurstracks (wie kleine Entchen), eilten durch die gläserne Türe (und das beinahe wortwörtlich, denn fast hätte sie sich nicht schnell genug geöffnet, automatisch-magisch geöffnet, die Türe) und hielten kurz dahinter abrupt an, wobei sie scheinbar zwanglos, ganz natürlich ihre Reihenfolge aufrechterhielten (Mutter vorne, Töchter in kurzem, höflichem Abstand dahinter: quak, quak) – die Elektronik der Schiebetüre traute sich nicht, die beiden Glashälften zu schließen –, bauten sich dort auf, standen kurz still und dann rief Maria:
»Ach, hallo! Hallo! Da sind Sie ja!« und eilte auf den metallicbraunen Mercedes 200D zu. Die beiden Töchter blieben unschlüssig stehen. Ich drängte mich artig und höflich an ihnen vorbei, denn der Ivo öffnete gerade der Großmutter die Wagentüre, während Frau Dresenkamp sich selbst zu helfen wusste. Imre öffnete bereits unter sanfter Gewaltanwendung den Kofferraum. Wohin ich auch eilen mochte, es schien, ich wäre für alles zu spät, als wäre mir alles oder irgendetwas zu spät eingefallen, zu helfen, beispielsweise. Ja, so muss es ausgesehen haben und so kam es mir plötzlich auch selbst vor. Ich stürzte dann, nach kurzem Abwägen, zu Imre, um den Rollstuhl der Großmutter entgegenzunehmen – aber keine Chance, da war Imre pflichtbewusst (beinahe angegriffen in seiner Taxifahrerehre), und so schüttelte er den Kopf und verdeckte mit der mir zugewandten Schulter meinen Griff hin zum Kassenrollstuhl.
»Wie lange –!«
»Ja!«
»Hallo!«
»Schön ist – «
»Schön, ja – «
Maria und die feine alte Dame.
Ich versuchte das Gepäck auszuladen, aber auch hier war Imre schneller und verwehrte mir das Gepäckausladen durch eine unmissverständliche Handbewegung. Na gut! Dann fahre ich eben den Rollstuhl zur Großmutter, dachte ich, doch Frau Dresenkamp strich bereits das darauf befindliche Sitzkissen zurecht und rollte ihn dann selbst zur Großmutter, und diese, die Großmutter, zu der ich als nächstes eilte, wurde bereits vom höflich zuvorkommenden Ivo gestützt, der lächelnd und rauchend und also bereits stützend neben ihr stand, wie verabredet. Derweil setzten die Großmutter und Maria ihre freudige Begrüßung fort:
»Ach.«
»Ja.«
»Willkommen!«
»Schön.«
Küsschen links, Küsschen rechts, Küsschen links.
»Willkommen!«
Frau Dresenkamp hatte mit dem Rollstuhl neben der Großmutter angehalten, war aber übersehen worden in der Wiedersehensfreude. Als sie nun höflich wartend von der feinen alten Dame bemerkt wurde, wehrte diese ihre Hilfe ab:
»Nein, nein.«
Gestützt an Ivos Arm, so aufrecht und sicher wie es ihr möglich war, ging sie auf das Hotel zu, als habe jemand Geburtstag, nur ich kam mir vor, als sei ich dazu nicht eingeladen worden, seltsam. Sie gingen auf den Eingang, die Treppe zu, langsam, keine Eile, stolz und als ob es etwas zu beweisen gäbe, Schritt für Schritt, mit beiden Händen an Ivos Arm schritt sie auf die Treppe zu, und Maria nahm Großmutters anderen Arm, ebenfalls stützend – aber die feine alte Dame hielt sich mit beiden Händen nur an Ivos Arm (als könne sie nicht davon lassen, als wäre er ihre einzige Sicherheit, ihre einzige Rückversicherung – der Arm, der Ivo –, bloß: wofür?) und sagte:
»Es geht schon. Geht schon. Nur eben langsam.«
Sie lächelte Maria an und Maria sagte, dass sie das prima mache: »Prima machen Sie das!«, und dass das, die beiden Mädchen, die da oben (etwas verloren) auf dem Treppenabsatz stünden, dass das – »Anne! Franceska!« – ihre beiden Töchter seien, welche nun, immer noch unsicher auf dem Treppenabsatz stehend, einen Wink ihrer Mutter bekamen, die Treppe halb hinunterschritten, grazil, fast etwas kokett, und der feinen alten Dame die Hand reichten, ihr nacheinander, die Jüngere zuerst, die Hand gaben und das Ganze mit einem kleinen Knicks betonten, aufwerteten, meine Großmutter aufwerteten – und eben: Ich hatte es geahnt, aber vorher nicht gewusst, dass da etwas gewesen war, dass was im Busch (wie man so sagt) gewesen war, und hatte jetzt das Gefühl, es zu wissen, vielleicht, zumindest, also mutmaßlich, aber jetzt hatte ich also ganz bestimmt das Gefühl oder vielmehr das bestimmte Gefühl, meiner Großmutter bei der nächstmöglichen Gelegenheit eine ähnliche Gunst erweisen zu müssen.
»Mensch, seid ihr groß geworden!«
Mit dieser Erkenntnis, dem nun endlich benennbaren Gefühl dessen, was ich wohl offensichtlich verabsäumt hatte zu tun, stand ich noch etwas alleine da, schaute mich verlassen um und trottete dann der Gruppe wie unnütz hinterher. Nicht einmal meinen eigenen Koffer, nicht einmal meine Umhängetasche durfte ich selbst tragen.
»Nein, nein, die tragen wir für Sie!«, sagte der Concierge, der die Boys, die Laufburschen, rief, die in ihren roten Uniformen gelaufen kamen und alles Gepäck (Koffer, Taschen, Geschenke), welches der Imre inzwischen die Treppe hinaufgetragen hatte, in zwei Hotelgepäckwagen verstauten und damit wegfuhren, aber einen anderen Weg einschlugen als die feine alte Dame am Arm des Ivo und der Maria, gefolgt von Frau Dresenkamp und den Töchtern (auf halber Strecke hatte sich die alte Dame dann doch in den Rollstuhl gesetzt – oder hatte sie sich bereits vorher schon gesetzt oder von Ivo setzen lassen?), jetzt von Ivo, dem treuen Ivo, dem sie doch immer Carepakete geschickt hatte, geschoben, und ich wusste im ersten Augenblick nicht, welcher Gruppe ich folgen durfte, wollte oder sollte, weil ich für einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen war (»Das Hotel, was für eine seltsame Architektur! Gab es für den Entwurf eine öffentliche Ausschreibung? So weiß, so verspiegelt? Oder gibt es noch mehrere dieser Hotels, nur an anderen Orten, handelt es sich um eine sozialistische Einheitsarchitektur?«, fragte ich mich in Anbetracht des Kreuzfahrthotelschiffes), kurz den Laufburschen (leuchtend rote Uniformen: Wie kriegen die das hin? Neu?) hinterhergetrottet war, nicht bemerkt hatte, dass sie sich von der anderen Gruppe (Großmutter, Ivo, Imre, Maria und Entlein) getrennt hatten, den Irrtum dann aber feststellte, dabei jedoch nicht sicher war, ob es tatsächlich ein Irrtum sein konnte, weil ich mir in diesem kurzen Moment meines Platzes nicht bewusst war, dann aber wieder kehrt machte und mich der mutmaßlich richtigen Gruppe (immerhin) selbst hinterhertrug.
Das Zimmer, von dem meine Großmutter sagte, es wäre das »Zimmer wie immer« (was ihr von Maria mit »Natürlich. Selbstverständlich. Für Sie. Wie immer.« bestätigt wurde), befand sich im siebten und letzten Stock des Hotels, zum Meer hin, das Zimmer, das kein Zimmer war, sondern eine Suite in plüschigem Rosa, loftartig mit breiter Fensterfront zum Meer hin, raus zur Dachterrasse, und dahinter lag das Meer, weit, mit sanftem Wellenspiel, das Meer, und darüber Möwen und dahinter, hinter dem Meer, Italien, irgendwo, unsichtbar, und in der Ferne, am Horizont, kurz vor dem Horizont, vor dieser Linie, hinter der alles aufzuhören scheint, aber dennoch weitergeht, auch wenn es nicht so aussieht, sodass man in diesem Fall seinen Augen nicht trauen darf, kurz davor kündigte sich ein Gewitter an – am Horizont über dem Meer war es schon sichtbar, von dort wehte ein frischer, salzig riechender, angenehm kühler Wind durch die offene Glasschiebetür, die Frau Dresenkamp nun sanft zu schließen begann, während der Ivo die feine alte Dame neben den Wohnzimmertisch platzierte (den danebenstehenden Stuhl hatte Maria beiseitegenommen und einer der beiden Töchter gegeben, mit einer Anweisung, die ich nicht verstanden hatte, aber wohl die Bitte beinhaltet haben musste, den Stuhl nach draußen, vor die Türe der Suite zu stellen, denn genau das tat Anne oder Franceska), und die feine alte Dame eben dort, an diesem wunderbaren Ort platzierte, von dem aus man alles im Blick hatte, das Meer, den Ivo, die Maria, den Imre, Frau Dresenkamp, mich und die Töchter, mit dem Rücken zur Wand.
Und da war er jetzt (einem Zaubertrick gleich), der Ivo, stand in ihrem Hotelzimmer, in der Suite, mitten unter den anderen – und ständig suchte sie, die greise alte Dame, seinen Blick –, und manchmal, wenn sich wie zufällig ihre Blicke trafen, schaute sie, als sei sie schüchtern, wie beiläufig zur Seite, schaute weg, als sei es eben ein Zufall, ja, nicht einmal das!, gewesen, dass sich ihre Blicke getroffen hatten, als wäre dies beim natürlichen, beim nur allzu natürlichen Umherschauen geschehen, als habe sie ihn nicht einmal bewusst angeschaut, ja nicht einmal gesehen, sondern allenfalls und bestenfalls mit dem Blick gestreift, also so, als wäre er es gewesen, der sie angeschaut habe und sie immer wieder anschauen würde (ein Trick, den sie seit ihrer Pubertät beherrschte, ohne dass er ihr beigebracht worden wäre), und dann, wenn sie weggeschaut hatte, lächelte sie. Wie für sich. In sich hinein, als würde sie sich sagen, immer wieder selbst sagen: Welch ein Glück, welch ein Glück! (– also ein Glück, das nur die Pubertät und dann eben wieder das Alter kennt.) Und Maria begann ihre Erzählung vom Krieg und der Kriegszeit, begann die Erzählung, wie aus dem Nichts (oder zumindest auf ein Zeichen hin, das ich übersehen hatte) oder einfach eben nur so, als ob es eine Lücke zu überwinden, eine Brücke zu bauen, vielleicht auch nur eine peinliche Stille zu überdecken galt. (Manchmal ist Schweigen Silber und Reden Gold …) Sie erzählte, und ihr Gesicht arbeitete dabei, arbeitete mehr als ihr Körper, legte sich – so weit in seiner Teigigkeit möglich – mal nachdenklich in Falten, mal zog es sich wieder straff, produzierte dann ab und an ein (ungewöhnlich hohes, nicht aus dem Körper kommendes) Lachen, fror wieder ein (beinahe mitsamt der Lippen), stieß erneut Worte, einen ganzen Strom von Worten, einen Wortfluss hervor, der abrupt versiegte, sich aufstaute und von Neuem aus ihrem Gesicht hervorquoll und das teigige, fleischige Gesicht erzittern ließ, aber eben ohne ihren Körper zu bewegen, noch ihre Arme oder Hände, oder ihre Hände gar für unterstreichende Gesten zu gebrauchen. Ihre Arme und Hände hingen nutzlos herunter, als stünde sie, Maria, während sie erzählte unter Schock. Und was sie erzählte, war:
Dass sie sich freue. Dass es lange her sei. Dass sie das nicht glauben könne. Dass die Zeit schrecklich gewesen sei. Dass der Krieg schrecklich gewesen sei. Dass das Hotel im Krieg auch Kriegsschauplatz gewesen sei. Dass es beschossen worden sei. Dass es einen Brand im Hotel gegeben habe. Dass später Flüchtlinge ins Hotel gezogen seien. Dass die Hotelleitung die Verantwortung niedergelegt und geflüchtet sei. Dass das Hotel in dieser schwierigen Zeit ohne Leitung gewesen sei. Dass sie zusammen mit anderen Angestellten die Leitung interimistisch übernommen habe, sich um das Hotel gekümmert habe – und um die Flüchtlinge, sich um beides ja habe kümmern müssen. Dass ihr Mann ihr im Hotel keine Hilfe habe sein können. Dass er ja Polizist sei. Und dass die Polizisten im Krieg ja alle Hände voll zu tun gehabt hätten, sich um den Rest der öffentlichen Ordnung hätten kümmern müssen, um die Menschen, die Flüchtlinge und die ganzen Flüchtlingsströme, ja, in Wellen seien sie gekommen, und überhaupt so vieles hätten sie, die Polizisten, organisieren müssen. So, wie sie auch – und die anderen – im Hotel viel zu organisieren, zu improvisieren hatten. Und dass es da manchmal geholfen habe, dass ihr Mann bei der Polizei gewesen sei, denn der hatte Kontakte, und die Kontakte habe sie nutzen können. Und dass trotzdem das Hotel viel Schaden genommen habe. Auch wegen der Flüchtlinge. Durch die Flüchtlinge. Aber man habe sie ja nicht einfach verjagen können, nicht? Und dass es erst jetzt wieder bergauf gehe, dass die letzten Kriegsschäden erst seit einem Jahr beseitigt seien. Und dass sie jetzt Teilhaberin des Hotels sei. Mit einem kleinen Anteil, einem winzigen Anteil. Der aber wichtig sei für sie, eine Belohnung für die freiwillig übernommene Arbeit »in jener Zeit« sei. Und jetzt sei sie für das gesamte Reinigungspersonal zuständig. Nicht mehr nur auf einem Stock. Nein, für das gesamte Hotel. Auch für den Garten. Auch für die Hausmeister, den Swimmingpool und den Tennisplatz. Dass es viel Arbeit sei, aber dass es ihr auch Spaß mache, sie könne ja täglich den Fortschritt sehen, wie alles wieder aufgebaut werde. Und: dass die Touristen wiederkommen würden. Kommen sollten. Wie früher. Denn: Es sei doch noch immer schön hier, nicht? Beinahe schöner als vorher. Zumindest das Hotel. Jetzt. Man hätte es ja ohnehin modernisieren müssen. (Worüber sie lachte.) Und dass sie ihren Mann leider entschuldigen müsse, er wäre so gerne zur Begrüßung dagewesen, aber Dienst sei eben Dienst. Und dass er nebenher jetzt versuchen würde, ein Import-Export-Geschäft aufzuziehen. Dass er aber alsbald mit ihr zusammen zu Besuch kommen werde, denn sie würden natürlich zusammen den Ehrengast, die feine alte Dame, besuchen wollen.
Und währenddessen hatte der Ivo unter den anderen gestanden, hatte aufmerksam mitgehört, zugehört, gelächelt und genickt – und immer wieder hatten sich die Blicke des Ivo mit denen der feinen alten Dame getroffen, hatten sich ihre Blicke flüchtig berührt, und die Großmutter sagte ab und an: »Ach.«, »Wirklich?«, »Oh!«, »Ja.«, »Nein.«, »Das ist ja …«, »Mhm« und nickte oder schüttelte den Kopf und war bei all dem gerührt. Es war schön, die feine alte Dame so zu sehen. Und dann war Marias Geschichte vorbei und es entstand eine Pause. Nicht unangenehm, denn irgendwie begann die Luft zu knistern.
Es ging an die Geschenkverteilung, die Präsentausgabe, wobei Frau Dresenkamp, die sich während Marias Erzählung verlegen und etwas abwesend, aber nicht unhöflich abwesend, mit den Daumenballen ihrer Hände und mit ihrem Altersfleck beschäftigt hatte (der Fleck hatte immer noch nicht weggehen wollen – manchmal hatte sie ihre »Handarbeit« plötzlich, als wäre sie in diesem Moment erst selbst darauf aufmerksam geworden, unterbrochen, aber dann hatte sie doch wieder selbstvergessen damit begonnen), geflissentlich das Mitgebrachte reichte, die Päckchen und Pakete der Großmutter reichte, die sie entgegennahm und dann unter der Nennung des jeweiligen Namens weitergab an die betreffende und bedachte Person, die sich darauf artig und überschwänglich bedankte, die beiden Mädchen machten sogar einen Knicks, selbst Imre wurde bedacht und natürlich auch Frau Dresenkamp, und alles war wie ein frohes Fest, wie Weihnachten, bloß ohne Schnee, dafür ohne Firlefanz, auch wenn der treue Ivo leer ausgegangen war, wenn er nichts bekommen hatte, sondern eben nur einen Blick, einen langen Blick mit der feinen alten Dame austauschte und sie beide ihren (vielleicht) wissenden Blick teilten und still lächelten, und die Großmutter dann noch mal den sich über sie ergießenden, überschwänglichen Dank entgegennahm. Noch glücklicher: Seligkeit.
Und dann war sie müde. Erschöpft, natürlich, wobei sie sich ans geschwollene Knie fasste, die Runde auflöste und somit alle verabschiedete, und auch ich wurde verabschiedet, und zwar als Erster. Man würde sich dann zum Abendessen sehen, nicht? Neunzehn Uhr?
Ich gab der feinen alten Dame ein Küsschen links und rechts auf die Wange und ging aus dem Zimmer, aus der Suite, den Gang runter, ging den Gang entlang (ockerfarbener Teppich, weiß gestrichene Raufasertapete (vielleicht auch deren Kunststoffpendant: Wenn man auf die Erhebungen drückt, geben sie nach: Schaumstoff)) und ging einen anderen Weg, nicht den Weg, den ich im Gefolge der alten Dame heraufgegangen (und dann im Silber und Messing des verspiegelten Aufzugs hinaufgefahren) war, ich ging den Gang weiter, bis zu einem anderen Aufzug neben einer Treppe, einem schlichten Aufzug, die Türen verschrammt, abgeplatzte bordeauxrote Farbe, die Linien des Pinsels in der Farbe noch deutlich zu sehen: Ergebnis einer hastigen Renovierung (entsprechend den Überstreichungen der durch das Salzwasser korrodierenden Schiffsaufbauten), der Aufzug für Bedienstete, der Aufzug der Boys, der Kofferträger, der modernen Sklaven des Kapitalismus: eilfertig und unterbezahlt.
Ich fuhr ins Erdgeschoss und stieg kurz hinter der Lobby aus. Ich ging zum Ausgang, die elektrische Schiebetüre öffnete sich, ich stand auf dem Treppenabsatz. Schwüle Luft schlug mir entgegen. Ein diesiges Blau, der Himmel: drückend, lastend. Das Gewitter kündigte sich an, verengte den Horizont, aber es war nicht wirklich zu erkennen in dem kleinen Ausschnitt des Meeres, den man von hier aus sehen konnte, über dem Möwen und das Zirpen von Zikaden in der Luft hing – ich versuchte durchzuatmen, musste husten und ging rein, ins Hotel, ging durch die Hoteleingangstüre. Der Portier lächelte mich freundlich an, Maria stand daneben und fragte, ob ich nicht auch auf mein Zimmer wolle?
Das mir zugeteilte Zimmer lag dem der feinen Dame gegenüber, war aber keine Suite und nicht feudal, sondern schlicht, aber geräumig, dazu ein großer Balkon mit Blick aufs Meer, und das Meer ging unruhig, der Himmel hing tief und die ersten Regentropfen fielen, große Regentropfen, sie zerplatzten auf dem Beton des Balkons und klopften ans Fenster.
Maria erzählte noch einmal, wie sie sich freue, gerade auch mich kennenzulernen, und dass ich unbedingt ihre Töchter näher kennenlernen müsse, und auch und überhaupt (fuhr sie überschwänglich fort) ihren Mann, der eben mit dem Aufbau seines Import-Export-Geschäfts beschäftigt und sonst nach wie vor bei der Polizei beschäftigt sei, ihr Mann, der mich ja noch nicht einmal gesehen habe, und dass die feine alte Dame doch noch erstaunlich rüstig sei, erstaunlich rüstig, ja, in der Tat. Auch die Sache mit dem Knie sei sicherlich zu beheben. Ich antwortete »Ja, ja.« Und fragte mich, ob ich ihr Geld geben müsste für das Zeigen des Zimmers, für die Laufburschen, die mein Gepäck ins Zimmer gestellt hatten und die nun höflich im Hotelflur warteten; entschied mich aber dagegen, hatte ohnehin nichts zur Hand, dachte, es könnte auch als unhöflich ausgelegt werden, verzichtete und verabschiedete mich von Maria.
Zum Abendessen kam ich pünktlich, aber scheinbar doch zu spät. Die feine alte Dame saß mit einem vorwurfsvollen Blick, dem ich mit einem freudigen Lächeln zu begegnen suchte, aufrecht, ordentlich und stolz zu Tische, neben ihr Frau Dresenkamp, die mit dem Geraderücken des Bestecks beschäftigt zu sein schien. Die Großmutter wies mir meinen Platz ihr gegenüber am Vierertisch zu, mitten im riesigen Speisesaal, dem Hotelrestaurant, das etwa zu einem Viertel gefüllt war, die Tische selbst allerdings nur spärlich besetzt – die Hotelgäste wirkten etwas verloren in der Größe des Saales, als wolle keiner laut sprechen, als traue sich niemand, die Tischkonversation in normaler Lautstärke zu führen, geschweige denn die Stimme zu erheben, ein dumpfes Gemurmel füllte den Raum, schwoll ab und an, auf und nieder, und – wie ein Versehen – gesellte sich ab und an ein Gläserklingen hinzu. Die feine alte Dame schien jetzt wieder ausgeruht, beinahe etwas überdreht, als sei sie selbst erheitert über ihre Freude, was mich beruhigte, denn die Reise war für sie ein Triumph, eine Selbstüberwindung gewesen, und jetzt schon ein Sieg, der Anlass zur Freude im doppelten Sinn: Der Ivo, er würde sie morgen besuchen kommen, und vielleicht übermorgen wieder. Und am darauffolgenden Tag? Und die Maria? Und das Hotel – war Dubrovnik nicht wieder die Erfüllung aller Wünsche, war es nicht ein Versprechen, das gehalten worden war, nach wie vor, trotz allem, nach all der Zeit, trotz des Krieges, trotz ihres schlimmen Knies golden glänzend?
Aus diesen Gründen war sie angestachelt von den Erlebnissen des Tages und von dem Gedanken daran, was der morgige Tag bringen würde, und so fragte sie mich, was, wenn der morgige Tag doch schon so viel Gutes verhieße, was dann die gesamte Zeit hier – in ihrem Dubrovnik – erst verheißen würde! Trotzdem, warum ich zu spät gekommen sei?
»Ich habe mit meiner Freundin telefoniert.«
»Diesem Mädchen aus dem Studium?«
»Ja.«
»Na ja, wenn man jung ist! Wenn ich noch mal jung wäre, wer weiß!«, sagte sie und lachte.
Dann entschied sich jeder für sein Menü und die feine alte Dame entschied sich für eine Flasche Rotwein; nicht für sich, sondern für uns alle, denn: Gab es nichts zu feiern?
Frau Dresenkamp fragte, ob sie sich kurz entschuldigen dürfe. »Familiäre Angelegenheiten«, sagte sie und schaute nervös die feine alte Dame an. »Nichts ist so wichtig wie die Familie.«, sagte diese, und Frau Dresenkamp räusperte und verabschiedete sich mit einem Nicken.
»Gutes Personal ist heute schwer zu finden.«
Ein uniformierter Kellner servierte den Rotwein, und die feine alte Dame nahm einen großen Schluck und sagte, wie gut das tue und wie gut das schmecke und dass man im Altersheim ja immer vergesse, wie schön das Leben gewesen sei, wie gut es mitunter zu einem sei. Aber natürlich, auf der anderen Seite sei das Leben ja nicht immer gut zu einem. Wie käme man sonst in ein Altersheim? Und überhaupt: Das Leben sei keine leichte Aufgabe. Das habe schon ihr Vater gesagt. Manchmal müsse man einfach nur Haltung bewahren. Darauf käme es an. Und natürlich auch auf Glück. Und auf Sicherheit. Finanzielle Sicherheit. Liebe sei etwas, das man sich leisten können müsse. Da habe sie auch früher anders drüber gedacht. Denn: Daran denke man in der Jugend ja nicht. In der Jugend, da sei die Liebe nicht mal ein Geschenk, sondern nur eine Sehnsucht. Und deswegen würden sich die jungen Leute ja auch ständig verlieben. Aber sie, sie habe dabei immer an die ewige Liebe geglaubt, immer daran gedacht. Und als sie dann den Vater, meinen Großvater, kennengelernt hatte, da war sie sich sicher, dass das die ewige Liebe sei. Das habe sie einfach gewusst und gespürt. Aber auch das habe sie schon damals nüchtern betrachtet (so sagte sie mir, und sie sagte, dass ich das jetzt vielleicht in meinem Alter noch nicht verstehen könne, aber man würde das lernen, müsse das lernen, mit der Zeit), denn:
»Nichts ist sicher. Alles verändert sich. Die Umstände verändern sich. Immer. Ständig«, und dann spülte sie ihren letzten Bissen Cevapcici mit einem Schluck Rotwein hinunter – man müsse das nüchtern sehen, denn:
»Zunächst glaubst du an die ewige Liebe. Du machst ein paar Anläufe und dann denkst du, du hast den Richtigen gefunden, die Liebe fürs Leben. Erst wohnt ihr zur Miete, später baut ihr ein Haus und irgendwann, ja, irgendwann schenkst du ihm Kinder, weil ihr beide wollt, dass eure Liebe Fleisch wird. So geht das ein paar Jahre, man entwickelt sich, er geht mal fremd, weil das so sein muss bei Männern. Ich war immer treu, weil ich es wollte, dazu brauchst du einen Willen, aber den findet man bei Männern schwer. Das tut erst weh, aber irgendwann kommst du darüber weg, weil es so sein muss und am besten weißt du nichts davon, denn … Und dann wird man älter, und zusammen älter, und hat das mit dem Haus und den Kindern geschafft, das eine Haus ist längst gebaut, das Dach inzwischen erneuert, dann ein weiteres Haus gebaut, ein moderneres, das alte bekommt das eine Kind und das andere wird das andere Kind bekommen, wenn ihr tot seid. So geht es also über die Jahre, und es geht alles gut, ja, es ging gut, ganz gut soweit über die Jahre, die Jahrzehnte, dann stirbt der Vater, unser Vater, schließlich war er älter, aber er stirbt nicht einfach so weg, sondern er lässt sich Zeit beim Sterben, denn er stirbt an Krebs, und das dauert seine Zeit, auch im Alter, auch ohne Chemo. Und das ist hart. Hart für den Partner, weil er sich Zeit lässt, langsam weniger wird, aber zäh am Leben klebt und festhält. Das war nicht einfach für mich. Manchmal wollte ich einfach alles hinschmeißen und wegfahren. Wegfahren, einfach raus und nicht wiederkommen, erst wiederkommen, wenn es endlich vorbei ist. Ich konnte das nicht mehr sehen. Wenn ich eins gelernt habe – und du kannst alt werden wie eine Kuh, du lernst doch immer noch dazu –, dann, dass alles zugrunde geht, dass nichts bleibt, nichts bestehen, kein Wert bestehen bleibt. Was haben wir nicht alles verloren, der Vater und ich. Wirtschaftskrise, Inflation, Krieg. Immer alles weg. Alles, was dir dann bleibt, ist ein Haus, aber auch ein Haus kann abbrennen, das Dach ist marode, irgendwas ist immer, und dann ist das auch kaputt. Alles geht irgendwann kaputt. Das einzige, das bleibt, ist Gold. Gold behält seinen Wert. Gold rostet und verkommt nicht, und du musst es nicht instand halten.«
Ich nickte und wir nahmen einen Schluck Rotwein.
Dann folgten ihre Fragen nach meinem Studium und, wie sie sagte, nach dieser neuen Freundin, die ich im Studium jetzt kennengelernt habe. Ich antwortete höflich-einsilbig und gab vor, mit dem Verzehr des Nachtischs beschäftigt zu sein. Aber ich sagte, wie sehr ich mich für sie freuen würde. Für sie, dass sie diese Reise noch einmal gewagt und auf sich genommen habe.
»Hättest du vorher nicht gedacht, oder?«, sagte ich.
»Schön, dass ich dir das noch alles zeigen kann«, sagte sie.
Und dass der Ivo in der Tat ein interessanter Mensch sei.
»Ein Gentleman.«
»Ja.«
»Weißt du, man muss auch zusammenhalten können. Vertrauen fassen können. Je älter man wird, desto schwieriger wird das. Umso größer ist dann das Geschenk. Wenn dir jemand Vertrauen schenkt. Das muss man annehmen können. Das muss man erst wieder lernen. Da muss man manchmal über seinen eigenen Schatten springen. Die Freunde werden ja immer weniger. Und man selbst immer komischer.«
Und dann nestelte die feine alte Dame an ihrer silbernen Halskette und setzte den silbernen Hampelmann wie beiläufig in Bewegung, während Frau Dresenkamp mit geröteten Augen zurückkam.
»Ach, was heißt schon komisch!«, sagte ich.
Wir lästerten noch etwas über die Wunderlichkeiten und Sonderbarkeiten ihrer alten, inzwischen größtenteils verwitweten Freundinnen. Vom Lachen hatte sie Tränen in den Augen. Zum Abschied gab mir die feine alte Dame einen Kuss auf die linke und die rechte Wange:
»Ach, alt werden ist schwer, hat der Vater immer gesagt.«