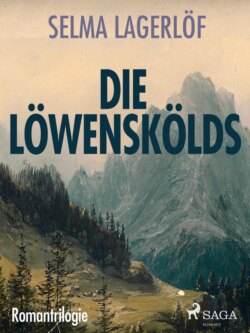Читать книгу Die Löwenskölds - Romantrilogie - Selma Lagerlöf - Страница 14
Elftes Kapitel
ОглавлениеDer junge Baron Adrian lag bleich und bewegungslos in dem großen Bett der Eltern. Wenn man ihm den Finger auf das Handgelenk legte, fühlte man, wie das Blut noch durchströmte, aber fast unmerklich. Er war nach der tiefen Ohnmacht noch nicht wieder zur Besinnung gekommen, das Leben war jedoch noch nicht erloschen.
Im Kirchspiel Bro gab es keinen Arzt; ein Knecht war schon um vier Uhr morgens nach Karlstadt geritten, um zu versuchen, einen herbeizuschaffen. Immerhin mußte man darauf gefaßt sein, daß es einen oder auch zwei Tage dauern könnte, bis er sich einfand.
Die Baronin Löwensköld saß an der einen Seite des Bettes und wendete kein Auge von dem Gesicht des Sohnes. Sie schien zu glauben, der schwache Lebensfunke würde nicht erlöschen, solange sie, ihn unaufhörlich bewachend, am Bette saß.
Der Baron saß auch zeitweilig auf der andern Seite, ihm aber war es nicht möglich, sich ruhig zu verhalten. Er nahm die eine schlaffe Hand des Sohnes zwischen seine beiden und fühlte den Puls, er trat an das Fenster und schaute auf den Weg hinaus, er machte eine Runde durchs Zimmer, um auf die Uhr im Speisesaal zu sehen. Dabei beantwortete er die eifrigen Fragen, die in den Augen seiner Töchter und der Erzieherin zu lesen waren, mit einem Kopfschütteln und ging ins Krankenzimmer zurück.
Da hinein durfte außer Jungfer Spaak niemand kommen. Nicht die Töchter, auch keines der Dienstmädchen, nur die Jungfer. Sie hatte den rechten Gang, die rechte Stimme, sie paßte in ein Krankenzimmer.
Jungfer Spaak war bei Adrians Aufschrei mitten in der Nacht aufgewacht. Als sie gleich darauf den schweren Fall hörte, war sie eiligst aufgesprungen und hatte sich, sie wußte nicht wie, in ihre Kleider geworfen; denn das gehörte zu ihren Weisheitsregeln, daß man niemals unbekleidet hinauslaufen soll, weil man sich dann nicht nützlich machen kann. Im Saal war sie der Baronin begegnet, die, um Hilfe herbeizurufen, rasch daherkam, und dann hatte sie mit den Eltern Adrian auf das große Doppelbett gehoben. Zuerst hatten alle drei geglaubt, er sei schon tot, dann aber hatte Jungfer Spaak eine kleine Bewegung am Puls des Handgelenks bemerkt.
Sie hatten einige der gewöhnlichen Wiederbelebungsversuche vorgenommen; der kleine Lebensfunke war aber äußerst schwach, und bei allem, was sie versuchten, schien er nur schwächer zu werden. Bald verloren sie den Mut und wagten nichts mehr zu tun.
Die Baronin hatte Jungfer Spaak gern um sich, weil sie ganz ruhig und felsenfest davon überzeugt war, daß Adrian bald wieder aufwachen würde. Sie ließ sich von der Jungfer alles tun, was diese wollte: das Haar kämmen und die Schuhe anziehen. Als das Kleid übergeworfen werden sollte, mußte sie aufstehen, sie überließ es aber der Jungfer, das Kleid zuzuknöpfen und zurechtzuziehen, während sie kein Auge von dem Gesicht des Sohnes wendete.
Die Jungfer kam mit einer Tasse Kaffee herein und brachte sie durch hartnäckiges Zureden dazu, zu trinken.
Die Baronin hatte das Gefühl, die Jungfer sei die ganze Zeit bei ihr drinnen. Jungfer Spaak aber war auch draußen in der Küche und sorgte dafür, daß die Leute ihr Essen wie gewöhnlich bekamen. Sie vergaß nichts. Sie war blaß wie der Tod, aber sie versäumte keine ihrer Pflichten. Das Frühstück der Herrschaften stand zur rechten Zeit auf dem Tisch, und für den Hirtenbuben war der Rucksack bereit, als er mit den Kühen auf die Weide zog.
In der Küche fragten die Dienstboten, was denn dem jungen Herrn Baron zugestoßen sei, und die Jungfer sagte, das einzige, was man wisse, sei, daß er zu den Eltern hineingestürzt sei und etwas vom General gerufen habe. Daraufhin sei er in Ohnmacht gefallen, und jetzt sei es unmöglich, ihn wieder zum Bewußtsein zu bringen.
»Eins ist sicher und gewiß, der General ist ihm erschienen«, sagte die Köchin.
»Ist es nicht merkwürdig, daß er einen von seiner eigenen Familie so unfreundlich behandelt?« wunderte sich das Stubenmädchen.
»Ach, es ist ihm wohl die Geduld ausgegangen. Sie haben ja immer nur über ihn gelacht. Er will eben seinen Ring haben.«
»Du wirst doch nicht glauben, daß der Ring sich hier auf Hedeby befindet?« sagte das Hausmädchen. »Er wäre ja imstande, uns das Haus über dem Kopf anzuzünden, um ihn wiederzubekommen.«
»Gewiß steckt der Ring hier in irgendeinem Winkel, sonst würde er doch nicht immerfort hier im Hause herumstreichen.«
Jungfer Spaak machte an diesem Tag eine Ausnahme von ihrer guten Regel, nie auf das zu hören, was die Dienstboten über ihre Herrschaft sagten.
»Was ist denn das für ein Ring, von dem ihr redet?« fragte sie.
»Ja, weiß denn die Jungfer nichts davon? Der General geht hier um und sucht seinen Siegelring«, antwortete die Köchin, die sich über die Frage freute.
Sie und das Hausmädchen beeilten sich nun, Jungfer Spaak mit der Geschichte von der Plünderung des Grabes und dem Gottesurteil bekanntzumachen; und als die Jungfer das alles erfahren hatte, zweifelte sie keinen Augenblick daran, daß der Ring auf irgendeine Weise nach Hedeby gekommen war und da verborgen lag.
Ein Zittern überlief Jungfer Spaak, wie damals, als sie den General auf der Bodentreppe gesehen hatte. Das war es ja, was sie die ganze Zeit gefürchtet hatte. Nun wußte sie genau, wie grausam und unbarmherzig dieser Geist sein konnte. Und eins stand ihr klar und deutlich vor Augen: wenn er seinen Ring nicht wiederbekam, dann mußte Baron Adrian sterben.
Die Jungfer Spaak war indes kaum zu dieser Schlußfolgerung gelangt, als sie, die eine tatkräftige Person war, auch schon erkannte, was nun getan werden mußte. Wenn sich der schreckliche Ring wirklich auf Hedeby befand, mußte man ihn auch ausfindig machen können.
Sie ging zuerst in das Wohnhaus hinüber, warf einen Blick in das Krankenzimmer, wo alles noch war wie vorher, lief die Bodentreppe hinauf und machte das Bett in Adrians Zimmer zurecht, damit alles bereit wäre, falls es Adrian besser ginge und er hinaufgetragen werden könnte. Dann ging sie zu den Fräulein und der Erzieherin hinein, die ganz verschüchtert beisammen saßen und nicht fähig waren, irgend etwas vorzunehmen. Sie sagte ihnen von dem, was sie erfahren hatte, so viel, daß sie wußten, worum es sich handelte, und fragte sie dann, ob sie ihr helfen wollten, den Ring zu suchen.
Ja, damit waren sie sofort einverstanden. Die Fräulein und die Erzieherin übernahmen es, im Hause selbst, in den Zimmern und in den Bodenkammern zu suchen. Darauf begab sich Jungfer Spaak in den Küchenflügel und setzte alle Dienstmädchen in Bewegung.
»Der General zeigt sich ebensooft in der Küche wie im großen Wohnhaus«, dachte sie. »Etwas in meinem Innern sagt mir, daß der Ring sich hier draußen befindet.«
Nun drehte man alles, was sich in der Küche und der Speisekammer, in der Backstube und im Brauhaus befand, von unterst zu oberst. Man suchte in den Mauerritzen und Feuerstellen, leerte die Gewürzschrankschubladen, ja, man stocherte sogar in den Mäuselöchern.
Über dem allen vergaß die Jungfer Spaak aber nicht, einmal ums andere über den Hof zu laufen und einen Blick ins Krankenzimmer zu werfen. Und bei einem dieser Besuche fand sie die Baronin bitterlich weinend, unverwandt den Sohn betrachtend.
»Es geht ihm schlechter«, sagte sie. »Ich glaube, er ist am Sterben.«
Jungfer Spaak beugte sich vor, nahm Adrians kraftlose Hand in ihre eigene und fühlte den Pulsschlag.
»Ach nein, Frau Baronin«, sagte sie dann, »nicht schlechter, eher ein wenig besser.«
Es gelang ihr, ihre Herrin etwas zu beruhigen, sie selbst aber war in heller Verzweiflung. Ach, ach, wenn der junge Baron nicht am Leben blieb, bis sie den Ring fand!
In ihrer Angst vergaß sie einen Augenblick, auf sich selbst achtzugeben. Als sie Adrians Hand niederlegte, liebkoste sie sie ganz sanft. Sie war sich dessen kaum bewußt, die Baronin aber bemerkte es.
»Mon dieu!« dachte sie. »Armes Kind, steht es so? Vielleicht sollte ich ihr sagen ... Aber es ist ja einerlei, da wir ihn doch nicht behalten dürfen. Der General ist böse auf Adrian, und wem er zürnt, der muß sterben.« Als Jungfer Spaak in die Küche zurückkam, fragte sie die Mägde, ob es nicht in der Gegend jemand gebe, nach dem man bei solchen Unglücksfällen schicken ließe? Ob man denn durchaus warten müsse, bis der Doktor eintreffe?
Jawohl, anderswo schicke man ja, wenn jemand etwas zugestoßen sei, nach Marit Erikstochter von Olsby. Sie könne Blut stillen und Gelenke wieder einrenken, und sie würde auch Baron Adrian aus dem Todesschlaf wecken können; aber hierher nach Hedeby würde sie wahrscheinlich nicht kommen wollen.
Während das Hausmädchen und Jungfer Spaak über Marit Erikstochter miteinander redeten, stand die Köchin oben auf einer Leiter und guckte auf das hohe Wandbrett, wo sich einstmals die vermißten Löffel wiedergefunden hatten.
»Ach«, rief sie, »hier finde ich etwas, was ich schon lange gesucht habe. Hier liegt ja Baron Adrians alte Zipfelmütze!«
Jungfer Spaak war entsetzt. Welche Unordnung mußte hier in der Küche geherrscht haben, ehe sie nach Hedeby kam! Wie konnte Baron Adrians Zipfelmütze da hinaufgekommen sein!
»Daran ist übrigens nichts Merkwürdiges«, fuhr die Köchin fort. »Sie war ihm zu klein geworden, und da gab er sie mir, damit ich mir ein Paar Topflappen daraus mache. Es ist wirklich gut, daß ich sie jetzt gefunden habe.«
Jungfer Spaak nahm ihr hastig die Mütze aus der Hand. »Es ist schade, sie zu zerschneiden, man kann sie einem Armen geben.«
Gleich darauf nahm sie die Mütze mit auf den Hof hinaus und begann den Staub davon auszuklopfen. Während sie noch dabei war, trat der Baron aus dem Hauptgebäude.
»Wir meinen, es geht Adrian schlechter«, sagte er.
»Gibt es denn niemand in der Nähe, der sich auf die Heilkunst versteht?« fragte Jungfer Spaak ganz harmlos. »Die Mägde reden von einer Frau, die Marit Erikstochter heißt.«
Der Baron wurde steif und starr.
»Natürlich würde ich nicht zögern, nach meinem ärgsten Feind zu schicken, da es sich um Adrians Leben handelt«, sagte er. »Aber dies würde nichts nützen. Marit Erikstochter kommt nicht nach Hedeby.«
Jungfer Spaak wagte keine Widerrede, als sie diesen Bescheid bekommen hatte. Sie stöberte weiter den ganzen Küchenflügel durch, sorgte für das Mittagessen, und es gelang ihr sogar, die Baronin zu überreden, einige Bissen zu sich zu nehmen. Der Ring war nicht gefunden worden, und Jungfer Spaak wiederholte einmal ums andere bei sich selbst: »Wir müssen den Ring finden. Der General läßt Adrian sterben, wenn wir den Ring nicht für ihn finden.«
Am Nachmittag wanderte Jungfer Spaak nach Olsby. Sie ging aus eigenem Antrieb. Sooft sie nach dem Kranken gesehen hatte, waren die Pulsschläge wieder schwächer geworden. Sie hatte nicht die Ruhe, auf den Doktor aus Karlstadt zu warten. Marit würde allerdings nein sagen, das war mehr als wahrscheinlich, aber Jungfer Spaak wollte kein Mittel unversucht lassen.
Marit Erikstochter saß, als Jungfer Spaak eintraf, an ihrem gewohnten Platz auf der Treppe vor dem Vorratshaus. Sie hatte keine Arbeit in den Händen, sondern saß mit geschlossenen Augen an die Wand zurückgelehnt. Sie schlief aber nicht und schaute auf, als die Jungfer daherkam, die sie auch gleich wiedererkannte.
»Ach so«, sagte sie, »schickt man jetzt von Hedeby nach mir?«
»Hat Sie wohl gehört, wie schlimm es bei uns steht, Marit?« sagte Jungfer Spaak.
»Ja, ich hab’ es gehört, und ich will nicht kommen«, erwiderte Marit.
Jungfer Spaak antwortete ihr mit keiner Silbe. Eine schwere Hoffnungslosigkeit senkte sich auf sie herab. Alles mißlang ihr, und dies war das Schlimmste von allem. Sie konnte sehen und hören, daß Marit froh war. Sie hatte da auf der Treppe gesessen und sich über das Unglück gefreut, sich gefreut, daß Adrian Löwensköld sterben mußte.
Bis jetzt hatte Jungfer Spaak ihre Fassung aufrechterhalten. Sie hatte nicht geschrien, nicht geklagt, als sie Adrian ausgestreckt auf dem Boden liegen sah. Sie hatte nur daran gedacht, ihm und allen anderen zu helfen. Marits Widerstand aber raubte ihr die Kraft. Sie fing zu weinen an, heftig und unaufhaltsam. Sie wankte zu einer grauen Stallwand hin, lehnte die Stirn daran und weinte.
Marit beugte sich ein wenig vor. Lange wendete sie kein Auge von dem armen Mädchen. »Ach so, steht es so?« dachte sie.
Doch während Marit die Jungfer betrachtete, die die Tränen der Liebe über den Geliebten weinte, ging in ihrer eigenen Seele etwas vor.
Vor wenigen Stunden hatte sie erfahren, daß der General Adrian erschienen war und ihn beinah zu Tode erschreckt hatte, und sie hatte sich gesagt, nun endlich sei die Stunde der Rache gekommen.
Darauf hatte sie seit vielen Jahren gewartet, jedoch immer vergebens. Der Rittmeister Löwensköld war ins Grab gebettet worden, ohne je von seiner Strafe getroffen worden zu sein. Allerdings war der General, seit sie den Ring nach Hedeby geschafft hatte, dort umgegangen; aber es hatte den Anschein gehabt, als brächte er es doch nicht übers Herz, seine eigenen Nachkommen mit der gewohnten Grausamkeit zu verfolgen.
Jetzt aber war das Unglück bei ihnen eingekehrt, und gleich kamen sie zu ihr, Hilfe zu erbitten! Warum gingen sie nicht lieber gleich zu den Toten auf dem Galgenhügel?
Es tat ihr wohl zu sagen: »Ich komme nicht.« Das war ihre Art, Rache zu nehmen.
Als Marit jetzt aber das junge Mädchen dort drüben mit dem Kopf an der Wand weinen sah, da erwachte eine Erinnerung in ihr. »So hab’ ich auch, so an die harte Wand gelehnt, einst bitterlich geweint. Ich hatte keinen Menschen, auf den ich mich stützen konnte.«
Und zugleich wallte die Quelle der Jugendliebe wieder in Marit auf und erfüllte sie mit ihrer heißen Flut. Verwundert saß sie da und sagte sich selbst: »So fühlte man sich damals. So war es, wenn man jemand lieb hatte. Ein so holdes, starkes Gefühl war es.«
Sie sah den jungen, frohen, starken, schönen Paul Eliasson deutlich vor sich. Sie erinnerte sich an seinen Blick, an seine Stimme, an jede seiner Bewegungen. Ihr ganzes Herz wurde von ihm erfüllt.
Marit glaubte, sie habe ihn die ganze Zeit über geliebt, und das hatte sie wohl auch. Aber wie sehr waren während der langen Jahre die Gefühle abgekühlt worden! Jetzt, in diesem Augenblick, brannte ihre Seele wieder in voller Glut.
Doch während die Liebe so in ihr erwachte, erinnerte sie sich auch an den furchtbaren Schmerz, den ein Menschenkind empfindet, wenn es den Geliebten verliert.
Marit sah wieder zu Jungfer Spaak hinüber, die immer noch weinend dort stand. Jetzt wußte Marit, was sie fühlte. Eben erst hatte die Kühle der Jahre auf ihr gelegen. Da hatte sie vergessen gehabt, wie dies Feuer brennt; jetzt wußte sie es wieder. Und sie wollte nicht die Ursache sein, daß jemand das leiden mußte, was sie selbst gelitten hatte. Sie stand auf und ging zu Jungfer Spaak hin: »Kommt! Ich will mit Ihr gehen«, sagte sie ganz kurz.
Jungfer Spaak kam also in Gesellschaft von Marit Erikstochter nach Hedeby zurück. Auf dem ganzen Weg hatte Marit nicht ein Wort gesprochen. Jungfer Spaak verstand das erst nachher. Sie hatte wohl die ganze Zeit überlegt, wie sie es anfangen sollte, um den Ring zu finden.
Jungfer Spaak ging mit Marit geradewegs auf den Haupteingang des Wohnhauses zu und führte sie ins Schlafzimmer. Da war alles noch unverändert. Adrian lag schön und bleich, aber ruhig wie ein Toter da, und die Baronin saß daneben und bewachte ihn, ohne sich zu bewegen. Erst als Marit Erikstochter an das Bett trat, schaute sie auf. Kaum aber hatte sie die Frau erkannt, die neben ihr stand und den Sohn betrachtete, als sie auch schon vor ihr auf den Boden sank und das Gesicht in ihren Rock drückte.
»Marit, Marit«, sagte sie. »Denk nicht an all das Böse, was die Löwenskölds dir angetan haben! Hilf ihm, Marit! Hilf ihm!«
Die Bäuerin wich ein wenig zurück; aber die arme Mutter schleppte sich ihr auf den Knien nach.
»Du weißt nicht, welche Angst ich immer ausgestanden habe, seit der General hier umgeht. Die ganze Zeit über hab’ ich gebebt und gewartet. Ich wußte, sein Groll würde sich jetzt gegen uns kehren.«
Marit erwiderte kein Wort. Sie schloß die Augen und schien ganz in sich selbst zu versinken.
Jungfer Spaak war überzeugt, daß es ihr wohl tat, die Baronin von ihren Leiden sprechen zu hören.
»Marit, ich habe zu dir gehen und mich vor dir auf die Knie werfen wollen, so wie ich es jetzt tue, um dich zu bitten, den Löwenskölds zu verzeihen. Aber ich wagte es nicht. Ich dachte, es sei dir unmöglich, zu verzeihen.«
»Die Frau Baronin soll mich auch nicht darum bitten«, sagte Marit, »denn es ist so, ich kann nicht verzeihen.«
»Jetzt bist du aber doch da?«
»Ich bin nur der Jungfer zuliebe gekommen, weil sie mich darum gebeten hat.«
Damit trat Marit auf die andere Seite des breiten Bettes. Sie legte ihre Hand auf die Brust des Kranken und murmelte ein paar Worte. Zugleich runzelte sie die Stirn, drückte die Augen vor und kniff den Mund zusammen. Jungfer Spaak dachte, sie stelle sich genauso an wie andere Quacksalberinnen.
»Er wird am Leben bleiben«, sagte Marit. »Die Frau Baronin darf aber nicht vergessen, daß ich ihm einzig und allein der Jungfer zuliebe helfe.«
»Ja, Marit, ich werde es nie vergessen«, erwiderte die Baronin.
Es kam Jungfer Spaak vor, als habe ihre Herrin noch etwas hinzufügen wollen, dann aber brach sie doch jäh ab.
»Und nun lasse die Frau Baronin mir freie Hand!«
»Du kannst tun, was du willst, der Baron ist fort. Ich habe ihn gebeten, dem Doktor entgegenzureiten, damit er rascher eintrifft.«
Jungfer Spaak hatte erwartet, Marit Erikstochter werde nun einige Versuche machen, den jungen Baron aus seiner Betäubung zu wecken. Zu ihrer großen Enttäuschung tat sie nichts dergleichen. Dagegen befahl Marit, man solle alle Kleider des jungen Barons herbeischaffen, sowohl diejenigen, die er jetzt trug, als auch solche, die er in früheren Jahren getragen hatte, soweit sie etwa noch vorhanden wären. Sie wollte alles sehen, was er je auf dem Leibe gehabt hatte, Strümpfe und Hemden, Handschuhe und Mützen.
An diesem Tag tat man auf Hedeby nichts anderes als nach diesen Sachen suchen. Obgleich Jungfer Spaak seufzte, weil sich Marit nur wie eine gewöhnliche Wahrsagerin mit den üblichen Zauberkünsten benahm, beeilte sie sich doch, aus alten Truhen auf den Dachböden, aus Laden und Schränken alles zusammenzusuchen, was dem Kranken gehört hatte. Die jungen Fräulein, die recht gut darüber Bescheid wußten, was Adrian je getragen hatte, halfen ihr beim Suchen, und so kamen sie bald mit einem ganzen Kleiderbündel zu Marit herunter.
Marit breitete die Sachen auf dem Küchentisch aus und untersuchte jedes einzelne Stück genau. Ein Paar alte Schuhe legte sie auf die Seite, ebenfalls ein Paar kleine Handschuhe und ein Hemd. Unterdessen murmelte sie eintönig und unablässig: »Ein Paar für die Füße, ein Paar für die Hände, eins für den Körper und eins für den Kopf.«
»Ich muß noch etwas für den Kopf haben«, sagte sie plötzlich mit ihrer gewohnten Stimme. »Ich brauche etwas, was warm und weich ist.«
Jungfer Spaak zeigte ihr die Hüte und Kappen, die sie herbeigeholt hatte.
»Nein, es muß etwas sein, was warm und weich ist«, sagte Marit. »Hatte Baron Adrian nicht auch eine Zipfelmütze, wie andere Jungen?«
Jungfer Spaak wollte eben sagen, sie habe keine gesehen, die Köchin nahm ihr das Wort vom Munde weg.
»Ich habe ja seine alte Zipfelmütze heute morgen auf dem Wandbrett dort gefunden, aber die Jungfer hat sie mir weggenommen.«
Also mußte Jungfer Spaak mit der Zipfelmütze herausrükken, die sie bis ans Ende ihrer Tage als ein teueres Andenken hatte behalten wollen.
Als Marit die Zipfelmütze bekommen hatte, fing sie wieder mit dem Gemurmel an; jetzt aber hatte ihre Stimme einen andern Ton. Es klang, wie wenn eine Katze vor Vergnügen schnurrt.
»Jetzt«, sagte Marit, nachdem sie die Mütze in ihrer Hand lange gedreht und gewendet und in sie hineingemurmelt hatte, »braucht es weiter nichts mehr, dies alles aber muß in das Grab des Generals gelegt werden.«
Als Jungfer Spaak dies hörte, war sie ganz verzweifelt. »Marit, wie kann Sie glauben, der Baron werde das Grab öffnen lassen, um solchen alten Plunder hineinzulegen?« sagte sie.
Marit sah sie an und lächelte ein wenig. Sie faßte Jungfer Spaak an der Hand und stellte sich mit ihr so an ein Fenster hin, daß sie allen anderen in der Küche den Rücken zuwendeten. Darauf hielt sie der Jungfer Adrians Mütze vor die Augen und zerteilte mit den Fingern die Fäden der großen Troddel.
Nicht ein Wort sagte sie, und nicht ein Wort sagte Jungfer Spaak; diese aber war todesblaß, als sie sich den anderen wieder zuwendete, und ihre Hände zitterten.
Marit machte nun aus den ausgewählten Sachen ein kleines Bündel und übergab es Jungfer Spaak.
»Jetzt hab’ ich das meinige getan«, sagte sie. »Nun müßt ihr anderen es einrichten, daß dies hier in das Grab kommt.« Damit ging sie ihrer Wege.
Am Abend kurz nach zehn Uhr wanderte Jungfer Spaak nach dem Kirchhof. Sie hatte Marits kleines Bündel bei sich, sonst aber war ihr Gang nicht anders als eine Wanderung aufs Geratewohl. Wie es ihr gelingen sollte, die Sachen in das Grab des Generals hineinzuschaffen, davon hatte sie keine Ahnung.
Gleich nachdem Marit sich entfernt hatte, war der Baron mit dem Doktor dahergeritten gekommen, und Jungfer Spaak hatte gehofft, der Doktor werde Adrian wieder ins Leben zurückrufen können, ohne daß sie etwas Weiteres in der Sache tun müßte. Der Doktor aber hatte sofort erklärt, hier könne er nicht helfen, der junge Mann werde nur noch wenige Stunden am Leben bleiben.
Da hatte Jungfer Spaak das Bündel unter den Arm genommen und sich auf den Weg gemacht. Sie wußte, es gab keine Möglichkeit, den Baron Löwensköld zu bewegen, die Grabplatte abheben und das zugemauerte Grab öffnen zu lassen, nur um ein paar von Baron Adrians alten Kleidungsstücken hineinlegen zu lassen. Wenn sie ihm gesagt hätte, was sich wirklich in dem Bündel befand, dann, das wußte sie gewiß, würde er den Ring sofort seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben; damit aber hätte sie ja einen Verrat an Marit Erikstochter begangen.
An einem zweifelte sie gar nicht. Marit war es gewesen, die einstmals den Ring nach Hedeby geschafft hatte. Baron Adrian selbst hatte ja erwähnt, Marit habe ihm einmal seine Zipfelmütze geflickt. Nein, Jungfer Spaak wagte es nicht, den Baron über den wahren Zusammenhang dieser Sache aufzuklären.
Später wunderte sich Jungfer Spaak selbst darüber, daß sie an jenem Abend keine Angst gehabt hatte. Sie stieg über die niedrige Kirchhofmauer und wanderte zu dem Löwensköldschen Grab hin, ohne an etwas anderes zu denken, als wie sie den Ring da hineinbringen könnte.
Sie setzte sich auf die Grabplatte und faltete die Hände zum Gebet. »Wenn Gott mir nicht hilft«, dachte sie, »dann wird das Grab allerdings bald geöffnet werden; aber nicht des Ringes wegen, sondern für einen, um den ich ewig trauern werde.«
Mitten unter ihrem Gebet nahm die Jungfer eine kleine Bewegung in dem Gras wahr, das den niederen Grabhügel bedeckte, auf dem die Grabplatte lag. Ein kleines Köpfchen lugte hervor, verschwand aber sofort wieder, als die Jungfer zusammenzuckte. Denn Jungfer Spaak hatte ebenso große Angst vor Mäusen, wie die Mäuse vor ihr. Dies aber rief in der Jungfer eine plötzliche Eingebung hervor. Rasch trat sie an einen großen Fliederbusch, brach einen langen dürren Zweig ab und steckte ihn in das Mauseloch hinein.
Zuerst steckte sie ihn senkrecht hinunter; da stieß sie aber gleich auf Widerstand. Dann versuchte sie, ihn schräg hinabzuführen, und da glitt er in der Richtung des Grabes weit hinunter. Sie verwunderte sich, wie tief er eindrang. Die ganze Gerte verschwand. Hastig zog sie sie wieder heraus und maß die Länge an ihrem Arm. Sie war drei Ellen lang. Die Gerte mußte drunten in der Grabkammer gewesen sein.
Jungfer Spaak war in ihrem ganzen Leben noch nie so ruhig und geistesgegenwärtig gewesen. Es war klar, die Mäuse hatten sich einen Weg ins Grab hinunter gebahnt. Vielleicht hatte sich auch ein Spalt in der Mauer befunden, oder irgendein Ziegelstein war verwittert.
Sie legte sich flach auf den Boden, riß ein Stück vom Rasen los, schaffte die lose Erde beiseite und streckte den Arm hinein. Ohne ein Hindernis drang er tief hinunter, gelangte aber doch nicht bis zu der Mauer, ihr Arm war zu kurz.
Da knüpfte sie eilig das Bündel auf und nahm die Mütze heraus. Sie wand sie um die lange Gerte und versuchte, diese langsam in das Loch hineinzuschieben. Bald war sie verschwunden; nun schob sie die Gerte ebenso langsam und vorsichtig weiter und weiter hinunter. Da plötzlich, als die Gerte fast ganz drunten in der Erde war, fühlte sie, wie sie ihr mit einem Ruck aus der Hand gerissen wurde.
Möglicherweise konnte sie durch ihre eigene Schwere hinuntergefallen sein; aber nein, Jungfer Spaak war ganz sicher, sie war ihr entrissen worden.
Und jetzt endlich bekam sie Angst. Sie raffte all das andere, das sich in dem Bündel befand, zusammen, steckte es in das Loch hinein, legte die Erde und den Rasen, so gut sie konnte, wieder zurecht und lief den ganzen Weg wie gejagt nach Hedeby zurück.
Als sie dort ankam, standen der Baron und die Baronin auf der Treppe und kamen ihr eifrig entgegen.
»Wo ist die Jungfer gewesen?« fragten sie gleich. »Wir stehen hier und warten auf Sie.«
»Ist Baron Adrian tot?« fragte die Jungfer.
»Nein, er ist nicht tot«, antwortete der Baron, »aber sage Sie uns zuerst, wo Sie gewesen ist.«
Jungfer Spaak konnte kaum sprechen, so atemlos war sie; sie berichtete aber doch von dem Auftrag, den Marit ihr gegeben hatte, und daß es ihr geglückt war, wenigstens ein Stück von den Sachen durch ein Mauseloch in das Grabgewölbe hinunterzuschaffen.
»Das ist außerordentlich merkwürdig, Jungfer Spaak«, sagte der Baron, »denn Adrian geht es wirklich besser. Vor einer Weile ist er aufgewacht, und sein erstes Wort war: ›Jetzt hat der General den Ring bekommen!‹«
»Sein Herz schlägt wieder wie gewöhnlich«, fuhr die Baronin fort, »und er will durchaus mit Jungfer Spaak reden. Er sagt, sie habe ihn gerettet.«
Sie ließen die Jungfer Spaak allein zu Adrian hinaufgehen. Er saß aufrecht im Bett und breitete die Arme aus, als er sie erblickte.
»Ich weiß es, ich weiß es schon!« rief er. »Der General hat seinen Ring bekommen, und das haben wir der Jungfer zu verdanken.«
Jungfer Spaak lachte und weinte, als sie in seinen Armen lag, und er küßte sie auf die Stirn.
»Jungfer Spaak, ich verdanke Ihr mein Leben«, sagte er. »Ich wäre in diesem Augenblick eine Leiche, wenn Sie nicht gewesen wäre. Man kann Ihr nie dankbar genug dafür sein.«
Das Entzücken, womit der junge Mann sie begrüßte, hatte die arme Jungfer Spaak vielleicht dazu gebracht, allzulange in seinen Armen zu liegen.
Und er beeilte sich, hinzuzufügen: »Und nicht ich allein danke der Jungfer, auch noch jemand anders tut es.« Er zeigte ihr ein Medaillon, das er an einer Kette um den Hals trug. Jungfer Spaak unterschied undeutlich das Miniaturporträt eines jungen Mädchens. »Jungfer Spaak ist nächst meinen Eltern die erste, die es erfährt. Wenn sie in einigen Wochen nach Hedeby kommt, dann wird sie der Jungfer noch besser danken, als ich es jetzt kann.«
Und Jungfer Spaak verneigte sich vor dem jungen Baron zum Dank für sein Vertrauen. Sie hätte ihm eigentlich sagen wollen, sie habe nicht die Absicht, auf Hedeby zu bleiben, um seine Braut zu begrüßen, besann sich aber noch zu rechter Zeit. Ein junges Mädchen muß sich hüten, eine gute Stelle zu verscherzen.