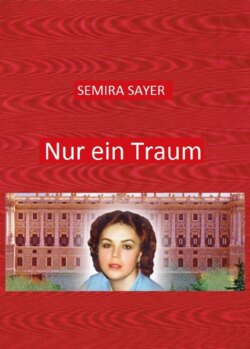Читать книгу Nur ein Traum - Semira Sayer - Страница 4
Kapitel 2
ОглавлениеDer gut aussehende, junge Mann entpuppte sich mit der Zeit als guter, treuer Hausmann und sorgender Vater, zwar noch ohne Kinder, aber davon sprach er immer häufiger.
Wir oder besser gesagt Thomas machte viele Zukunftspläne. Einer von vielen war, dass wir in eine große gemeinsame Wohnung einziehen sollten, anstatt für zwei kleine Wohnungen Miete zu zahlen. Man sah ihm das Glück richtig an. "Ich habe die Frau meines Herzens gefunden", meinte er und stellte mich schon nach vierzehn Tagen seinen Eltern vor.
Seine Mutter war eine zurückhaltende, ruhige Person. So ruhig, dass ich nicht wusste, ob ich willkommen war oder nicht, jedenfalls wurden wir später gute Bekannte.
Sein Vater war ein Mann mit eher südlichem Einschlag. Mit einer Bordeauxflasche vor sich und seiner Zigarre in der Hand ließ sich leicht erahnen, dass er das Leben genoss, und man musste nicht darüber rätseln, dass er vom Süden träumte.
Zwei grundverschiedene Menschen liebten sich hier also, hatten sich in ihrem Leben vereint und gestalteten es zusammen. Ob sie an unserer Freundschaft Freude hatten, wusste ich nicht, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl und ich nahm an, dass sie mich akzeptierten.
Ich hingegen brauchte einen ganzen Monat, um meiner Mutter von Thomas zu erzählen. Als ich vor ihrer Wohnungstür stand, war ich noch nicht sicher, ob ich ihr das alles berichten sollte. Ich läutete und war gespannt auf ihre Reaktion.
„Ich komme“, hörte ich kurz darauf schon ihre Stimme hinter der Tür, sie ließ mich nicht lange warten. Als sich die Tür öffnete, sagte ich schon beim ersten Blick: „Hallo, Mam!“ Ihr strahlendes Lächeln verriet mir ihre Freude.
„Komm herein, Kleines“, lud sie mich ein. Zögern trat ich herein. „Das ist eine schöne Überraschung, dass du kommst“, redete sie weiter.
Das war diese Woche schon das zweite Mal gewesen, dass ich sie nach der Arbeit aufsuchte. Schon am Montag hatte ich versucht, mich richtig mir ihr auszusprechen, aber ich hatte es nicht geschafft.
Sogar letzten Sonntag war ich bei ihr deswegen vorbeigekommen! Meinen Sonntagsspaziergang mit Thomas hatte ich ausgelassen, um mit meiner Mutter in aller Ruhe bei Kaffee und Kuchen unsere Beziehung zu bereden, was aber ohne Erfolg geblieben war. Heute war Donnerstag, der zweite August. Haargenau ein Monat nach unserer Verabredung in Café Romantico. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und hoffte, endlich mit ihr über meinen Freund reden zu können.
Obwohl sie schlechte Erfahrungen mit meinem Vater gemacht hatte, wobei ich mir alles hatte mit ansehen müssen, wie sie darunter litt, brachte sie nie ein böses Wort über Männer über die Lippen.
„Was hast du denn, Kleines?“, fragte sie ein wenig besorgt über mein ruhiges, scheues Verhalten. Ach! Ja!, sie nannte mich immer noch Kleines, obwohl ich dreiundzwanzig Jahre alt war. Ich hatte sie nie danach gefragt, warum sie mich so nannte. Aber ich nahm an, es kam daher: Als ich noch klein war, und selbst später noch, sagte sie, ich sei ihre einzige Freude im Leben und ich blieb immer die kleine Tochter in ihren Augen.
„Ist dir nicht gut?“, fragte sie mich mit dem gleichen besorgten Tonfall wie vorhin.
„Doch, Mam, mir geht's gut, nur ...“
„Komm, wir machen es uns erst einmal im Wohnzimmer gemütlich und reden darüber, was dich beschäftigt!“ Sie nahm meinen Arm und führte mich hinein.
Wir gingen zusammen in den Salon. In jeder Ecke, sogar bei der blau-grau-weißen Polstergruppe, erwachten wie immer die Erinnerungen, auch heute. Ich dachte an die Zeit, als wir, meine Mutter und ich, noch alleine lebten. Sie hatte immer noch die gleichen Möbel und Vorhänge wie damals.
Sie setzte sich aufs Sofa und zeigte auf den Platz neben sich. „Komm, setze dich neben mich!“ Ich folgte stumm. Meine Mutter wusste, dass mich irgendetwas beunruhigte, aber sie wusste nicht, was es war. Sie nahm in mütterlicher Liebe meine Hand in ihre. „Nun?“, damit erhoffte sie auf eine Aufklärung. Ich hob meinen Kopf auf und sah mir ihr Gesicht an. Darin entdeckte ich, wie schon früher in meiner Kindheit, ihren vertrauten, liebevollen Ausdruck, der mir ausreichend Sicherheit gab, um mit ihr zu reden.
„Warum bist du so ruhig?“, drängte sie weiter besorgt.
„Ich habe einen Freund, Mam!“ Endlich kam es heraus.
„Einen Freund?“, fragte sie wiederholt und sah sie mich erstaunt an.
„Ja er heißt Thomas. Ich habe ihn in Spanien während unserer Ferien kennen gelernt.“ Jetzt sah ich mir ihr Gesicht noch genauer an. „Und wir verstehen uns sehr gut“, versicherte ich ihr und fuhr fort, sie brauche sich keine Sorgen um mich zu machen.
Zuerst erschien ein Hauch von Lächeln, dann folgte der Übergang zu einem richtigen Lächeln auf ihren Lippen.
„Also das war deine große Sorge!“
„Es ist nur so ...“ Ich suchte nach Worten, die nicht unbedingt leicht zu finden waren.
„Ich finde das schön für dich!“
„Wirklich, Mam?“
„Ja!“ Sie bestätigte es mit einem leichten Kopfnicken und setzte ihren Satz fort. „Es ist dein Recht, jemanden kennen zu lernen und glücklich zu werden!“
Meine Mutter legte ihre rechte Hand auf mein Haar, steckte es hinter meinem Ohr fest, dann streichelte sie meine linke Wange zärtlich. „Bist du auch glücklich mit ihm?“, fragte sie mich mit besorgter, weicher Stimme.
„Ja, Mam, ich bin glücklich mit Thomas. Er ist ein guter Mensch. Es war nicht einfach, mich von seiner Freundschaft zu überzeugen. Aber je besser ich ihn kennen lernte, umso mehr Vertrauen habe ich zu ihm ...Nur fühle ich im Inneren noch einen leeren Raum von Gewünschtem, das sich bis heute noch nicht erfüllt hat!“
Sie betrachtete lange mein Gesicht, versunken in ihre Gedanken, ohne mir etwas zu sagen. Dann fand sie mit abfallender Stimme: „Das kann ich mir denken. Die fehlenden väterliche Gefühle“, sagte sie überzeugt, gezeichnet von Spuren des Leidens. „Er war kein schlechter Mensch, aber er hat versagt“, betonte sie ausdrücklich, was sie von ihrem früheren Ehemann hielt.
„Ich nahm es dem Leben sehr übel, dass ich ohne meinen Vater aufwuchs, ich war sehr einsam, als er uns verließ. Ich träumte von einem Prinzen, der mich holt und von hier fortbrächte in ein fernes Land, und ich würde seine Prinzessin, so wie in deinem Märchen. Mit diesem Glück wollte ich vergessen, wie unglücklich ich war!“
„Es waren kindliche Träume von dir. Heute bist du eine erwachsene Frau. Dein eigenes Glück kannst du selbst steuern, ohne zu träumen.“ Sie sah mich immer noch mit ihrem warmen Lächeln an.
„Du hast Recht, Mam, danke!“ Ich war sehr aufgeschlossen ihr gegenüber. Als wir uns in tiefer Stille beobachteten, wusste jeder von uns, dass wir uns in unserer Mutter-Tochter-Beziehung sehr nahe standen, aber jeder lebte dennoch in seiner eigenen Welt. Sie gab ihr Bestes, um mir eine gute Mutter zu sein, und ich auch, so dachte ich jedenfalls.
Einmal hatte ich ihr gestanden: „Mam, ich wünschte, wir wären reich!“ Sie antwortete: „Du denkst wie dein Vater, Kleines! Er träumte auch immer vom vielen Geld, aber er besaß wenig davon und konnte mit dem Wenigen gar nicht umgehen!“ Sie schüttelte ihren Kopf verneinend und meinte: „Nein, Kleines, du musst das Leben akzeptieren und nehmen, wie es ist, und versuchen, darin deinen Platz zu suchen und zu finden“, wies sie mich auf das reale Leben hin. Sie war diejenige, die die Stille brach. „Lass mich das Abendessen vorbereiten, dann essen wir gemeinsam!“ Sie sprang auf und rannte schon Richtung Küche.
„Mam!“ Gleich nach ihr stand ich auch auf, um sie aufhalten zu können. Auf mein Rufen drehte sie sich zu mir um.
„Ja, Schatz? Es dauert nicht lange. Ich kann es allein vorbereiten!“ Sie dachte, ich wolle ihr helfen. Ich nahm sie an beiden Armen und hielt sie fest.
„Mam, Thomas wartet auf mich! Ein anderes Mal komme ich auf deine Einladung zurück!“ Ihre Augen sanken nach unten, aber nicht für lange.
War es eine Niederlage für ihre Gefühle? Sie zeigte es dennoch nicht. Wie tapfer!
Sie sagte: „Schon gut, Schatz, ein anderes Mal!“ Ich küsste diese großartige Frau zum Abschied auf beide Wangen.
Es tat so gut und ich war sehr zufrieden, dass ich mich mit meiner Mutter ausgesprochen hatte.
Es war ein Zufall, dass wir unsere gemeinsame Wohnung fanden, wenngleich ich schon daran dachte, dass das vielleicht noch zu früh sei. Aber Thomas drängte immer mehr. Und die Wohnung entsprach überhaupt nicht meinen Vorstellungen von einer Landwohnung in einem Ort mit wenigen Einwohnern oder gar einem Dorfhaus, damit wir dem stressigen, lärmenden Stadtleben entfliehen konnten.
Auch unsere Kinder hätten dort ein ruhiges Leben.
Gegen Ende August unternahmen wir nach dem Mittagessen einen Verdauungsspaziergang. Wir hatten wie immer bei mir gegessen, in meiner Einzimmerwohnung. Am Ende des Ganges war eine Küche eingerichtet. Vor dem Fenster stand ein kleiner Esstisch, für zwei Personen reichte das völlig aus.
„Deine Kochkünste werden immer besser“, lobte Thomas mich an diesem Tag zufrieden. Er lehnte sich im Stuhl zurück. „Susan, Liebes, du musst zugeben - das ewige Hin- und Herrennen zu mir oder zu dir sollte aufhören. Es ist Zeit, dass wir in eine Wohnung einziehen und dort gemeinsam miteinander leben!“
„Ich denke, wir sollten noch ein wenig warten.“
„Worauf sollten wir noch warten?“
„Wir kennen uns doch erst zwei Monate. Wir brauchen Zeit!“
„Zeit wofür?“
„Um uns gegenseitig besser kennen zu lernen!“ Meine Eltern! Ich brachte nicht über die Lippen, woran ich dachte.
„Ach! Liebes! Meine Eltern sind noch immer glücklich zusammen. Jetzt mache dir keine Gedanken! Wenn es mit uns nicht klappen würde, hätten wir das inzwischen doch schon längst gemerkt!“
„Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Zeit viel zu kurz dafür ist!“ Er stand mit zufriedenem Gesicht auf, weil er das Essen sehr genossen hatte, stapelte meinen leeren Teller über seinen, legte das Besteckt darauf und stellte das Ganze in das Waschbecken hinein, während ich noch am Tisch sitzen geblieben war.
Tat er das alles, um mir beweisen zu können, dass er mir beim Haushalt helfen würde, indem er seinen guten Willen zum Helfen demonstrierte?
„Du hast mir noch nicht geantwortet“, rief ich ihm von meinem Sitzplatz aus zu.
„Susan, Liebes, wir sind zwei vernünftige, erwachsene Menschen und machen seit sechzig Tagen auch nichts anderes. Wir treffen und sehen uns jeden Tag und verbringen täglich viel Zeit miteinander!“
Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, als kämen damit noch andere Verpflichtungen auf mich zu außer Kochen und Putzen. Einfacher ausgedrückt: Ich hätte entschieden weniger Freiheit, was sich später bestätigen sollte.
„Komm schon“, bat er mich und reichte mir seine Hand. „Draußen ist sehr schönes Wetter, lass das Geschirr einfach stehen! Wir machen einen Verdauungsspaziergang und lassen unsere Köpfe durchlüften, vielleicht habe ich dann Erfolg und kann dich umstimmen, und du kommst darauf, was ich meine!“
Obwohl es Spätsommer war, trafen wir einen herrlich heißen Tag unten an.
Unermüdlich liefen wir die lange Hauptstraße entlang, dann überquerten eine zu einem Spazierweg führende kleine Straße und erreichten einen von beiden Seiten mit eng nebeneinander stehenden Bäumen gesäumten Pfad.
Ich verbrachte eine Zeit lang damit, die riesigen Bäume um uns herum zu betrachten mit ihren langen Ästen, und bemerkte den langsam sich einschleichenden herbstlichen Farbeinschlag, die dichten Blätter wurden bunt und tanzten in einem leichten Wind hin und her. Einige Bäume waren vermutlich schon sehr alt und krümmten sich deswegen, trotz ihrer gewaltigen Stämme. Ja! Wir konnten unter dem kristallklaren Himmel, begleitet von den, auf den Blättern reflektierenden goldenen Sonnenstrahlen, unsere Köpfe durchlüften.
„Wie findest du das? Ist es nicht herrlich heute?“, sagte Thomas zu meiner Richtung gewandt im Gehen.
„Ja. Das stimmt, es ist wirklich schön heute. Vielleicht ist das sogar der letzte schöne Tag des Jahres! Das hat das Fernsehen gestern berichtet, bevor dann demnächst der Regen kommt!“ „Komm, gib den Ball weiter, siehst du denn nicht, dass du nicht vorwärts kommst! Mensch, ist der Mann blöd!“ Thomas schüttelte aufgeregt den Kopf hin und her.
Mir wurde erst dadurch bewusst, dass wir an einem Fußballfeld vorbeiliefen. Das laute Rufen der Leute bemerkte ich erst jetzt.
Thomas, der ein großer Fan von Fußballspielen war, spielte ab und zu selbst gerne. Wenn er fernsah, schaute er nichts anderes als Fußballspiele. Anstatt mir zuzuhören, blieb er vor dem Feld stehen, sah sich das Spiel an und war in Gedanken mittendrin. Ich sah ihm schmunzelnd zu, wie er sich ereiferte, und ging langsam weiter.
„Entschuldige, Schatz, ich komme! Hast du gesehen, wie er den Ball verpasste?“, ärgerte er sich, als er wieder bei mir war.
„Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich verstehe wenig vom Fußballspielen, noch weniger, weshalb zweiundzwanzig Beine die ganze Zeit hinter einem einzigen Ball herrennen!“
„Das ist eine beliebte Sportart!“
„Unter Männern natürlich!“
„Jawohl!“
Ich antwortete nicht mehr, sondern ließ ihn mit seinen männlichen Idealen allein.
Tief atmend setzte ich den Weg neben ihm fort und dachte daran, dass ich nun vielleicht die letzte Gelegenheit hatte, warme Luft einatmen zu können, ehe die grauen, nassen und kalten Tage kämen. Einige Minuten lang liefen wir Seite an Seite, ohne etwas zu sagen. Wahrscheinlich war jeder von uns mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. So war kein Laut von uns zu hören, nur unsere Schritte tappten gleichmäßig und die Stimmen der an uns vorbeilaufenden Menschen nahm ich flüchtig wahr.
Da! Da war doch noch etwas. In Begleitung der vorbeigehenden Menschen zogen auch einige Hunde fröhlich schwanzwedelnd an uns vorüber und bereiteten mir eine große Freude. Wie zufrieden und friedlich sie waren! Besonders ein schwarzer Hund hatte es mir angetan. Nur eine weiße Linie führte von seinem Kinn über den Bauch hinunter. Ohne seine Leine näherte er sich mir vertrauensvoll und erschnüffelte meinen Geruch, der ihm nicht bekannt vorkam.
Aber als er verstand, dass ich keine bösen Absichten ihm gegenüber hatte, näherte er sich mir. Er kam mir so nahe, dass ich ihn berühren konnte, und er erlaubte mir, seinen Kopf, sein Kinn und das flauschige Fell auf seinem Rücken zu streicheln.
Lange beobachtete er mich mit seinen goldbraunen, treuen Augen, bis sein Herrchen seinen Namen rief. Ich folgte seinen Sprüngen mit meinen Blicken. Die warmen, weichen Gefühle für dieses kleinen Wesen fühlte ich noch lange mit einem Lächeln nach, während ich schon wieder an das Regenwetter dachte.
Plötzlich blieb Thomas stehen. Seine Augen hefteten sich auf etwas. Er wurde auf ein Mehrfamilienhaus aufmerksam und sagte: „Siehst du, was ich sehe?“
Ich folgte seinem Blick nach und sah nur ein Haus vor mir, einen aus sechs Stockwerken aufgehäuften Betonhaufen. „Da ist im vierten Stock eine Wohnung frei!“, rief er mir aufgeregt zu. Das durfte doch nicht wahr sein, so ein Zufall. Thomas sprach den ganzen Tag nur noch davon. Jetzt fand er endlich die Gelegenheit, seine Wünsche zu verwirklichen. Sofort machte er den Immobilienhändler bei der Nachbarschaft ausfindig.
„Gleich morgen werde ich in seinem Büro anrufen und nachfragen!“ Thomas machte sein Wort wahr. Schon am nächsten Tag Punkt fünf Uhr am Nachmittag holte er mich von der Arbeit ab, und weniger später standen wir schon mitten in der Wohnung.
Neben einem riesigen Wohnzimmer, mit einer offenen Küche fanden wir dort einen langen Flur vor, von dem die restlichen Zimmer abgingen.
„Das ist so, wie ich es mir vorstelle! Es hat vier Zimmer!“ Seit kurzer Zeit beschäftigte sich Thomas erst mit der Idee einer Vierzimmerwohnung.
„Unsere Kinder“, sagte er mit sicherem Tonfall, „ja, unsere Kinder sollten ihre eigenen Zimmer haben.“ Ich konnte ihn nicht davon abhalten und erklären, dass wir noch keine Kinder hatten, ja, wir waren noch nicht einmal verheiratet!
Aber dafür war die Wohnung frisch gestrichen und bezugsbereit.
„Sehr gut, dass unser Schlafzimmer ganz hinten liegt“, rief er vom hinterem Teil der Wohnung nach vorn zu mir.
Er dachte noch vieles vor sich hin. Und ich malte mir die Bilder unseres zukünftigen Familienlebens vor meinen inneren Auge aus und sah Thomas, wie er zum Umfallen müde zur Wohnungstür hereinkam. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Unser Ältester öffnet Papi die Türe und rief mir lauthals zu: „Mami! Papi ist da!“ Die mittlere Tochter zupfte an meinem Rocksaum. Ich trug den Junior auf meinen Armen und stand vor dem Kochherd.
Ja, ein vollkommenes Familienalbum hatte ich vor Augen. Ich hörte fast das Schreien, Weinen und Quengeln unserer Kinder. War es das, wofür man lebte? Der Höhepunkt, den ich mir so sehr ersehnt hatte?
„Und was denkst du?“, hörte ich plötzlich Thomas fragen, seine Stimme kam von nicht weit entfernt. Von Benommenheit umhüllt konnte ich mich nicht sofort zusammenreißen.
„Was? Ach ja, was ich denke“, stammelte ich. Thomas stand in der langen Eingangsflur, betrachtete mich im Wohnzimmer und wartete auf meine Meinung.
„Ja! Du bist so ruhig, du sagst gar nichts!“
„Also, ich finde die Wohnung nicht schlecht, aber ...“
Er nickte bestätigend mit seinem Kopf, darauf hatte er nur gewartet, auf das „Nicht schlecht“. Der Rest war unbedeutend für ihn.
„Ja, nicht schlecht, sie ist groß, geräumig und schön. Einfach schön“, mit diesem Satz kam er langsam auf mich zu.
Unwillkürlich drehte ich mich in diesem Moment entsetzt um, als ich donnernden Lärm vernahm. Wie ein Riesenblechvogel zeichnete ein tief fliegendes Flugzeug seinen riesigen, schwarzen Schatten auf den großen Balkon. Mit ohrenbetäubendem Lärm flog es knapp über uns hinweg, sodass ich das Gefühl hatte, es würde gleich auf dem Dach oder auf dem großen Balkon landen, wenigstens ein Teil davon. Ich spürte Thomas an meiner linken Seite, während ich mit aufgerissenen Augen das Geschehen erschrocken verfolgte.
„Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen, daran gewöhnst du dich mit der Zeit!“, urteilte Thomas und wandte seinen Blick vom Fenster ab.
Ein großer, schwarzer Rabe ließ sein Geschrei von sich am Himmel hören.
Wie konnte nur ein einziger Rabe so ein lautes Geschrei oder Gejammer als Reaktion auf das Schwarzwerden des Himmels von sich geben! War das ein gutes oder schlechtes Omen?
Ich wandte meine Blicke wieder hoch zum Himmel und dachte traurig, wie beeinflussbar die menschliche Psyche was, da ich das Gefühl hatte, abergläubisch zu werden.
Das Pech klebte offenbar wie Schwefel an mir. Ich erinnerte mich gut daran, wie eine Nachbarin, die vier Häuser von mir entfernt wohnte, neulich gesagt hatte: „Raben sind Rudeltiere. In unserem Garten leben Hunderte von Raben auf den Bäumen. Am besten sieht man diese schwarzen Tiere im Herbst, wenn keine Blätter mehr auf den Bäumen sind!“
Warum war dieser Rabe da oben dann allein unterwegs und schwebte direkt über meinen Kopf?
Thomas hatte sich schon längst mit dieser Wohnung angefreundet. „Sie ist auch von überall schnell erreichbar und liegt nicht weit von unseren Arbeitsorten entfernt“, redete er nur Gutes über die Wohnung, doch ich zögerte. Ich konnte mich beim besten Willen nicht an den Gedanken daran gewöhnen. War ich zu wählerisch oder passte sie meinen Träumen nicht? Irgendwie war ich nicht so überzeugt, wagte es aber nicht, gegen Thomas anzutreten.
Wie auch immer, wir bekamen die Wohnung, und schon wurde der Einzugstermin festgelegt. Am Dienstag, den vierzehnten September, an einem zwar nicht mehr warmen, aber dafür strahlenden Herbsttag zogen wir ein.
Am Anfang, die ersten drei Monate, verbrachte ich meine Zeit damit, zu beobachten, wie viele Flugzeuge am Tag landeten und starteten. Mit der Zeit gewöhnte ich mich daran und irgendwann war es mir eigentlich auch gleichgültig geworden. Nur der plötzliche Lärm erschreckte mich immer noch sehr.
Ach! Ja! Die drei Glockenwanduhren der Nachbarin unter uns schlugen nie richtig. Um drei Uhr früh am Morgen hörte ich täglich sechsunddreißig Schläge anstelle von neun. Natürlich alles je drei Mal. Da hatte ich doch Mühe, das zu ertragen.
Manchmal dachte ich nachdenklich, es wäre besser gewesen, wenn ich in Spanien nicht unter den Pinienbäumen gelegen hätte.
Aber es war wenigstens eine helle Wohnung. Besonders ins Schlafzimmer schien ab zehn Uhr morgens die Sonne herein. Dann war unsere Wohnung ziemlich hell, und zudem lag sie in einer parkähnlichen, grünen Umgebung.
Meine Mutter rief jeden Tag bei mir an und fragte nach, ob sie mir helfen solle beim Einpacken. Ich erklärte: „Thomas und ich haben beschlossen, alle Möbel neu zu kaufen. Daher nehmen wir nur Kleider, Bücher und einfach die wichtigsten Sachen aus unseren Wohnungen mit. Damit bleibt uns viel Arbeit erspart.“
Wie ich mich täuschte! Obwohl ich eine Woche Urlaub von meinem Arbeitgeber erbat, sagte unser Abteilungsleiter ablehnend: „Schon wieder Urlaub? Sie haben doch schon im Juni Ihren Urlaub gehabt!“
„Ich ziehe um“, erklärte ich ihm. „Zwei Tage habe ich sowieso noch gut, und die drei Tage werde ich wohl freikriegen können“, verteidigte ich mein Recht. Ich sah vieles schon im Voraus auf mich zukommen. Es war nicht leicht, aber ich bekam meine freie Woche.
Och Gott! Der Umzug war gar nicht einfach. Auf die Möbelwagen warten, mit neuen Möbeln, Wohnung einrichten, putzen. Der ganze Haushalt wartete auf eine Handbewegung von mir. Ja, von mir, denn Thomas nahm nach zwei freien Tagen seine Arbeit wieder auf. Ganz alleine schuftete ich von morgens bis abends und konnte meine Mutter nicht um Hilfe bitten. Ich musste alles selbst tun, worauf ich stolz sein konnte.
Am Freitagabend, nach einer vorbeigezogenen harten Woche, am Ende meiner Kräfte angelangt, saß ich noch auf der Eckbank. Meine Beine mochten kaum noch laufen. Thomas saß wie gewöhnlich vor dem Fernseher. Gedankenverloren, nein, ohne jede Energie und Lust nahm ich in Begleitung von einer der drei Wanduhren wahr, dass das Telefon klingelte.
Ich sprang auf und nahm den Hörer ab. Die Stimme meiner Mutter klang nach ihrem gewohnten Ton, in dem ich keine Müdigkeit entdecken konnte. Woher nahm sie diese Energie? Sie war schon seit Jahren auch eine berufstätige Hausfrau! Hatten meine geheimen Träume Einfluss auch auf mein alltägliches Leben?
„Susan, bist du noch dran?“, erkundigte sie sich, nachdem ich mich einige Sekunden still verhalten hatte.
„Ja, Mam! Entschuldige bitte, ich bin nicht bei der Sache!“
„Du klingst sehr müde. Ich wollte dir so gern helfen, aber du hast mich nicht gelassen. Du hast dich wahrscheinlich überanstrengt und willst immer noch nicht, dass ich dir helfe!“
„Danke, Mam, ich bin so gut wie fertig!“ Ich suchte noch für einen Moment in meinem Kopf, was ich ihr Wichtiges sagen wollte, und fuhr fort: „Mam, willst du nicht vorbeikommen, dir unsere neue Wohnung ansehen und Thomas endlich kennen lernen?“
„Das mache ich gern!“, sagte sie freudig zu.
„Aber gib mir noch einige Tage, ich bin vielleicht nicht so gut wie du, ich möchte noch fertig einrichten!“
„Ich bin jetzt schon stolz auf dich, Kleines! Bist du einverstanden mit heute in einer Woche?“
„Ja, gut, Mam, bis bald!“ „Meine Mutter will uns nächste Woche besuchen“, teilte ich Thomas kurz mit.
„Das wurde aber auch höchste Zeit“, sagte Thomas, ohne seine Aufmerksamkeit vom Fernseher abzulenken.
Mir kamen diese acht Tage wie acht Jahre vor, ich war durch und durch gespannt auf ihre Meinung über Thomas und die Wohnung und was sie dazu sagte, dass ihre Tochter etwas Eigenes besaß, fast eine Familie.
Mit Blumen und einem Geschenk in der Hand kam sie wie abgemacht am Freitagabend, so, wie ich sie all die Jahre kannte, und obwohl sie mich freudig umarmte, bereitete sie sich psychisch auf meinen männlichen Partner vor, zumindest deutete ihre Körpersprache darauf hin, oder bildete ich mir das nur ein? Nachdem wir uns begrüßt hatten, suchte sie mit einem skeptischen Blick nach Thomas.
Der heutige Abend, so hatte ich es mir vorgenommen, sollte weit weg von alltäglichen und Familienproblemen sein. Ein freudiges Beisammensein sollte es werden, ein kleines Fest unter uns dreien.
Nachdem ich sie in den Salon einlud, folgte sie mir nach. Kaum waren wir darin angekommen, stand Thomas sofort auf und begrüßte meine Mutter höflich. Beim Handgeben prüfte sie ihn gleichzeitig bewusst. Bei Thomas war die Freude unübersehbar.
„Ich freue mich für Euch! Ihr habt eine schöne Wohnung!“ Meine Mutter sah zuerst mich an, dann Thomas, und nun schweiften ihre Blicke in dem großen Salon umher hin zur offenen Küche. Offenheit lag in ihrer Bestätigung, und wie ich sie kannte, hatte sie damit zu meinen Gunsten geurteilt.
Ich dachte an die schweren Zeiten, die wir beide gehabt hatten, aber auch an die entspannte, ruhige, gelassene und warme Atmosphäre meiner Beziehung zu Thomas, an die sie nicht gewöhnt war. Das alles beeindruckte sie sehr. Dann wandte sie sich zu mir: „Ich hoffe, die Wohnung gefällt euch auch!“
„Ehrlich gesagt – mir gefällt diese Wohnung nicht, Mam!“, eilte ich mit Antwort.
„Ich verstehe dich nicht, was hast du dagegen?“; fragte sie überrascht.
„Ich bin nicht gegen die Wohnung, sondern gegen Fluglärm und gegen das unendliche Schlagen der Wanduhren! Ich komme nie zur Ruhe!“
„Das kann nicht so schlimm sein“, fand meine Mutter.
„Man kann sich dran gewöhnen“, unterbrach sie Thomas. „Ich habe mich schon daran gewöhnt“, fügte er hinzu.
Meine Mutter bereitete sich vor, um sich mit ihm weiter zu unterhalten, und drehte ihr Gesicht in seine Richtung. „Du könntest Recht haben, Thomas, man gewöhnt sich an vieles!“
Am liebsten wollte ich protestieren. Das war nicht fair, wir Menschen sind nicht alle gleich. Einer kann etwas ertragen, ein anderer nicht.
Aber obwohl ich wusste, dass ich mit meiner Meinung allein dastand, gefiel mir die Unterhaltung. Thomas wechselte schon das Thema und hatte einiges zu erzählen über die nagelneuen Möbel, Vorhänge und so weiter. Er war nicht menschenscheu und konnte sich schnell mit jedem anfreunden.
In Wirklichkeit war meine Mutter hingegen eher eine ruhige Natur. Sie bewies heute aber wieder einmal, dass sie sich offensichtlich den gegebenen Umständen problemlos anpassen konnte. Sogar mit unterdrückten, verwundenen Gefühlen der Vergangenheit.
Ihnen zuhörend, packte ich zuerst die Rosen aus, stellte sie ins Wasser und auf den Glastisch mitten im Zimmer. Als ich das Geschenkpäckchen in die Hand nahm, lenkte Thomas einen Moment die Aufmerksamkeit darauf. Ich packte es unter seinen staunenden Augen aus. „Schön, wirklich sehr schön!“, sagte er erfreut. „Vielen Dank!“ Er erhob sich und gab meiner Mutter begeistert einen Kuss auf die Wange.
„Danke, Mam, sie ist wirklich herrlich, diese handbemalte, große Vase!“ Ja, ich drückte meinen Dank aus mit einem Kuss auf beide Wangen.
„Ich freue mich, dass sie euch gefällt!“
Die Vase passte ausgezeichnet neben den Sessel nahe an der Balkontür. Ein paar Trockenblumen würden sie gut schmücken, dachte ich bei mir. Das Papier faltend, schickte ich mich an, in die Küche zu gehen, und sah die beiden, wie sie sich in ihre Unterhaltung vertieft hatten.
„Soll ich dir helfen?“, hörte ich meine Mutter fragen, worauf die Unterhaltung der beiden verstummte.
„Danke, Mam, Fleisch, Gemüse und Salat habe ich schon vorbereitet, ich muss nur noch die Teigwaren kochen“, rief ich ihr zu und warf einen lächelnden Blick über meine Schulter zurück. Ich füllte den Kochtopf mit Wasser und wandte mich wieder den beiden zu. Ohne es zu wollen, machte ich mir Gedanken über den psychischen Zustand meiner Mutter, die mit einem Lächeln bestätigend ihren Kopf schüttelte, während ihr Thomas etwas erzählte.
Dann öffnete ich den Küchenschrank, mechanisch machte ich ihn auf und zu, ohne irgendetwas herauszunehmen. Ablenken musste ich mich, nichts anderes, als mich von tragischen Geschehnissen ablenken, wollte ich.
Das Wasser sprudelte im Topf. Plötzlich tauchten Bilder der bitteren Auseinandersetzungen zwischen meinem Vater und meiner Mutter auf. Es hatte neben den Geldproblemen auch noch viele andere Sorgen daheim gegeben. Damals war ich noch nicht in der ersten Schulklasse, ja, noch im Kindergartenalter war ich damals gewesen. An diesem Abend sollte sich das Schlimmste in unserer Wohnung ereignen.
Weil der Verdienst meines Vaters nicht zum Leben reichte, hatte sich meine Mutter bei einer Abendteilzeitstelle beworben und kurz danach die Stelle bekommen.
An jenem Abend, als mein Vater heimkam, entfernte sie sich vom Kochherd, zog ihre Schürze aus, hängte sie an einen Haken an der Wand in der Küche, nahm in Eile ihre Jacke in die Hand und machte sie sich auf den Weg, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gehen.
„Das Essen ist auf dem Herd bereit, ich muss los“, sagte sie. Darauf reagierte mein Vater gar nicht. So verabschiedete sie sich an diesem Abend, dann kam sie zu mir.
„Auf Wiedersehen, Kleines, du gehst in einer Stunde nach dem Essen ins Bett, sonst bist du zu müde am nächsten Morgen. Hast du verstanden?“
„Ja“. Ich nickte weiter stumm.
Sie gab mir Küsschen auf beide Wangen.
„In einer Stunde gehst du wirklich ins Bett, hörst du!“, wiederholte sie, um mich besorgt.
„Ist gut, Mam“, bestätigte ich ihre Worte und begleitete sie bis zur Tür. Ich sah ihr traurig nach. Ja, ich hatte Angst, diese ruhige kalte Atmosphäre zwischen den beiden bereitete mir Angst, große Angst wie vor einem gewaltigen Sturm.
Nach dem Essen schaltete mein Vater das Fernsehen ein. Ich saß neben ihm und suchte seine Nähe, es gab keine große Konversation zwischen mir und ihm.
Traurigkeit umhüllte mich wegen der wortkargen, kalten Lage unserer Familie. Ich machte mir Gedanken darüber, wann einer von beiden versuchen würde, sich mit dem anderen zu versöhnen und mit ihm zu reden, doch dann immer gab es schon den nächsten Streit. Das war schon so, solange ich mich erinnern konnte.
Die müde, abgespannte Erscheinung meines Vaters beobachtete ich eine Zeit lang neben mir. Als er seinen Kopf zu mir drehte, fragte er mich, wie immer, wenn meine Mutter die Wohnung verlassen hatte: „Bist du müde, Schatz?“
Und ich antwortete wie immer: „Ja, Paps!“
Er nahm meine Hand und führte mich in mein Zimmer.
„Paps?“, fragte ich ihn, nachdem ich mir meinen Pyjama selbst angezogen hatte. Ich sah ihm zu, wie er meine Bettdecke öffnete und zurückfaltete.
Wie gern wollte ich ihn fragen, ob er mir ein Märchen vorlesen würde. Aber ich wusste seine Antwort darauf schon: „Deine Mutter kann das besser“, deshalb ließ ich es sein.
„Paps?“ Wiederholt sprach ich ihn an, vor ihm stehend, ehe ich ins Bett ging.
„Ja, Schatz?“ Er half mir dabei, ins Bett zu steigen. „Wolltest du nicht etwas fragen oder sagen?“ Er legte sorgsam die zurückgefaltete Decke über mich.
„Paps! Kannst du bitte die Tür einen Spalt offen lassen?“ Ich hatte Angst, das verschwieg ich ihm, und starrte nur die Tür an.
„Wie du willst, mein Schatz, gute Nacht!“
„Gute Nacht, Paps!“ Lange sah ich meinem Vater nach, danach schaute ich immer auf das Licht, das vom Wohnzimmer über die offene Spalte mein Zimmer ein wenig erhellte.
Große Unruhe überkam mich dann immer. Das Kleinsein, sich ungeschützt Fühlen, einsam zu sein – diese Gefühle überwältigten mich dann, ich drehte mich auf die rechte Seite und drückte die Augen zu. In meinem kleinen Kopf schwirrten die Gedanken, mal dachte ich über den Kindergarten nach, mal wieder über Mutter und Vater. Es war schwer, einfach einzuschlafen.
An diesem Abend drehte ich mich hin und her, ich konnte nicht schlafen und immer stärker stiegen Ängste in mir auf. Als ich in Panik meine Augen öffnete, konnte ich weder die Türspalte noch ein Licht erkennen. Es war überall stockdunkel.
„Paps“, rief ich voller Angst. „Paps, bist du da?“ Ich rief und rief. Wo um Himmels willen blieb mein Vater. Warum brannte kein Licht mehr in unserer Wohnung? Was war geschehen?
In der Finsternis versuchte ich aufzustehen und schlüpfte unter der Decke hervor, um auf die Beine zu kommen. Sobald ich fest auf den Beinen stand, fühlte ich mich noch viel verlorener und einsamer als im Bett, und ich hatte große Angst, gegen einen Gegenstand zu laufen und mich zu verletzen.
Ich fing an zu weinen, es war alles so gespenstisch!„Paps, wo bist du? Bitte, Paps hilf mir, ich habe solche Angst!“ Meine Hilferufe verhallten im Zimmer, genützt hatten sie kein bisschen. Plötzlich hörte ich, wie sich in der Wohnungstür der Schlüssel im Schloss drehte und sie geöffnet wurde.
„Paps, Paps, bist du es, ich habe solche Angst!“, rief ich, so laut ich konnte. Es musste mein Vater sein, der schnell etwas erledigt hatte und nun hoffentlich endlich wieder heimgekommen war. „Susan! Kleines, wo bist du?“ Überraschenderweise erkannte ich die sorgende Stimme meiner Mutter, dann wurde es wieder hell.
„Mam, du bist zurück?“, rief ich zutiefst froh und verweint und fiel meiner Mutter schluchzend in die Arme, als sie die Kinderzimmertür öffnete. Sie stürmte herein und nahm mich in ihre Arme. Das Weinen brach erneut aus mir heraus, ich weinte und weinte und konnte nicht mehr damit aufhören.
„Wo ... wo ist dein Vater hin?“, fragte sie aufgeregt immer wieder, ohne laut zu werden. Ich sagte mit Gefühlen, die zwischen Angst und Freude schwankten:
„Ich weiß es nicht, Mam; ich weiß es nicht!“ Meine Kinderstimme zitterte.
„Komm, mein Kleines, es ist höchste Zeit zum Schlafen!“ Sie nahm mich an der Hand und brachte mich zurück ins Bett. Ihr Dasein gab mir Halt, ich fühlte mich sicher in ihrer Nähe. Ich wusste nicht genau, was zwischen meiner Mutter und meinem Vater vorgefallen war, dazu war ich noch zu klein. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er hatte sein Wort nicht gehalten, dass er bei mir bliebe, während sie zur Arbeit ging!
Es war untereinander abgemacht gewesen! Deshalb war ich sehr verärgert über meinen Vater, der auf irgendeine Art Mutter wehtat. Jedoch wusste ich als kleines Mädchen natürlich noch nicht, dass das nicht der einzige Grund war, weswegen meine Mutter so litt. Aber ich war jetzt überglücklich, dass sie bei mir war. Sie trocknete meine Augen mit ihren Baumwolltaschentuch, streichelte sanft über mein Haar und gab mir einen liebevollen Kuss, während sie neben mir saß. Ja ihr Dasein füllte mein Leben wieder mit Trost und Freude, als ich wieder im Bett lag.
Ohne eine Bitte von mir stand sie auf und holte mit nervösen Schritten im Nu das Märchenbuch aus dem kleinen Bücherregal. Ihre gespannte Haltung war nicht zu übersehen, jedoch wagte ich kein einziges Wort hervorzubringen. Ich beobachtete sie aufmerksam, mit von Tränen aufgehellten Augen. Ihre Hände zitterten. Sie konnte kaum das Buch festhalten und auf einmal fiel es zu Boden. Sie brannte, ja sie brannte mit ihrer ganzen Seele in einem Feuer der Enttäuschung, der Demütigung und stand vor ihrer zerbrochenen Familie.
„Mam“, sagte ich und hielt ihre durch die inneren Kämpfe immer heißer werdende Hand, als sie wieder neben mir saß.
„Schon gut, Kleines. Schon gut, mein Schatz.“ Sie schüttelte ihren Kopf hin und her. „Ich werde dir ein Märchen erzählen.“ Ihre Stimme wurde immer dünner, auf einmal verlor sie sie ganz. Eine Stille, eine lange Stille füllte das Zimmer. Ihr Kopf hing nach unten, ihre dunkelblonden Haare bedeckten ihr schönes Gesicht.
Ja, sie versuchte, die Tränen zu verstecken. Dann plötzlich wischte sie ihre Augen mit beiden Händen, hob ihr Gesicht hoch und schob ihre Haare aus dem Gesicht.
Dann brachte sie ihre rechte Hand an mein Haar, ihre geröteten Augen ruhten darauf. „Es war einmal ...“ Sie zog ihre Nase hoch, dann erzählte sie weiter. „Es war einmal ein hübscher Prinz in einem fernen Land. Er war so hübsch, dass jeder ihn gern haben musste. Seine Mutter, die Königin, und sein Vater, der König, verwöhnten ihn so sehr, dass er mit der Zeit hochnäsig, faul und höhnisch wurde. Er war so hochnäsig, dass er jede junge Frau ablehnte zu heiraten.
Eines Tages unternahm er eine Reise in das Landesinnere. Überall, wo er hinkam, jubelten die Menschen und verbeugten sich vor ihm, weil sie vor ihm Angst hatten.
Zufällig kam er in einem kleinen Dorf vorbei und sah ein junges Mädchen, das auf einem Weizenfeld ununterbrochen Körner verstreute. „Guten Tag“, sagte der Prinz und war sehr verwundert, dass das Mädchen ihn übersah und einfach weiter arbeitete.
„Du da“, rief der Prinz zornig. „Weiß du eigentlich, wer ich bin?“, sprach er weiter, vor Zorn war er ganz rot geworden. Das Mädchen hob ihr Gesicht und sah ihm in die Augen. „Ich weiß, wer du bist, mein Prinz. Du verdienst aber nicht im Geringsten meinen Respekt, sondern meine Verachtung, weil du nicht weißt, was Arbeiten heißt und dadurch würdevolles Leben!“
Der Prinz war sprachlos. Er wusste keine Antwort darauf, weil das Mädchen die Einzige war, die ihm bisher die Wahrheit gesagt hatte in seinem ganzen Leben. Er sah sie lange an, ihre blonde Haarpracht, die bis weit über ihrem Rücken herabhing. Die Haare wehten flatternd im weichen Wind und glänzten unter den heißen Sonnenstrahlen wie die goldenen Weizengarben. Der Prinz war sehr angetan von ihren treuen, braunen Augen und ihrem schönen Gesicht.
Ihre Aufrichtigkeit und ihre Weisheit fand er beeindruckend. Er stieg von seinem Pferd, ging auf das Mädchen zu, nahm ihre von der Erde beschmutzte Hand, küsste sie und fragte sie: „Willst du mich heiraten?“ Das Mädchen sah ihn an, und als sie fühlte, dass der Prinz verstanden hatte, was sie ihm gesagt hatte, antwortete sie schlicht: „Ja!“
„Der Prinz nahm sie mit sich heim.“
Das Wort „heim“ löste eine tiefe Trauer in meiner Mutter aus. Sie schluckte mehrmals vergeblich den Knoten, der sich bei ihr im Hals gebildet hatte, schwer hinunter. Jedoch tat ihr das von ihr selbst erfundene Märchen gut und lenkte sie einen Moment von ihren Sorgen ab.
Sie hatte mich als Dorfmädchen beschrieben, mit meinen blonden Haaren, die ich damals als Kind hatte und die heute nachgedunkelt sind. Meine braunen Augen hatte sie geschildert, und damit gab sie mir das Gefühl, eine Märchenheldin zu sein. Das beruhigte mich auf eine Art, wie ich es noch nie erlebt hatte.
Kaum konnte ich meine Augen noch offen halten. Aber die Geschichte ging weiter.
„Der Prinz schenkte dem Mädchen einen goldenen Ring mit einem roten, großen, echten Edelstein daran“, hörte ich meine Mutter leise weitererzählen. Das war das Letzte, was ich noch mitbekam, ehe ich einschlief.
Ein Riesenkrach von lauten Stimmen weckte mich wieder aus meinem tiefen Schlaf auf. Ich schlich leise zur offenen Spalte. „Wo bist du gewesen? Sage es mir, wo bist du gewesen?“ Meine Mutter war feuerrot im Gesicht angelaufen. Ich wagte es kein zweites Mal, sie anzusehen, und vergoss schon wieder Tränen und dachte daran, wie sie nun wieder leiden musste. Sie zog ihre Nase hektisch hoch und fuhr verweint fort: „Ich vertraue dir unsere kleine Tochter an und gehe zur Arbeit, um Geld für uns zu verdienen, und du lässt sie einfach allein! Allein und unbeaufsichtigt! Schlägt dir da nicht wenigstens das Gewissen?“
Mein Vater brüllte sie an. „Wieso bist du schon so früh daheim? Moment mal! Du hast mir nachspioniert! So ist das also!“
„Nein! Ich habe mich versteckt und war sehr gespannt, was du machst, wenn ich zur Arbeit gehe! Ich sah dich das Haus verlassen.“ Sie rang nach Luft. „Ich wusste es, ich wusste bei Gott, dass du versagen würdest!“
„Ich war in der Kneipe, hast du was dagegen?“
„Sicher habe ich etwas dagegen! Deine Tochter ängstigt sich daheim ohne ihren Vater und du hockst in der Kneipe, trinkst gemütlich dein Bier und gibst Geld aus, das ich mitverdienen muss!“ „Es ist mein Geld, Jawohl, mein Geld!“
Sie schrie ihn weiter mit weit ausgestreckter Hand an. „Dein Geld reicht nicht einmal für unsere Familie, sodass ich als Hausfrau mit Kind abends arbeiten muss!“ Sie war am Ende angelangt, am Ende ihrer Gefühle und ihrer Nerven.
Meine Mutter bedeckte ihr Gesicht mit der Hand, wandte sich von meinem Vater ab und weinte. Es schien, als könne sie nie mehr aufhören zu weinen.
Plötzlich lag eine tiefe Stille im Wohnzimmer, nur die kräftigen Schritte meines Vaters verhallten. Mit meinen kleinen Fingern griff ich zitternd nach dem Türgriff und schob die Tür, die noch eine Spalte offen war, ein kleines Stückchen weiter auf. Ich sah meinen Vater, der seine Jacke vom Kleidergestell riss und sie an sich nahm.
„Ich gehe, hörst du! Ich gehe fort und komme nie mehr hierher zurück! Ich habe es satt mit dir und deinen hysterischen Anfällen!“ Mein Vater eilte zur Wohnungstür, riss sie auf, verschwand und schlug sie kräftig hinter sich zu.
Meine Mutter folgte ihm nach bis zum Eingang, sie war außer sich. Ich sah sie in das Wohnzimmer stürmen. Für einen Moment sah ich sie nicht mehr, aber gleich kehrte sie mit einem Stuhl in der Hand zurück. „Geh nur, geh nur, du elender Versager! Verstehst du nicht, dass sie unsere kleine Tochter ist?“, schrie sie hysterisch ihre Bitterkeit hinaus, während sie den Stuhl gegen die Wohnungstür schleuderte. Danach vermischte sich ihr Schluchzen mit meinem, während sie am Boden zusammenbrach.
Mein Vater kam niemals mehr zurück.
Schon am frühen Morgen führte meine Mutter ein ernstes Gespräch mit einem Mann vom Büro und erläuterte ihm, weshalb sie gestern nicht bei ihrer Arbeit erschienen war.
Von diesem Tag an erwartete uns ein noch schwieriges Leben, als wir es bis dahin schon gehabt hatten. Es traten einige Veränderungen in unser Leben, besonders für mich gab es eine gewaltige Umstellung.
Ich konnte diese Erlebnisse meinem Vater bis heute nicht verzeihen, obwohl er wohl kein schlechter Mensch war. Doch wie er an diesem Abend meine Mutter behandelt und uns verlassen hatte, konnte ich nicht verzeihen.
Nach ein paar Monaten zogen wir in eine Zweizimmerwohnung in gleicher Umgebung um. Meine Mutter führte ein langes Gespräch mit mir und erläuterte mir, dass ich in Zukunft viel allein sein würde. Sie fand eine Tagesstelle, doch ab und zu ging sie auch abends zu einer Teilzeitstelle.
„Kleines“, sagte sie nachdenklich. „Ich muss arbeiten, wir brauchen Geld, Geld zum Weiterleben, verstehst du mich, mein Schatz?“
„Ja“, antwortete ich leise, ohne Einwände und eine Gegenfrage. Ich dachte, dass ich meine Mutter mit meiner Fragerei nur noch mehr belasten würde. Ich bekam den Hausschlüssel um meinen Hals umgehängt und lernte nun das Alleinleben gründlich kennen, oder besser gesagt; lehrte mir das Alleinsein.
Tagsüber ging es noch, ich wurde abgelenkt vom Kindergarten, später dann von der Schule, aber die Abende, an denen meine Mutter zur Arbeit ging, waren schlimm für mich.
„Du kannst zu Sarah gehen, Kleines!“, schlug mir meine Mutter vor. Am Anfang folgte ich ihrem Rat, aber mit der Zeit wurde ich traurig, weil die Familie dort bei Sarah nicht meine eigene war. Deshalb blieb ich lieber alleine daheim und träumte meine kindlichen Träume vom Dorfmädchen, dem Prinzen und den echten Edelsteinen.
Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, sagte meine Mutter: „Susan, mein Schatz, ich bin stolz auf dich! Du bist ein gutes Kind. Du bist gut in der Schule, du kannst gut mit Menschen umgehen, ja, du bist mir eine gute Tochter, und ich möchte dir eine Freude machen, etwas, was dir besonders am Herzen liegt!“
Ohne lange zu überlegen sagte ich. „Och ja, Mam, einen goldenen Ring mit einem roten, echten Stein darauf, das wünsche ich mir.“
Zwei scharfe Falten bildeten sich zwischen ihren zwei Augenbrauen. Sie sah mich einige Sekunden in großer Stille fragend an.
Plötzlich stieg ein Gefühl der Reue in mir hoch und ich dachte, dass so ein Ring wahrscheinlich ein Vermögen kostete! Somit entschloss ich mich, obwohl ich so nah daran war, meiner Mutter zu antworten: „Nein, Mam, du brauchst mir keinen Ring zu schenken!“
Meine Mutter nahm mein Gesicht zwischen ihre beiden Hände. „Du sollst deinen Ring bekommen“, sagte sie mit ihrem warmen Lächeln in ihrem wiedererhellten Gesicht und küsste mich auf meine Stirn.
Die zwei tiefen Falten meiner Mutter – nie hatte ich erfahren, ob das Kummerfalten waren oder ob sie schockiert war über meinen Wunsch. Jedenfalls bekam ich meinen Ring ein paar Tage später. Ich trug ihn nie, sondern bewahrte ihn auf wie ein Geheimnis. Ich bettete ihn in eine kleine, selbst gebastelte und glänzende Kartonschatulle und hatte große Angst, ihn zu verlieren. Meine Freude kann ich nicht beschreiben über dieses Geschenk, so groß war sie.
Jedes Mal, wenn ich allein war, nahm ich die Schatulle in die Hand, träumte einfach vor mich hin, und damit war ich nie mehr allein.
„Meinst du nicht, dass die Teigwaren weich genug sind?“ Meine Mutter holte mich aus meinen Erinnerungen zurück, die ich für immer vergessen, nie wieder hatte daran denken wollen. Erschrocken drehte ich meinen Kopf ich ihre Richtung. Unverhofft erschien meine Mutter neben mir. Unsere Augen trafen sich wie in einem Rätsel, das wir beide zu lösen hatten. Sie tastete mein Gesicht mit ihren Augen ab und versuchte darin zu lesen, worüber ich mir Gedanken machte.
Ich war gespannt, was sie über unser Heim, ja die Idee von Heim mit Familie dachte.
„Och! Mam, entschuldige, ich habe nicht bemerkt, wie du zu mir kamst!“
„Das dachte ich mir, du warst so abwesend!“
„Ja, ich ... Du hast Recht, ich war vollkommen in Gedanken“, antwortete ich mit einem gezwungenen Lächeln, damit ich nicht nur glücklich erscheinen wollte, sondern hoffte, dass ich dann auch glücklich war und meine unglücklichen Gedanken damit begraben konnte.
„Das Essen ist schon bereit“, lud ich beide ein. Thomas war schon zur Stelle und nahm seinen Platz am Tisch auf der Eckbank ein.
„Hoffentlich hast du dir meinetwegen keine allzu großen Umstände gemacht“, meinte meine Mutter sehr freundlich in dem bescheidenen Ton, in dem sie mich immer zu loben versuchte, wenn ich etwas Gutes für sie tat.
„Ach Mam, ich mach alles gern für dich, das weißt du!“ Sie half mir unaufgefordert, die Serviceteller auf den Tisch zu stellen. Wir arbeiteten kurze Zeit Seite an Seite, einen Augenblick sah sie mich mit ihren grau-grünen Augen an und schenkte mir damit Wärme, Mut und Glück, die ich darin entdeckte.
Könnte sie sie je vergessen, die bittere Vergangenheit, die ich nie vollständig erfahren hatte? Sie ... ja, das wusste ich mit Bestimmtheit, sie opferte sich voll und ganz, aber mir hatte sie vieles verschwiegen. Ich holte tief Luft, wie immer dachte ich, mein Vater sei schuld an allem Unglück gewesen.
Als ich traurig zum Himmel sah, dachte ich daran, was alles auf mich wartete. Würde sich in zehn Tagen mein Leben ändern? Welches Leben wartete wohl auf mich? Am Samstag, dem 25. März wollten wir heiraten. Thomas und ich. „Fast zwei Jahre müssten genügen für unsere Probezeit“, hatte er gemeint. „Du solltest dir keine Sorgen machen über unsere Zukunft. Aber du solltest dankbar sein, dass wir so eine schöne Wohnung und Arbeit haben und fleißig arbeiten können“, sagte Thomas in überzeugtem Ton. Ich aber erwartete noch andere Dinge von meinem Leben, nicht nur Arbeiten und eine Wohnung! Ich seufzte tief und schwer. Wenn ich jetzt nur zaubern und das schreckliche Wetter in strahlenden Sonnenschein verwandeln könnte! Aber war es nur das Wetter?
Wie von einer Hand berührt schrak ich hoch und war auf einmal hellwach, dabei hatte ich mir gestern Abend keine großen Überlegungen mehr durch den Kopf gehen lassen! Meistens weckten mich erst die Wanduhren, an denen ich auch im Schlaf erschrak, weil ich mich schon immer gespannt ins Bett legte. Kurz gesagt – ich hasste diese Uhren.
Mit einem prüfenden Blick sah ich auf Thomas, der aber ganz zufrieden weiterschlief. Ich lauschte seinem gleichmäßigen Atem eine Zeit lang, in der Hoffnung, irgendwann wieder einschlafen zu können. Es war sinnlos.
Obwohl keinerlei Schlagen der Glockenuhren und auch kein Donnerlärm der Flugzeuge zu hören war, war kein Schlaf in Sicht. Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, auf den Balkon zu gehen, mitten in einer nassen, kalten Novembernacht.
Ich stand auf und ging aus dem Schlafzimmer. Mein Hals fühlte sich trocken an.
Wie üblich waren die Heizungen auf höchste Stufe eingestellt, wodurch sich die Luft sehr trocken anfühlte. Ich mochte diese warme Luft und liebte es, mich in molliger Wärme zu entspannen, anstatt mich vor Kälte zu verkrampfen und allein derentwegen nicht gelöst sein zu können.
Aber in dieser Nacht hatte ich ein großes Verlangen nach Kälte. Vom großen Salon aus machte ich einen Umweg in die Küche, holte mir eine Flasche Mineralwasser und goss mir ein Glas ein. Damit stand ich hinter der Balkontür, nur mit meinem Nachthemd bekleidet. Einen Spalt zog ich die weißen Vorhänge zurück. Es musste draußen noch stockdunkel sein. Im elektrischen Licht spiegelten sich die Möbel am Fenster. „Es ist nur ein Wagnis“, murmelte ich vor mich hin. Das Glas stellte ich auf die Eckbank, ging rasch zurück zu der langen Eingangsflur, öffnete den großen Schrank und holte meinen dunkelblauen Mantel mit Kapuze heraus, der am Kragen, am Kapuzenanfang und innen mit Kunstpelz gefüttert war.
Ich zog ihn über, die Kapuze gleichfalls, die Knöpfe schloss ich sehr eng am Hals, schließlich durfte die Kälte nicht herein, genauso zog ich noch die warmen Stiefel an. Unterwegs nahm ich das Mineralwasser mit, öffnete die Balkontür und machte sie gleich wieder hinter mir zu, damit die Kälte nicht in die Wohnung eindringen konnte.
Meine Mutter wusste, dass ich schon als Kind die Wärme gern hatte. Kaum kam ein wenig Wind auf, fragte sie mich stets besorgt: „Hast du dich warm genug angezogen, Kind?“
In Gedanken über meine Mutter sank ich fast automatisch auf einen der Balkonstühle.
Seit meinem gemeinsamen Leben mit Thomas wurde mir nach und nach einiges klar über eine Familie. So fragte ich auch meine Mutter einiges, was ich bis heute nicht gewagt hatte, mit ihr zu besprechen. Bei ihrem Besuch im September war nicht zu übersehen gewesen, wie zufrieden und gelassen sie bei uns war. Sie konnte sich sogar mit uns freuen und lachen wie auf einem Foto. Es gab sehr wenige Fotos von ihr und meinem Vater. Auf einem trug sie ein weißes Kleid mit Blümchen darauf und sie strahlte ein sorgenloses, wunderschönes Lächeln in die Kamera, ohne ihre Zukunft auch nur im Geringsten zu ahnen. Als ich sie fragte, ob sie an ihrem Hochzeitstag glücklich gewesen war, antwortete sie: „Ja, ich war glücklich!“ Ein seltsames Funkeln lag in ihren Augen. „Wir haben im engsten Kreis geheiratet“, fügte sie leise hinzu.
„Mam, wie hast du Vater kennen gelernt?“, fragte ich sie. Es war eigenartig.
Waren wir, meine Mutter und ich, so mit dem Alltagsleben beschäftigt gewesen, dass ich über meine Eltern kaum etwas wusste? Weil dieses Leben jeden von uns in eine andere Ecke vertrieben hatte.
„Wir arbeiteten beide in der gleichen Fabrik. Dein Vater war umschwärmt von jungen Frauen, er sah sehr gut aus. Doch er wählte mich. Schon beim ersten Blick hatte es zwischen uns gefunkt!“ Sie lächelte ein wenig, ein weicher Blick traf meine Augen.
„Ich war damals ein naives, junges Mädchen im Alter von achtzehn Jahren, dein Vater war erfahrener in vielen Dingen, das imponierte mir sehr, auch in Sachen Liebe!“ Ihre leicht geröteten Wangen deuteten darauf hin, dass sie in Verlegenheit geraten war.
„Wir heirateten ziemlich schnell und verbrachten zwei wundervolle Jahre miteinander!“ Plötzlich lagen tiefe Schatten auf ihrem gerade noch so heiteren Gesicht. „Dann tauchten langsam unsere Probleme auf. Tag für Tag kamen mehr dazu.“ Sie hielt ihren Kopf gesenkt und erzählte fast so leise, dass sie sich kaum selbst hören konnte.
„Mal waren es Geldsorgen, mal Enttäuschungen in jeder Art und Weise. Später wurde alles noch schlimmer. Ich fühlte mich verraten und einsam mit einem Kind!“ Ihre Stimme erholte sich von der Trauer, sie ging zu Klagen über. „Er ... er teilte das Leben nicht mit mir, er versuchte es nicht einmal. Verstehst du das?“
Sie suchte meine Augen, ob sie darin Mitgefühl lesen konnte. Ja, ich fühlte mit, weil ich vieles als Kind hatte mit ansehen und miterleben müssen.
„Hat er dich jemals geschlagen, Mam?“, Damit wollte ich wissen, ob er bis zum Äußersten gegangen war. Wenn ja, hätte ich ihn noch mehr verachten können, weil er meiner Meinung nach an allem schuld war. Für einen Moment gönnte sich meine Mutter Ruhe, dann sagte sie mit einem schweren Seufzer:
„Nein, das hat er nicht. Aber es war psychischer Krieg zwischen uns, weil keiner nachgeben wollte!“
„Du sagtest, du warst naiv und glaubtest an Vater?“
„Ja, durch ihn und seinen Fehlern lernte ich mit der Zeit das Leben besser kennen. Ich sammelte schnell Erfahrungen und war mir mit einem Mal bewusst, dass er fortwährend Fehler machte.“ Nach einem kurzen Zögern erkundigte ich mich, ob mein Vater ihre einzige Liebe gewesen sei. Ob sie nicht noch einmal einen anderen Mann lieben könnte, weil sie so vieles verpasste in den gemeinsamen Jahren mit meinem Vater. Sie sah immer noch jünger aus, als ihr wirkliches Alter war. Und sie war noch jünger als ich gewesen, als sie meinen Vater getroffen hatte, mit zwanzig Jahren bekam sie mich schon.
Ihre Blicke schweiften über mein Gesicht, dann wandte sie sich weg von mir.
Ich war verlegen. Es waren ihre eigenen Gefühle, die sie bis heute für sich behalten hatte. Dennoch, sie weckten Neugier und Aufmerksamkeit in mir, was sie darauf antworten würde.
Sie nahm sich noch Zeit zum Überlegen, bevor sie antwortete. Fiel es ihr schwer, mir ihre Gefühle zu eröffnen? Sie sah mich an. „Weißt du ...“ Zwar hatte sie einen sicheren Ton, aber keine sichere Körperhaltung. Müdigkeit und Erschöpfung sah man bei ihr. Ihre Schultern hingen herunter. Verlor sie ihren Lebensgeist? Bis heute war mir das niemals aufgefallen …
In all den Jahren, seit mein Vater sie verlassen hatte, hatte sie sich kein einziges Mal beklagt. Davor hingegen war sie ihren Erzählungen nach lebhaft und voller Energie gewesen, auch die wenigen Fotos bestätigten das.
„Dein Vater war meine einzige Liebe, so sicher wie ich Annette heiße“, hörte ich sie sagen. Dann tauchten die Einzelheiten der Vergangenheit vor ihren Augen sowie vor meinen wieder auf. Ich sah sie nur streiten, immer nur …
„Nun, was hatte ich davon?“, sagte sie unsicher.
Dieses unsichere Verhalten löste in mir ein Durcheinander aus. Ja, wie schön wäre es, wenn ich sicherer wäre bezüglich meiner Beziehung zwischen Thomas und mir.
„Ich war damals naiv“, hatte meine Mutter erzählt, „und glaubte an deinen Vater“, das gestand sie ein.
Hatte sie bis heute keinen Mann gefunden, mit dem sie an ihrem Glauben festhalten konnte? Oder saß die Angst so tief, wieder enttäuscht zu werden? Aber das Freisein machte ihr auch Spaß, sie konnte machen, was sie wollte, und war von niemandem abhängig.
„Heute muss ich mich bei niemandem für irgendetwas rechtfertigen!“ So, wie ich vermutet hatte, fuhr sie nach einer Pause fort.
„Ich kann arbeiten und über mein Geld selbst bestimmen und es ausgeben, ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen!“ Ob sie tatsächlich dadurch innerliche Zufriedenheit und Selbstsicherheit hatte, fuhr es mir durch den Kopf, und – reichte das für das ganze Leben?
„Ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, allein zu leben. Ich bin frei und selbstständig und kann über alles allein entscheiden!“
Das Alleinsein bereitete mir viele Sorgen, wenn ich nur daran dachte. Als Kind war ich zu oft allein gewesen. Ich konnte damit zwar umgehen, aber die kindliche Einsamkeit hatte schwere Spuren in mir hinterlassen. Und Sehnsüchte, die sich niemals verwirklichen würden!
Eine letzte Frage wagte ich noch an sie. Ob meine Mutter meinen Vater vermissen würde, wollte ich wissen.
Immer wenn sie an ihn dachte, so auch dieses Mal, holte sie tief Luft, und doch gestand sie, dass sie ihn immer noch gern hatte. „Was hätte es für einen Sinn, wenn wir ständig stritten und uns das Leben gegenseitig schwermachten, wenn wir je zusammenkommen würden?“ Sie näherte sich mir und hielt mich an beiden Schultern fest.
„Ach Kleines, ich kann dir nicht einmal Ratschläge geben, das oder jenes könntest du besser machen als ich. Versuche einfach, nach deinen Gefühlen zu handeln!“
Sie war verkrampft, als sie meine Augen suchte. Ich spürte, wie sie innerlich immer noch, nach all den Jahren litt.
Ich fragte sie nie wieder danach.
Eine Hand berührte mich an meiner Schulter, während ich noch tief versunken in meine Überlegungen war. Fast hätte ich das leere Glas aus der Hand fallen lassen, so erschrocken fuhr mein Kopf zur Seite.
Thomas` blaue Augen fand ich beim ersten Blick in meinen. „Kannst du nicht schlafen, Liebes? Was machst du mitten in der Nacht auf dem eiskalten Balkon?“
Wie Recht er hatte! In meinen Fingern hatte ich gar kein Gefühl mehr, sie fühlten sich erfroren, ja eiskalt an!
Thomas nahm mir das Glas ab und half mir beim Aufstehen. Dann öffnete er die Balkontür und trat zur Seite, damit ich hineingehen konnte. Kaum hatte ich den großen Salon betreten, fühlte ich im ganzen Körper, wie mich das warme Blut durchströmte. Ich legte die Kapuze zurück und konnte den erstaunten, weiten Augen von Thomas nicht entgehen.
„Wie konntest du nur ...“, warf mir Thomas laut vor.
„Ich konnte nicht schlafen! Mich beschäftigten zu viele Gedanken an meine Mutter!“
„Du hättest dir den Tod holen können bei der Kälte!“
„Aber wenn ich mir so überlege, wie allein sie ist ..
“ Thomas sagte: „Es ist nicht einfach für deine Mutter, sich wieder in eine andere Person zu verlieben und Beziehungen aufzubauen von Anfang an. „In der Tat, das war durchaus richtig nach dem, was sie so alles hinter sich hatte.
„Aber es ist nicht schön, in einem einsamen Lebensraum zu existieren!“
„Ich weiß, ich weiß!“ Dann half mir Thomas, den eiskalten Mantel auszuziehen.
„Leben sollte man das Leben, jeden Tag mit Inhalt füllen und damit glücklich werden!“
„Das mag sein. Aber jetzt ist weder der Zeitpunkt um darüber nachzudenken noch das zu diskutieren. Es ist Schlafenszeit, bitte komm jetzt ins Bett!“
Ich sah mich noch einmal um. Der Regen schien aufgehört zu haben. Stattdessen wehte ein bissiger Wind von Westen auf mich zu. Sollte ich den vom Regen durchnässten Jackenkragen zudrücken, um mich davor zu schützen? Ich wusste, dass ich demnächst erkältet sein würde.
Ich beobachtete die noch dunkler gewordenen, schwer am Himmel hängenden Wolken, die so tief über mir rasch vorbeizogen, und die ihnen die nächsten dunklen Wolken nachfolgten, deuteten darauf hin: Wie schnell sich die Erde dreht, dadurch so schnell die Zeit vergeht, dachte ich mir.
Ja. Zeit zum Geborenwerden. Zeit zum Leben. Zeit zum Gehen für immer.
Meine Blicke schwebten wieder zum Himmel und suchten nach Antworten auf Fragen, von denen noch so viele offen waren. So wie meine Zukunft.