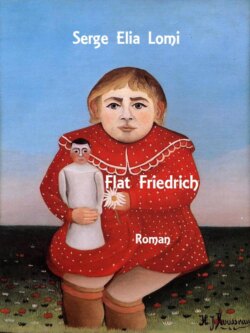Читать книгу Flat Friedrich - Serge Elia Lomi - Страница 7
Kapitel 1
ОглавлениеFingerübung
Es war an einem jener schwermütigen Tage nach Abflauen der revolutionären Anwandlungen, die das Volk ergriffen hatten wie ein plötzliches Beben. Seit dem Abflauen meiner letzten Erektion auf den weißen und mit Spitzen versehenen Laken meiner ehelichen Spielwiese waren bereits viele Raketen gezündet worden.
Alles begann, soweit ich mich erinnern kann, mit einer Einladung zum Dinner.
„Kommt doch mal vorbei“, sagte mein Arbeitskollege Roger Chormann zu mir, den alle nur Chory nannten, mich eingeschlossen. „Du, Lisa und die Kinder! Ist lange her, nicht wahr?“
„Was ist lange her?“ Ich war gerade dabei, Bauteil Nr. 34 an Bauteil Nr. 33 anzuschließen, hielt das Schweißgerät in der Linken und schob mit der Rechten das Visier meines Helmes hoch. Ich war mit echter, also ungeheuchelter Konzentration am Werk gewesen, was in letzter Zeit immer seltener vorkam, und ärgerte mich darüber, dieser durch wahrscheinlich nutzloses Geschwätz entrissen zu werden.
„Na, dass deine bessere Hälfte, Lisa, und du und die Kinder zu uns zum Essen kommt. Wäre doch mal wieder schön! Ich habe noch einen edlen Roten im Keller stehen, der wartet auf Vernichtung!“
Er stieß mich an, eine kumpelhafte Geste, die so gar nicht in das Muster passte, das sich von Chory in meinem Gehirn festgesetzt hatte. Er war immer so eiskalt, zurückhaltend, sprach nur das Nötigste, man lästerte schon lange hinter seinem Rücken, man nannte ihn auch „Mr. Lonesome.“
Ich war perplex, starrte ihn einen Moment lang an, um zu ergründen, ob es sich vielleicht um einen Scherz handelte. Aber seine eisblauen Augen erwiderten meinen Blick mit einer solchen Ernsthaftigkeit, dass diese Möglichkeit nicht in Betracht kam.
Ich zögerte, machte wohl eine etwas abfällige Bewegung mit dem Kopf, als stünde ich einem Kind gegenüber, das noch in die Grundzüge menschlicher Existenz eingeweiht werden muss. Dann fasste ich mir ein Herz und wählte den sanftmütigsten Ton, den ich in meiner Palette sanftmütiger Töne vorfand, als ich sagte: „Meine Frau heißt Agatha, nicht Lisa. Und wir waren noch nie bei euch zum Dinner. Ich weiß noch nicht einmal, wo du wohnst.“
Mr. Lonesome verzog das Gesicht, als habe er eine Zitrone verschluckt. Dann fasste er sich an den Kopf, lächelte schief, und seine immer ein wenig eingefallenen, unrasierten Wangen wurden von dem Rot der Peinlichkeit geflutet. „Ach so, ja! Sorry. Da hab ich dich jetzt wohl verwechselt. Nichts für ungut!“
„Kommt vor“, sagte ich, obwohl ich fand, dass eine solche Verwechslung Einzug in das Guinness-Buch der Rekorde halten sollte.
Wir arbeiteten weiter, stumm; der Lärm der Maschinen machte ohnehin jede Unterhaltung zur Kraftanstrengung. Ich befestigte Bauteil Nr. 34 an Bauteil Nr. 33 und schnappte mir Bauteil Nr. 35, bei dem es sich um eine aerodynamische, etwa 30 cm lange Röhre handelte, die an ihrem Ende jeweils links und rechts kugelig ausfiel und deren Sinn mir bislang verborgen geblieben war. Ich hatte mir aber auch nie ernsthaft Gedanken darüber gemacht; ich war ohnehin nur ein einfacher Arbeiter, und solange pünktlich am Monatsende das Gehalt auf meinem Konto einging, war alles gut, ich war zufrieden. Ich baute Raketen und hatte damit Anteil an der Kolonialisierung des Weltraums, das war eine grundanständige Sache, fand ich, und dieses Wissen um den Verbleib meiner Arbeitskraft genügte mir vollkommen. Wenn ich nun in einer Fabrik der Faschisten gestanden hätte, um besonders monströse und neuartige Waffen zu bauen, hätte es mich aber auch nicht weiter gestört; mir ging es nur darum, meine Familie durchzubringen. Ich wollte einfach leben und es mir im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut wie möglich gehen lassen.
Chory stand mit einem Mal wieder dicht an meiner Seite, viel zu nah für meinen Geschmack. Es fehlte nicht viel, und ich hätte mich in seinem Nasenhaar verheddert. Sein hageres Gesicht mit der markanten Nase und der von Falten gesäumten Stirn war wie eine Landschaft voller Gruben und Fallen.
Ich ging unwillkürlich einen Schritt auf Abstand. Abgesehen von dem üblichen Schweißgeruch des Arbeiters verströmte Chory zwar keinen Gestank, aber seine Nähe bereitete mir Unbehagen. Ich kam mit Menschen im Allgemeinen ganz gut klar, aber wenn mir jemand zu dicht auf die Pelle rückte, wurde ich unruhig. Als hätte ich Ameisen in den Unterhosen.
„Aber eigentlich, ganz ehrlich, was spielt das denn für eine Rolle, dass ihr uns noch nie besucht habt, ihr solltet uns gerade deswegen die Ehre erweisen, denn schließlich – wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen in einem Sektor?“
Ich überschlug die Zeit und erwiderte kühl: „Fünf, vielleicht sechs Jahre.“
„Verdammt!“ Chory lachte heiser. „Dann kommen wir wohl bald in unser verflixtes siebentes Jahr, was?“
Ich sagte nichts. Ich bin einer von denen, die nicht immer etwas sagen müssen. Sehr oft ziehe ich das Schweigen vor.
„Höchste Zeit für eine Einladung zum Dinner, was meinst du?“
Ich sagte nichts.
„Ich muss dir etwas zeigen. Etwas, was dir gefallen wird. Es könnte dein Leben verändern!“
Ich schwieg.
„Also abgemacht, Samstag, 13 Uhr, Virginia-Woolf-Boulevard 11, da wohnen wir, danke für euer zahlreiches Erscheinen! Ihr seid doch zahlreich?“
Als ich nach Hause kam, waren, wie so oft, die Kinder noch auf den Beinen. Ich hätte es vorgezogen, einfach in der Couch zu versinken, die Beine hochzulegen und Sturzbäche kalten Biers die Kehle hinunterlaufen zu lassen, während die TV-Wall die neuesten Abenteuer von Curtis Taylor, dem Weltraumhelden, präsentierte oder ein Flatball-Game der Nationalmannschaft.
TV-Wall – benannt nach ihrem Erfinder, Arthur Jerome Wall (2012-2064): eine zimmerwandgroße Fernsehtransmissionsfläche, seit den 60er Jahren des 21. Jahrhunderts Standard in jedem Wohnzimmer.
Flatball – Spiel, das sich seit den 30er Jahren des 21. Jahrhunderts zunehmender Beliebtheit erfreut und in vielen Ländern den Fußball als Volkssport Nr. 1 ablöst. Ziel des Spiels ist es, den Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren, indem man ihn – mit welchem Körperteil auch immer – in einer Höhe von höchstens 50 cm bewegt. Das Tor ist ein 2 x 2 Meter großes Loch im Boden, das durch einen in der Regel höchst aggressiven Torhüter bewacht wird, der jedes Mittel – auch Gewalt - anwenden darf, um herannahende Bälle abzuwehren. Die meisten Spiele enden 0:0.
Aber die Realität sah anders aus. Ich war Familienvater, und das ist ein Job, bei dem man in ständiger Bereitschaft ist, der einen nie wirklich die Beine hochlegen lässt, und selbst wenn man einmal so weit kommt, womit man schon im Übermaß vom Glück begünstigt ist, so ist es noch eine weite Reise bis zum Himmelreich der Entspannung.
Da meine Frau in letzter Zeit abgebaut hatte und ich mir in ständiger Erwartung ihres Nervenzusammenbruchs bereits ein paar Notrufnummern zurechtgelegt hatte, war ich besonders gefordert. Aber ich beschwerte mich nicht. Kinder sind eine tolle Sache. Sie öffnen den Horizont. Mit ihnen reitet man in das Reich der Fantasie. Ein Leben ohne ihre Gesellschaft wollte ich mir nicht ausmalen. Sie war eine willkommene Alternative zur TV-Wall, vor der man, als handelte es sich dabei um eine elektronische Ausführung der Mutter, die einen in den Schlaf singt, regelmäßig in Schnarchen und Sabbern verfiel. Aber gegen ein paar Tage ohne Kinder einmal im Monat hätte ich nichts einzuwenden gehabt.
Kaum hatte ich per IC die Tür zu unserer 100-Quadratmeter-Wohnung geöffnet, sprang mir auch schon Ben die Beine hoch, ein Knirps von vier Jahren, der jüngste Spross der Familie.
IC (Identity Check) - Fingerabdrucköffnungssystem
„Daddy!“ rief er. „Hast du mir was mitgebracht?“
„Na klar“, antwortete ich, beugte mich zu ihm hinab, um ihn kurz darauf in meine Höhen auffahren zu lassen. Ben kaute auf einer undefinierbaren Masse herum, die offenbar sein Abendessen darstellte. Sein blondes Haar stand ihm in unbezähmbaren Büscheln vom Kopf, als handelte es sich bei ihm um eine Kinderausgabe Einsteins. Er roch nach einem lebhaften Tag, den er zweifellos wieder mit seiner Lieblingsbeschäftigung zugebracht hatte: Mummy auf Trab halten.
„Was denn, was denn?“ fragte der Knirps und schlug in freudiger Erwartung die Hände aneinander.
„Eine Eintrittskarte für den Solaris-Spielplatz“, sagte ich.
„Solaris-Spielplatz?“
„In der Solaris-Straße. Du weißt schon, den mit der großen Rakete und dem Mars, auf den man klettern kann.“
„Und du hast eine Eintrittskarte?“
„Klar. Hat mich ein Vermögen gekostet!“ Ich zog einen Prospekt aus der Innentasche meiner Jacke, auf dem Potenzmittel beworben wurden und den mir ein Arbeitskollege einmal zugesteckt hatte. „Hier siehst du: Da steht’s, Eintritt für den Solaris-Spielplatz, Wert: 2 Universaltaler.“
Universaltaler, kurz: U-Taler – Währung der eurasischen Zone seit 2028 (1 Universaltaler= 1,3 Euro des Jahres 2012)
„Ja?“ Ben nahm den Prospekt. Seine Stirn wurde vom Zweifel aufgescheucht und warf Falten. „Aber letztens, als wir da waren, brauchten wir keine Eintrittskarte!“
„Ja, aber der Spielplatz erfreut sich jetzt so großer Beliebtheit, dass nur noch ausgewählte Kinder Zutritt erhalten, und du bist dabei: freu dich!“
Ben riss die Arme hoch, ein Lachen zerstörte den Zweifel, der sich in sein Gesicht gegraben hatte. „Hurra!“ Und er sprang von meinen Armen und lief sogleich zu meiner Angetrauten, um ihr die Neuigkeit kundzutun. “Mummy, schau mal, was mir Daddy mitgebracht hat!”
Ich trat ein paar Schritte weiter in die Wohnung, streifte die Schuhe ab und meinte zu sehen, dass Dampfschwaden von meinen Füßen hochstiegen, ein Bild aus einem Comic, das ich halluzinierte. Als ich wieder aufblickte, blieben meine Augen an Nick hängen, mit seinen neun Sommern auf dem Buckel die älteste Junior-Ausgabe von mir. Er stand breitbeinig im Flur und lächelte matt, als sich unsere Blicke trafen.
„Und - hast du mir auch was mitgebracht?“
„Natürlich, na klar“, antwortete ich hastig und fühlte mich mindestens so schuldig wie der Killer, den man, auf seinem ausblutenden Opfer kauernd, ertappt hat. Nick machte man so leicht nichts vor. Ich griff in meine Jackentaschen, in die linke, in die rechte, um die suchende Hand dann auch in die Innentasche verschwinden zu lassen und stieß zuletzt einen lautlosen Fluch aus.
„Ich hab’s vergessen! In der Fabrik liegengelassen! Du bekommst es morgen, ja? Wie war’s in der Schule?“
„Du wechselst das Thema. Wer so schnell das Thema wechselt, der steht mit der Ehrlichkeit auf Kriegsfuß.“
„Was?“
Nick war die Wucht. Jedes Mal haute er mich um mit seinen Beobachtungen und Ansichten. Manchmal fragte ich mich, nur so zum Zeitvertreib und weil er derartige Spekulationen durch sein blitzgescheites Wesen geradezu herausforderte, was eines schönen Tages aus ihm werden würde. Er hatte das Talent, einem Depressiven den bereits genau durchdachten Selbstmord auszureden und ihn stattdessen dazu zu bewegen, einen Marsch auf Rom zu unternehmen, um dort dafür zu streiten, neuer Papst zu werden. Durch Nick ließ man sich besser in keine Diskussion verstricken.
Es kam mir höchst gelegen, dass in diesem Moment meine Frau um die Ecke gebogen kam, mit fliegendem Haar und einem Ausdruck im Gesicht, der mich an manche Gemälde von Francis Bacon erinnerte.
„Meine Ablöse, endlich! Hast dir aber Zeit gelassen! Noch ´n Bier gekippt?“
Ich blickte auf die Uhr. Meine Frau hatte Recht. Tatsächlich war ich drei Stationen früher aus der überfüllten Schwebebahn gestiegen, da ich so sehr an die Wand gedrängt worden war, dass ich plötzlich meinen linken Arm und mein rechtes Bein vermisst hatte. Der Spaziergang, auf dem ich fündig geworden war und in einer flüchtigen Inventur alle meine Gliedmaßen durchgezählt hatte, war belebend gewesen, hatte mich aber auch eine gute halbe Stunde meiner Zeit gekostet. Eine halbe Stunde Vaterzeit, Familienzeit.
Da meine Frau schon immer der misstrauische Typ war und ich keine Lust auf Diskussionen hatte, entschied ich mich dafür, ihr eine Lüge aufzutischen, da sie mir die Wahrheit ohnehin nicht abkaufen würde. Auch wenn ich so um die übliche Moralpredigt nicht herumkam, es war immer noch der einfachste Weg.
„Ja“, hörte ich mich sagen, und meine Stimme klang dabei so fern, als handelte es sich bei ihr um Staub vom Mars. „Hab mir noch zwei Bier genehmigt. Mit Mr. Lonesome. Hat uns zum Dinner eingeladen.“
„Was?“
„Wir haben eine Einladung zum Dinner.“
„Na toll! Ist ja wieder typisch! Für wen hältst du mich eigentlich? Während du dich in irgendeinem Striplokal vergnügst, sitze ich hier mit den Kindern und sehe dabei zu, wie sich meine Nerven in Luft auflösen! Geht es dir noch gut?“
„Wer hat was von Striplokal gesagt?“
Meine Frau besaß die herausragende Eigenschaft, aus einer Mücke eine Rakete zu machen. (Nach unserer Hochzeitszeremonie war sie den Dostojewski-Boulevard auf und ab gelaufen wie ein kopfloses Huhn. Sie hatte ihren Ehering, der mir aus dem längst vergangenen Reichtum meiner Familie zugefallen war, jedem ins Gesicht gehalten, der sich nicht rechtzeitig in Deckung hatte bringen können. Der aus Weißgold gefertigte Ring mit dem prunkvollen Diamanten in Form einer Rose hatte seinen Duft unter zahllosen fremden Nasen verströmt – ach, herrliche, verlorene Zeit!)
„Ach so! Wo hast du denn das Bier bitteschön getrunken? In der Kirche, oder was?“
Ich seufzte und gab mich geschlagen. „Okay“, sagte ich, „ertappt! Wir waren im Striplokal.“ Ich hatte keine Lust auf Diskussionen, und meiner Frau gefiel es, moralisch auf einer höheren Ebene zu wandeln. Hauptsache, sie konnte mich maßregeln. Hauptsache, ich war ihr am Ende des Tages etwas schuldig.
„Siehst du! Siehst du!“ sagte sie, und der Triumph in ihrer Stimme klang wie ein Peitschenhieb auf nackter Haut. Ihr blondes lockiges Haar, in das sich zunehmend aschgraue Kringel mischten, hüpfte auf ihrem Schädel wie ein tollwütiger Pudel. Ich glaubte sogar, seine Schnauze zu sehen, die im Takt des Wahnsinns für Sekundenbruchteile vorschnellte, um mir zähnefletschend zu bedeuten, auf Abstand zu gehen. Rücksichtsvoller Pudel, braves Hündchen.
Meine Frau begann ihren Vortrag, den ich gekonnt ausblendete. In jahrelanger Übung war ich darin zum Meister gereift.
Nick war in seinem Zimmer verschwunden; die ständigen Vorhaltungen meiner Frau ödeten ihn wohl auch allmählich an. Ich schlich ihm hinterher, während mir meine Frau wie ein lästiges Anhängsel folgte. Das Keifen ihrer Stimme gehörte inzwischen genauso zu unserer Wohnung wie das stete Brummen unserer TV-Wall; ein Defekt, den wir noch nicht hatten reparieren lassen, da das nötige Kleingeld für das Trinkgeld des Technikers fehlte.
Nick kauerte auf seinem Bett, und gerade, als ich sein Zimmer betrat, sprang er mir mit einem Salto vorwärts entgegen. Nicht nur geistig war er ein talentiertes Kerlchen. Ich fand, dass er ganz nach seinem Vater kam. Und musste zugeben, dass ich eindeutig zu wenig aus meinen Möglichkeiten gemacht hatte.
Sein Zimmer allerdings war ein Ort, in dem man leicht den Überblick verlor. Hier riskierte man Hals- und Beinbruch. Vielleicht stand hinter dem Durcheinander ja irgendein geheimer Sinn, eine Ordnung, die sich mir nicht erschloss, aber oberflächlich betrachtet – und andere Betrachtungsweisen hatte ich nicht auf dem Kasten – war es das reinste Chaos. Instinktiv, wie immer, wenn ich dieses Zimmer betrat, das dem Genie vielleicht auch etwas zu klein geworden war, begann ich Gegenstände aufzuklauben, um sie sogleich in irgendwelchen Kisten verschwinden zu lassen.
„Nick, wie sieht es denn hier wieder aus!“ Ich war bemüht, meiner Stimme väterliche Strenge zu verleihen, sah aber, dass die Wirkung zu wünschen übrig ließ.
„Wie immer!“ sagte Nick frech, sprang aus dem Stand etwa 2 Meter in die Luft und drehte sich dreimal um die eigene Achse.
Mir blieb die Spucke weg. „Das ist ... äh ... das ist aber nicht gut!“
Mein Blick streifte die in seinen Regalen aufgereihten Pokale, die er bei Schachturnieren, Turnwettbewerben und Intelligenzmeisterschaften eingeheimst hatte. Einige Pokale fanden sich auch unter Bergen alter Wäsche, die hier und dort verteilt waren. Das Blinken und Blitzen der Trophäen erweckte jedes Mal die Sanftmut in mir. Ich konnte ihm einfach nicht böse sein.
„Was ist nicht gut?“ fragte Nick und mimte den Begriffsstutzigen. Diese Verkörperung eines geistig Zurückgebliebenen lag ihm ebenso wie der fünffache Flaubert-Jump-Slide (irgend so ein Modesprung; jedes Mal, wenn ich ihn sah, wurde mir schwindelig, und ich hätte Schwierigkeiten gehabt, sein Bewegungsmuster aufzuzeichnen; sein Erfinder, ein 17jähriger halbwüchsiger Franzose, meinte, er wirke „so vollendet wie ein Satz aus der Feder des großen Flaubert“). In einer meiner zahlreichen Zukunftsprojektionen verdiente Nick sein Geld in Hollywood; er konnte einem zweifellos alles vorgaukeln, und man musste ganz schön auf der Hut sein, um ihm nicht auf den Leim zu gehen.
„Du verstehst mich ganz gut“, hörte ich mich sagen. „Diese Unordnung! Aus dir soll doch mal was werden?“
„Ich hab gestern ´n Penner gesehen. Saß auf einer Bank im Park, trank aus einer Flasche und machte ´n ganz zufriedenes Gesicht. Dabei sehe ich viele Leute, aus denen was geworden ist, wie man so schön sagt, deren Mundwinkel hängen so tief, dass sie Maulwürfen den Weg versperren.“
„Was?“
„Einfach ausgedrückt, Dad: Ich sehe nicht ein, warum ich es zu etwas bringen soll, wenn ich am Ende doch nicht glücklich darüber werde.“
„Was?“
„Und außerdem: In einer Raketenfabrik kann ich doch jederzeit anheuern! Dafür muss ich doch nicht mein Zimmer aufräumen!“
Es gab so einige Züge an meinem Sohn, die mich an meine Frau erinnerten. Letztere trat nun zwischen mich und Nick. Ihr Gesicht war gerötet und aufgequollen, wie ein Pudding, den man nicht rechtzeitig vom Herd genommen hat. Ihre Augen, in denen ich in guten Stunden das Schimmern des Ozeans erkannte, waren geweitet, und jetzt meinte ich in ihnen das tiefe Schwarz des Weltalls wahrzunehmen. Tatsächlich hatte ich sie für einen Moment vergessen, sie links liegengelassen und mich abgewendet, wie man sich von einer nicht allzu spannenden Fernsehtransmission abwendet, und jetzt erhielt ich die Quittung dafür.
„Sag mal, hörst du mir eigentlich zu?“ fragte sie und bekam wieder dieses hektische Zucken um den linken Mundwinkel. Das war mein Alarmsignal. Es hieß: Obacht, alter Knabe! Treib es nicht zu weit!
„Ich höre dich gut“, sagte ich.
„Ach ja? Dann wiederhol doch mal, was ich gesagt habe!“
Ich konnte Wort für Wort wiedergeben. Stolz war ich nicht darauf. Es stellte ebenso wenig eine Meisterleistung dar wie das Bauen von Raketen. Ich machte es jeden Tag. Ebenso hatte ich lange Zeit täglich den Schimpftiraden meiner Frau zugehört, hatte sogar – damals, als wir noch auf Dinosauriern ritten – Verteidigungsreden geschwungen. Irgendwann, kurz nachdem dem letzten Dinosaurier die Puste ausgegangen war, hatte ich aufgegeben und meine Ohren in den Modus Durchzug geschaltet. Was zwar nicht verhinderte, dass mein Bewusstsein mit Tentakeln nach den Worten schnappte, aber meinen Ohren mit Sicherheit eine längere Lebenszeit gewährte.
„Und was sagst du dazu?“
Das Kreischen meiner Frau war geeignet, jeden Raketenstart an Lautstärke zu übertreffen. Über die Nachbarn machte ich mir schon lange keine Gedanken mehr. Die wussten längst Bescheid. Die hingen wie Spinnen an den Wänden und verfolgten unser eheliches Glück, als handelte es sich dabei um Szenen einer täglich ausgestrahlten Soap Opera. Es war das Stück Unterhaltung, das ihren Alltag versüßte und auf das sie gebannt warteten. Ich hätte mich wahrscheinlich genauso verhalten, wenn sich in meiner Nachbarwohnung ein derartiges Spektakel abgespielt hätte. Es ist tröstlich zu sehen (in diesem Fall: zu hören), dass sich andere in einer noch misslicheren Lage befinden. Mir geht es doch gar nicht so schlecht, war der erbauliche Gedanke meiner Nachbarn. Meine Ehe läuft doch eigentlich ganz gut.
„Du hast Recht, in allen Punkten. Ich bekenne mich schuldig! Vielleicht beginnt morgen endlich mein neues Leben, als besserer Mensch. Deine Stufe werde ich nie erreichen, du bist so perfekt und leuchtend wie ein Funken Strom. Heute Nacht spendiere ich dir ´ne Massage, wie wär’s?“
„Ach!“ Meine Frau machte eine wegwerfende Handbewegung. „Bleib mir bloß vom Leib mit deinen abgearbeiteten schmutzigen Händen! Da nehme ich doch lieber den Stimulator3000!“
Sie ging ab. Im Theater hätte sie zweifellos Szenenapplaus bekommen. Hier erntete sie nur Schweigen. Selbst Nick blieb kurzzeitig in der Luft hängen, nachdem er sich wieder in ihre Höhe begeben hatte. Als müsse die Zeit verschnaufen, ehe sie weiterlief.
Ich machte mir nichts daraus. Mit dem Stimulator3000 würde ich es selbst nach einem mehrteiligem Kurs Wie bringe ich meine Frau zum Orgasmus ohne dass einer von uns beiden schlappmacht? nicht aufnehmen können. Schließlich handelte es sich bei dem verdammten Mistkerl um eine Maschine. Und Maschinen sind den Menschen stets überlegen. Diese Erkenntnis sollte ich schon bald am eigenen Leib erfahren.
Es klingelte an der Tür. Meine Frau hatte sich mit einer Kiloschachtel First Aid – ein klumpiges Zeug, das so aussah wie unfertige Schokolade und schmeckte wie eine Mischung aus Pudding und Joghurt – ins Ehebett zurückgezogen, seufzte und stöhnte. Sie stieß Verwünschungen aus, in denen mir die Hauptrolle zugedacht war. Auch das kannte ich.
Ich öffnete die Tür. Frau Sebastol brachte Felicitas, meine Prinzessin. Die Kleine war offensichtlich müde, schritt an mir vorbei und verschwand in den Tiefen unserer Wohnung ohne mich eines Blickes zu würdigen. Felicitas war mit ihren sieben Jahren in einem schwierigen Alter. (Wenn ich mir die Damenwelt so anschaue, kommt mir der Verdacht, dass die sich ständig in einem schwierigen Alter befinden.)
Frau Sebastol war ein liebreizender Anblick, schön wie immer, zurechtgemacht, als entsteige sie der Fernsehwerbung. Sie war groß und schlank, größer und schlanker als meine Frau. Ihre Augen leuchteten so blau wie ein wolkenloser Sommerhimmel. Wenn sie den Mund aufmachte, schienen ihre Worte auf einer Duftwolke zu entschweben. Ich fand sie gut, aber so gut ich sie auch fand, schien sie mir stets etwas Unwirkliches an sich zu haben, was bei mir jedes Mal den Drang auslöste, sie zu berühren, um festzustellen, ob es sich bei ihr nicht um eine Erscheinung meiner Fantasie handelte.
„Sie war sehr artig“, sagte Frau Sebastol, „ist ein süßes Ding, Ihre Tochter!“
„Ja.“ Ich setzte mein unwiderstehliches Lächeln auf, das mir, wie ich am Blick von Frau Sebastol erkannte, gut gelang. In ihren Augen schwappte etwas über. War es schon Begierde oder einfach nur Sympathie? Es reizte mich, das herauszufinden.
„Sie ist unsere Prinzessin“, hörte ich mich sagen und wusste für einen Augenblick nicht, ob ich über meine Tochter oder über Frau Sebastol sprach.
Unsere Nachbarin, die tatsächlich etwas von einer Prinzessin an sich hatte mit ihrem langen glänzendem Haar, den großen Augen und dem unschuldigen Kussmund, klimperte tonlos mit den Augenlidern.
Es überkam mich. Der Engel in mir war vom Teufel auf den Spieß genommen worden, und es überkam mich.
Ich beugte mich leicht vor und fasste das lange schwarze Haar der Frau aus Nr. 9, dem Haus gegenüber, an. Es war so weich und glatt wie Seide. Sie war echt. So wie sie dastand und mit mir flirtete. Zumindest nahm ich an, dass es sich um einen Flirt handelte. „Das ist gut gelungen. Ich meine Ihr Haar. Welches Shampoo benutzen Sie?“
In diesem Moment schaltete sich meine Frau ein, die Spielverderberin. Sie kam von hinten angerauscht wie ein blutrünstiger Flatballspieler, der einem die Beine weggrätscht.
„Warum so zaghaft, Casanova?“ fragte sie. „Warum erkundigst du dich nicht gleich nach der Farbe ihres Slips?“
Ich war, wer kann es mir verdenken, sprachlos.
An Frau Sebastol gewandt, sagte meine Frau: „Vielen Dank, dass Sie uns unsere Tochter ohne Verletzungen zurück gebracht haben. Das ist ja heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Diese Gefahren überall! Man sollte sich im Bett verkriechen! Und genau das tu ich jetzt auch! Und Sie besser auch! Ohne meinen Mann!“
Frau Sebastol machte den Mund auf, und ich war mir sicher, dass sie etwas sehr Kluges sagen würde, doch noch bevor ihre schönen, wollüstigen Lippen ein Wort formen konnten, stieß meine Frau die Tür vor ihrer Nase zu. Zu meiner Sprachlosigkeit gesellte sich noch mehr Sprachlosigkeit.
Meine Frau packte mich, so fest, dass die fraglichen Stellen noch am nächsten Tag einen pulsierenden Schmerz aussenden würden, und küsste mich auf den Mund. Jetzt, wo mir wieder etwas zu sagen einfiel, konnte ich nicht sprechen. Die Zunge meiner Frau schnellte schlangengleich in meinen Mund und trieb dort ihr Unwesen. Ich ließ es geschehen. Es war kein schlechter Kuss. Er fühlte sich an, als ob mir frisches Leben eingeimpft würde.
So war sie, meine Frau. Und so war ich.
Wie ich mit dem Rücken zur Wand dastand und es geschehen ließ, alles.
Während meine Frau die letzten Reste aus der Kiloschachtel First Aid herauslöffelte, brachte ich die Kinder ins Bett. Dies lief nach einem ewig gleichen Ritual ab. Zuerst zogen sie sich die passende Kleidung für rasante Träume an; sogar Ben, der 4jährige Knirps mit den Einsteinbüscheln, bekam das bereits ganz alleine hin. Dann wurde das Gesicht gewaschen. Um meine Kinder dazu zu bewegen, hatte ich ihnen bereits vor langer Zeit vom Sandmann erzählt, der nur gut gepflegten Gesichtern Sand in die Augen streut, der für schöne Träume sorge und die Alpträume auf Abstand halte. (So konnte ich, wenn eines meiner Kinder einmal schlecht geträumt hatte, mit überlegener Geste ausführen, dass das Gesicht wohl nicht sauber genug gewesen sei.) Inzwischen glaubte nur noch Ben an die Geschichte vom Sandmann, Felicitas hatte Zweifel, und Nick, der mir ohnehin in vielerlei Hinsicht überlegen zu sein schien, lachte darüber.
Dann wurden die Zähne geputzt, wobei nur Ben Hilfestellung benötigte, schließlich musste jeder Zahn getroffen werden, und so zielsicher waren seine Bewegungen noch nicht.
Und schließlich ging es ab ins Bett. Die Jungen hatten ein gemeinsames Zimmer, während Felicitas ein Prinzessinnenreich ihr eigen nennen durfte. Zunächst erhielt Ben seine Gutenachtgeschichte, dann Nick und zu guter Letzt Felicitas. Wenn meine Frau in Form war, kümmerte sie sich um Felicitas, während ich meine kleinen Racker abfertigte. Das war an diesem Abend entschieden nicht der Fall; meine Frau war so sehr außer Form wie ein reaktivierter Flatballspieler, der den Ball nicht kommen sieht.
Das bedeutete für mich eine umso längere und Kräfte raubende Prozedur, aber – ich sagte es bereits – wenn ich mich zwischen der TV-Wall und den Kinder hätte entscheiden müssen, so hätte die TV-Wall das Nachsehen gehabt.
Meine Jungen ließen sich wie üblich abfertigen, ich las ihnen Abenteuergeschichten vor, die ihre Fantasie anregten und ihnen Lust auf Schlaf und wilde Träume machten. Ich wünschte ihnen eine gute Nacht, löschte das Licht und kaum hatte ich zweimal durchgeatmet, befand ich mich bereits im kunterbunten Prinzessinnenreich meiner Tochter.
Gasluftballons schwebten unter der Zimmerdecke, Andenken vergangener Geburtstage, die Schriftzüge trugen wie: Für unser Engelchen, jetzt bist du schon Drei – Du darfst Dreiradfahren! oder: Unserem Mäuschen, zu ihrem Jubeltag!
Felicitas bestand darauf, dass ich die Ballons regelmäßig beim Luftballonhändler um die Ecke mit Gas befüllen ließ, damit sie auch nicht schlappmachten und als kläglicher Rest eines schönen Tages im Staub landeten.
Die Wände waren voll von Bildern des Lieblings aller Mädchen, Sandy Spacelight. Was sie genau darstellte, hatte ich nie verstanden. Sie sah aus wie eine Kreuzung aus einem Kätzchen und einem Äffchen, trug ein Weltraumkostüm und eine rosa Schleife auf dem Astronautenhelm. Auf den Abbildungen kämpfte sie mit seltsamen Weltraumviechern oder lag zwischen Blumen und Bienen und meditierte. Jedes Kind braucht jemanden zum Aufschauen, und Sandy Spacelight war die Heldin eines ganzen Universums von Mädchenseelen.
Felicitas war, wie die meisten Mädchen ihrer Generation, Mitglied im Sandy-Spacelight-Starclub. In meinen Augen war das eine unselige Geldmacherei: Felicitas erhielt eine Monatszeitschrift und gelegentlich eine Einladung zu einem Special Event, und mir gingen jeden Monatsanfang 10 Universaltaler flöten, die „außerordentlich günstige Clubgebühr“. Aber meine Tochter ließ sich die Clubmitgliedschaft nicht ausreden. Ich hatte bereits mehrfach erfolglos den Versuch unternommen. Es kam einem Wunder gleich, dass ich aus diesen Unterredungen unversehrt hervorging. Ich hätte meine Tochter ebenso bitten können, vom Balkon zu springen.
In der Puppenecke lagen und saßen rund zwei Dutzend künstlicher Schönheiten und warteten darauf, dass man ihnen die Nägel lackierte, ihre Frisuren pflegte oder einfach ein paar Worte an sie richtete.
Genauso wartete meine Kleine in ihrem Bett auf ihre Geschichte. In Schönheitsfragen übertraf sie ihre künstlichen Gefährten bei weitem, wenn man mich fragte. Ihr längliches, immer ein wenig zu blasses Gesicht war auf dem besten Weg, eines herzzerreißenden Tages die Konturen und Ebenmäßigkeit eines Modellgesichtes anzunehmen. Die blauen Augen, das blonde Haar, die fein modellierte Nase taten ihr Übriges, um mich jedes Mal dahinschmelzen zu lassen, wenn sie aus diesen übergroßen Augen zu mir aufschaute und darauf wartete, dass ich ihren Wunsch erfüllte. In ihren bizarren Forderungen erinnerte sie mich oft an meine Frau. In allem übrigen kam sie eher nach mir.
„Was lese ich dir denn heute vor?“ fragte ich und wandte mich schon in Richtung des Bücherregals, wo die gesammelten Abenteuer von Sandy Spacelight darauf warteten, in Felicitas’ Kopf einzufahren.
„Nichts!“
„Was soll das heißen: nichts?“
„Nichts heißt nichts!“ gab mir meine Tochter mit der unwiderstehlichen Logik des kleinen Mädchens zu verstehen.
„Na gut, dann decke ich dich richtig zu, streichele dir einmal durch dein Haar, wünsche dir eine gute Nacht und ...“
„Sandy ist blöd!“ rief meine Tochter, und ich fuhr zusammen. Wir können schimpfen, wir können mahnen, aber wenn auf einmal das Objekt unserer Missgunst eigenhändig vom Kind zerschlagen wird, ist es, als nehme man uns die Luft zum Atmen.
„Also, das sind jetzt deine Worte, ich hätte das vielleicht anders ausgedrückt“, sagte ich, als ich die Fassung so einigermaßen wiedererlangt hatte. Mein wandernder Blick blieb an einem Gegenstand hängen, der mir zuvor entgangen war: Es war die Kuscheltier-Version von Sandy Spacelight, und sie war von ihrem angestammten Platz, dem Bett, verbannt worden und lag nun, Gesicht nach unten, auf dem Boden.
„Genau das sind deine Worte“, gab meine Tochter zu bedenken, und ich wunderte mich wieder über ihre Art, die manchmal so schneidend kalt war wie ein Polarwind.
„Ja, ok, vielleicht habe ich das mal so gesagt, aber gemeint habe ich doch eigentlich, dass Sandy, bei aller Liebe, die man für so ein, so ein ... Wesen aufbringen kann und vielleicht auch sollte, dass sie manchmal schon ein bisschen nerven kann, aber nur ein bisschen ...“
„Sie ist so überflüssig wie Krebs im Endstadium!“
„Äh ... was?“
„Hast du gesagt! Zu Mum!“
„Ähm ... ja, manchmal sagt man Sachen, die man erstens nicht so meint und an die man sich zweitens im Nachhinein gar nicht mehr erinnern kann ...“
„Du hattest Recht damit!“
„Was?“
„Sandy ist doch nur eine Erfindung, um uns Mädchen davon abzuhalten, einen wirklich klugen Gedanken zu fassen und hinter die Dinge zu schauen ...“
„Hast du das von Nick? Ich meine, er hat Recht, Feli ...“
„Nein, darauf bin ich ganz alleine gekommen! Und hör auf, mich Feli zu nennen, bin doch kein Püppchen, deren Namen man auf den kleinsten Nenner bringt, nein, ich bin ein Mädchen, und zwar eines mit Herz und Hirn!“
„Feli ...“
„Hast mich Felicitas genannt oder zumindest zugelassen, dass ich so genannt werde und willst jetzt die Unannehmlichkeiten dieses Namens – nämlich seine Vielsilbigkeit – nicht in den Mund nehmen!“
Ich war baff. Ich sagte nichts. Ich benötigte erst einmal ein halbes Leben oder zumindest ein paar Jahre, um wieder zu mir zu kommen. Aber diese Zeit wurde mir nicht gegeben.
„Kannst mir lieber mal von deinem Tag in der Fabrik erzählen, anstatt mir diese süßlichen, einlullenden Kleinmädchengeschichten zu verabreichen! Wie eine Medizin!“
„Feli ...“
„Ich heiße Felicitas. Fe-li-ci-tas! Ist das so schwer zu verstehen?“
„ ... hast du Drogen genommen?“
„Nur weil ich die Wahrheit erkenne, soll ich jetzt Drogen genommen haben? Ha!“
Felicitas verschränkte die Arme über der Brust und wandte sich gegen die Zimmerwand. In dieser Geste hatte sie erschreckende Ähnlichkeit mit meiner Frau. Und ich nahm unwillkürlich die Rolle ein, die ich auch bei meiner Frau spielte, wenn sie an der Zimmerwand plötzlich mehr Gefallen fand als an mir.
„Das meine ich doch gar nicht, ich bitte dich, du verhältst dich nur so ... so anders ...“
„Darum sind wir Menschen. Weil wir uns verändern.“
„Ja. Also gut. Ich erzähle dir von meinem Tag.“
„In der Fabrik!“
„In der Fabrik.“
Felicitas wandte sich wieder mir zu, mit betörendem Augenaufschlag. Verdammt, dachte ich, wer hat ihr eigentlich beigebracht, so zu sein, so durch und durch weiblich, durchtrieben; sind die Gene Schuld, meine Frau, habe ich versagt oder ist am Ende Sandy Spacelight zur Verantwortung zu ziehen?
„Also, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich einsteigen soll, es ist auch ziemlich langweilig ...“
„Erzähl einfach, was du tust. Und warum du es tust.“
Unbehaglich rutschte ich auf meinem Stuhl nach vorne. Der Blitz der Erkenntnis, der selbst dem Dümmsten ins Mark fährt, durchzuckte mich: Die Wahrheit ist ein schwer verdauliches Ding. Sollte ich ihr 1:1 berichten, maßstabsgerecht, ohne Aufbauschungen, Übertreibungen oder sollte ich hier und dort an den Ecken schmirgeln und schleifen, mir selber Politur verpassend, um ein bisschen strahlender aus der Angelegenheit hervorzugehen? Selbst wenn ich es gewollt hätte, die Wahrheit kam mir nicht über die Lippen, und ich wollte sie meiner Kleinen auch nicht zumuten. Ich ertrug sie ja selber nur mit einer gehörigen Dosis Tagträumerei. So entschied ich mich für die geglättete Version meines Arbeitstages.
„Also, du weißt, dass ich Raketen baue, das hört sich jetzt langweiliger an als es ist ...“
„Eben sagtest du noch: Es ist langweilig!“
Die war ganz schön auf Draht, die Kleine, ich musste aufpassen, dass ich mich nicht verzettelte.
„Nun gut, wenn man eine Sache täglich macht, dann ist sie am Ende für einen ziemlich gewöhnlich, während derjenige, der nur davon hört, die Hände zusammenschlägt und ein pfeifendes Geräusch verursacht, vom Staunen angefacht ...“
„Klingt plausibel.“
„Wenn ich jetzt jeden Tag einen Drachen töten würde, hätte das für mich auch nichts Besonderes mehr ...“
„Aber das tust du nicht. Du baust Raketen. Erzähl mir davon!“
„Ja, natürlich. Ich komme also in die Fabrik, und dort liegen dann die Baupläne für den Tag. Gemäß der Zeichnungen fertige ich die Raketen, und das ist keine einfache Sache, und sehr oft kommt es dazu, dass ich erkenne, nein, das passt so nicht und dann gehe ich in das Büro des Chefdesigners und spreche ein ernstes Wort mit ihm. Und wenn er schließlich seinen Fehler einsieht, manchmal erst nach endlosen Diskussionen, und wenn ich schließlich seine Entschuldigung akzeptiert habe, nimmt der Designer die Änderungen vor, die ich ihm vorgebe, und am Ende ist das Design, man kann es kaum bestreiten, mehr von mir als von ihm geprägt, aber ich gebe nichts darum, auf eine Nennung meines Namens verzichte ich, der Schatten soll mich schlucken, das Rampenlicht ist nicht mein Ding.“
Felicitas seufzte, nickte zufrieden und schloss die Augen. „Das machst du gut, Daddy“, flüsterte sie und schwebte auf einer Wolke Richtung Schlaf.
„Ich schufte schwer. Ich komme ins Schwitzen, ich schraube und ich hämmere, und im Ganzen ist das eine sehr körperliche Geschichte, die schmalen Gestalten mit den Zahnstocherarmen können zu Hause bleiben, sollen die doch Kuchen backen oder Romane schreiben, aber das Metier des Raketenbaus ist sicher nichts für sie, das verlangt nämlich einen kräftigen, robusten Körper.“
Entschwebend Richtung erstem Traum, seufzte Felicitas: „Ja, du bist stark, ganz stark ...“
„Mir macht keiner was vor! Und hätte ich meinen Verstand nicht, könnte ich vielleicht ´ne Rakete zeichnen, mehr aber auch nicht! Denn ohne Verstand wäre ich so aufgeschmissen wie Sandy Spacelight ohne rosa Schleife auf ihrem Astronautenhelm. Tja, und so verdient dein Dad sein Geld ...“
„Ja, so verdienst du dein Geld ...“ Die Worte waren der letzte Rest ihres Bewusstseins, der Traum hatte schon begonnen.
Ich schlich aus dem Zimmer, löschte das Licht.
Das Ergebnis zählt, nicht der Weg dahin. Meine Tochter schlief, Mission erfolgreich erfüllt.
Noch Fragen?
Nachts im Bett brachte meine Frau den Flirt mit Frau Sebastol zur Sprache. Wir hatten das Licht gelöscht, und ich war schon fast so weit, in meinem ersten Traum die Heldenrolle einzunehmen, da funkte sie dazwischen. Ich hatte gehofft, dieses Mal ohne eine ihrer Predigten davonzukommen, aber schließlich war das Leben ein steter Weg den Hang hinauf, es gab keine Gemütlichkeit. Warum sollte mir dann meine Frau das Leben erleichtern?
„Manchmal frage ich mich“, sagte sie und fuhr große Geschütze auf, „warum du mir das antust. Ich meine, was siehst du eigentlich in mir? Oft glaube ich, du siehst nichts anderes als die Institution in mir, die Ehe an sich, und die ist ja gerade mal so sexy wie verwelkte Blumen auf einem Grabstein, so viel ist sicher.“
„Sternenstaub ...“ Das Wort kam mir über die Lippen, ehe es meine Gedanken gekreuzt hatte, und ich war selber überrascht.
„Sternenstaub? Es muss um 2039 gewesen sein, dass du mich das letzte Mal so genannt hast ...“
„Im Sandkasten?“ fragte ich und ging munter auf ihre Übertreibung ein. 2039 war ich gerade mal 3 Jahre alt gewesen, und Agatha hatte ihr erstes Lebensjahr hinter sich gebracht. „Also, soweit ich mich erinnere, lief ich damals einem Mädchen namens Jennifer Sonderplass hinterher, die Nachricht deiner Existenz war noch nicht bis zu mir vorgedrungen ...“
„Ja, du warst damals schon ein Schürzenjäger, diese Jennifer war sicher eine von vielen, ein Mädchen genügte nicht, das ist das Sammelbildchensyndrom, hat man erst einmal einen Flatballspieler ins Album geklebt, will man alle haben, so sind die Jungs, sie sammeln Flatballspieler, sie sammeln Mädchen, und wenn die Jungs zu Männern werden, ändert sich das nicht ...“
Ich schwieg. Das schien mir die beste Methode, einem Donnerwetter zu entkommen und vielleicht rechtzeitig in den Schlaf flüchten zu können. Und, wie so oft, zauberte meine Frau eine Überraschung aus dem Ärmel und wurde auf einmal sanftmütig: „Dein Atem verrät mir zumindest, dass es dir zu Herzen geht, da ist so ein Rhythmus darin, so eine Aufregung, ich merke, dass ich dich noch erreiche, und das ist immerhin, wie sagt man? Eine Basis? Das ist eine Basis. Du liebst mich noch, oder?“
Ich schätze, diese Frage stellen Frauen immer dann, wenn man keine Antwort darauf parat hat. Das Schweigen, jedes Drucksen und Zögern, können sie dann gegen einen auslegen, was ihnen eine Übermacht und letztendlich den Sieg verschafft. Aber ich hatte diese Frage zu oft gehört, zu oft mechanisch reagiert, als dass ich mich jetzt von ihr in die Flucht hätte schlagen lassen.
„Ja, natürlich!“
Ich hörte, wie meine Frau lächelte. Sie machte das geräuschvoll, seufzte friedvoll dabei. Dann fragte sie: „Was hat es denn mit dieser Einladung auf sich? Du kommst mir doch sonst nicht mit so einem gesellschaftlichen Kram!“
„Schadet uns vielleicht nicht, dann kommen wir mal wieder raus und unter Leute. Chory oder Mr. Lonesome ist eigentlich ´n Spinner, glaube ich. Könnte aber lustig werden, gerade deswegen ...“
“Du bist auch ein Spinner“, seufzte Agatha und griff nach meinem Dick, so unvermittelt und so fest, dass mir der Atem stockte. Sie schob die Vorhaut zurück und bewegte ihn auf und ab, im Rhythmus eines Alten am Krückstock.
„Schneller!“ flüsterte ich.
Jetzt saß der Alte immerhin im Rollstuhl.
„Schneller!“
Endlich hatte er Platz in der Kommandozentrale einer Rakete genommen, die in Lichtgeschwindigkeit durch das All düste.
Ich sah Agathas Schattenriss an der Decke über mir und schloss die Augen, um anderen Bildern die Möglichkeit zu geben, in mein Bewusstsein zu dringen. Verflossene Liebschaften, nie angefasste und umso mehr in den Olymp meiner männlichen Tagträume gehobene Weibsbilder zogen vor meinem geistigen Auge dahin, ihre schweißglänzenden Körper tanzten ein Ballett, ihre Brüste und Hintern schaukelten in einem Rhythmus, der mich gen Abgrund trieb ...
Agatha bewegte sich geschmeidig wie eine Katze und begann tatsächlich zu schnurren. Sie fuhr die Zunge aus, leckte über meinen Bauchnabel, über meine Brustwarzen und saugte an ihnen ...
Bei aller Liebe, bei aller Anstrengung, die ein Mann unternehmen kann, um die stählerne Beschaffenheit seines Wesens unter Beweis zu stellen, bei aller Mühe und dem Schweißregen, der sich aus den Poren meiner Frau über mich ergoss, meine Männlichkeit lag brach.
Ich machte mir nichts daraus. Schließlich geschah das nicht zum ersten Mal. Und schließlich hatte ich noch meine Träume.
Ich steckte einen Finger in das glitschige Geschlecht meiner Frau und tat meine Pflicht.
Nicht einmal fünf Minuten später war ich eingeschlafen und ging durch die Wüste. Mit festem Schritt und einem Plan.