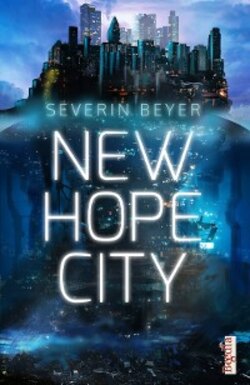Читать книгу New Hope City - Severin Beyer - Страница 5
Böses Erwachen – eine Stadt sucht einen Mörder
ОглавлениеThe shitstorms are coming!
Graffiti, Künstler unbekannt
*
The shitstorms are coming! Die Warnung starrte Steiner von der Wand des versifften Aufzugs an, der ihn und sein Motorrad aus dem Wabenblock beförderte. Sie kam wieder einmal zu spät, denn ein Shitstorm der ganz besonderen Art wütete bereits in seinem Schädel. Er wusste nicht mehr, was er gestern Abend alles in sich hineingeschüttet hatte, aber den Schmerzen nach zu urteilen, mussten es sich Madame Ming und er ziemlich dreckig gegeben haben.
Wenigstens hatte er schon einen Kaffee intus – mitsamt dem obligatorischen Tablettenmix aus Aspirin, einer Antialkpille und seiner täglichen Anti-Aging-Dosis. Sich zu duschen war leider nicht drin gewesen, Madame Ming brauchte ihre tägliche Wasserration für sich selbst. Ein gewaschenes Gesicht und Deo unter den Achseln mussten gegen den Alkoholgestank vorerst ausreichen. Die einzige, die sich daran stören würde, wäre ohnehin Irina. Aber er war es gewohnt, mit ihren feindseligen Blicken zu leben. Die sollte sich nicht so aufführen, schließlich machte er den Job schon eine halbe Ewigkeit. Auch ihr Idealismus würde mit der Zeit verschleißen. Ein Gedanke, den Steiner als äußerst tröstend empfand.
Auf der Fahrt durch die belebten Straßen New Hopes, in denen er sich hauptsächlich gegen militante Radfahrer durchsetzen musste, machte er einen kurzen Halt an einem Bäckereiautomaten. Er wählte aus den vielen der vegetarisch belegten und in Diätmajo ertränkten Brötchen eines aus, um es während der Fahrt hinunterzuwürgen. Das entsprach zwar nicht den Verkehrsregeln, aber wer hielt sich schon daran? Außer Fußgängern und Passagieren der Metropolbahn waren die meisten Verkehrsteilnehmer schließlich Radfahrer. Und das waren die selbstgerechtesten Verkehrsfaschisten überhaupt, wenn es nach Steiner ging. Die fuhren ja mit dem Rad und taten damit der Natur und ihrer Gesundheit etwas Gutes. Da durften sie schon erwarten, dass die Welt ihnen applaudierte, wenn sie Fußgänger zur Seite drängten oder die Metropolbahn blockierten, weil sie dringend noch über die Schienen mussten. Damit musste man doch Einsehen haben.
Zusätzlich waren diese Lahmärsche seinem Motorrad im Weg. Nachdem der Kommissar wieder einmal von einem dieser Idioten geschnitten wurde, der ohne Handzeichen und Schulterblick in Steiners Fahrbahn eingebrochen war, stellte er seine Sirene an und drängte den Flachwichser zurück in seine Spur. Rücksichtlos heizte er an den eingeschüchterten Radfahrern vorbei, bis er endlich das Polizeihauptrevier der Undercity erreichte. Das Sirenengeheul war zwar Gift für seinen Schädel, aber der wummernde Schmerz, den es auslöste, war allemal besser, als sich dieses Verkehrshickhack weiterhin bieten zu lassen.
Irina Dvorac war eine Frau von beinahe zwei Metern Größe und kräftigem Körperbau, so der Typ Terminator. Ihr Gesicht war im Gegensatz dazu das Sinnbild von vollendeter weiblicher Schönheit. Ihre Reaktion auf sein nur mühsam kaschiertes Saufgelage des Vorabends war so vorhersehbar wie vernichtend:
»Süleyman, wenn du dich schon mit deinem kriminellen chinesischen Flittchen volllaufen lässt, dann sei wenigstens keine Pussy und komm am nächsten Tag pünktlich zur Arbeit. Und zieh keine solch mitleidserregende Fresse, das ist echt ekelerregend!«
»Eigentlich ist sie Franko-Kanadierin«, brummte Steiner in sich hinein »Ihr asiatisches Aussehen kommt von ihrem Großvater mütterlicherseits. Der kam aus Myanmar, als das Land noch so hieß …« Zumindest hatte sie ihm das erzählt. Was an den Geschichten dieser Frau stimmte und was nicht, konnte er nie so genau sagen. Die Wahrheit war ihm aber auch schlicht egal.
»Dann ist sie eben ein franko-kanadisches Flittchen mit burmesischen Wurzeln, tut das irgendwas zur Sache?«, fauchte sie gereizt.
Oh je, heute war sie aber so etwas von scheiße drauf. Irina hatte zu seinem Leidweisen ein sehr ausgeprägtes Temperament. Steiner fragte sich, ob das daher kam, dass sie aus einem der zahlreichen semiautonomen und autokratischen Staaten des Wahren Pakts für Europa (WPE) stammte, die alle in der Einflusssphäre des Russischen Imperiums lagen.
An seinem Schreibtisch angekommen, ließ er sich in seinen ergonomisch geschwungenen Sitz fallen. Während er sich mit seinem Smartpod ins Polizeinetz einloggte, fragte er seine Kollegin:
»Hat sich seit gestern irgendetwas Neues im Mordfall am Erasmus ergeben?«
Irina, mit der er sich ein Abteil des Großraumbüros teilte, das von über 20 Kommissaren und Kommissarinnen benutzt wurde, saß ihm gegenüber. Sie minimierte den Holodesktop auf ihrem Schreibtisch mit einer herabwischenden Handbewegung, um ihn besser zu sehen.
»Wir haben keine neuen Spuren am Tatort entdeckt, falls es das ist, was du meinst. Allerdings bin ich auf Unstimmigkeiten gestoßen, als ich mit unseren biometrischen Suchprogrammen die Kameraaufzeichnungen des Erasmus-von-Rotterdam-Platzes überprüft habe: Unser Verdächtiger ist auf keiner der Aufnahmen zu sehen. Auch sonst habe ich in unseren Datenbanken so gut wie nichts über ihn gefunden.« Sie sah ihrem Kollegen verschwörerisch in die Augen.
»Ist denn der gesamte Platz komplett mit Kameras abgedeckt?«, meinte Steiner abgelenkt, der seinerseits seinen Bildschirm zwischen ihnen erscheinen ließ und ihn soweit vergrößerte, sodass er Irina verdeckte. Mit gespielt konzentriertem Blick rief er die neuesten Informationen der Mordkommission AlbinoBlue auf.
»Nein, aber der Zugang zu den Toiletten ist bis auf wenige minutenlange Unterbrechungen dauernd abgedeckt. Entweder hat unser Zeuge dort mindestens zweieinhalb Stunden verbracht oder ich kann mir nicht erklären, wie er unbemerkt dort hineingekommen ist.«
»Häh?«, Steiner war plötzlich ganz Ohr.
»Ich sagte …«,
»Ja, ich habe dich gehört … Aber wie ist das möglich?«
»Das sollten wir unseren Zeugen vielleicht selber fragen. Oder besser gesagt: Du. Ich habe hier nämlich noch zu tun und du hast ihn schließlich schon einmal vernommen. Wenn auch ziemlich dilettantisch.«
›Besorg’s dir doch selber‹, fluchte er gedanklich und minimierte seinen Bildschirm. Sein Smartpod unterbrach die Verbindung zum Polizeinetzwerk. Steiner legte seinen mobilen Rechner wieder auf sein Armgelenk, wo sich dieser an der Haut des Kommissars festsaugte. Der Halt war so bombenfest wie bequem. Warum konnte nicht alles im Leben so einfach und durchdacht wie dieses Stück Technik sein? Steiner stand seufzend auf.
Die »Mumienmorde«, so hatten die Medien die Reihe mysteriöser Todesfälle getauft, die die Stadt seit Monaten in Atem hielten. Weil die Opfer keinen Tropfen Flüssigkeit mehr enthielten und so ausgetrocknet waren wie Mumien aus der Zeit der Pharaonen. Nachdem es nun schon über vierzig dokumentierte Fälle gab und die Ermittlungen nach wie vor nicht vom Fleck gekommen waren, war eine EF-Taskforce gebildet worden. Sie bestand aus führenden Kriminalexperten aller Verwaltungsbezirke der Europäischen Föderation sowie aus Beamten der Polizei von New Hope. Zum Chefermittler der Taskforce war Georgios Venizelos ernannt worden, eine wahre Polizeilegende. Er hatte innerhalb von Kriminalistenkreisen erstmals größere Bekanntheit erlangt, als er im EF-Distrikt Ost-Mediterranien eine Mordserie an den Managern eines chinesisch-europäischen Konsortiums aufgeklärt hatte, die alle von ihren heimischen Servicerobotern umgebracht worden waren. Als Täter stellte sich eine Gruppe von vollkommen verarmten Firmentechnikern heraus, die von ihrem Unternehmen um ihre Rentenansprüche gebracht worden waren.
Steiner gehörte zu seinem Leidwesen ebenfalls dieser Taskforce an. Das hatte er seiner Juniorpartnerin Irina zu verdanken. Mit viel Engagement (und dem fast schon ans Verbrecherische angrenzenden Einfordern von Gefallen) hatte sie ihr Ermittlerduo in die Mordkommission AlbinoBlue geboxt. Diese Frau konnte Berge bewegen, da war sich der Kommissar ganz sicher. Denn bei Steiners Ruf grenzte Irinas Erfolg schon fast an ein Wunder. Sie machte ihm manchmal etwas Angst. Irina wollte unbedingt Karriere machen – aber nicht um der Karriere willen, sondern weil sie wirklich etwas verändern wollte. Jetzt ermittelte er mit ihr zusammen im Fall der Mumienmorde. Leider.
Die Dunkelziffer der Todesfälle lag wahrscheinlich deutlich über den bisher bekannten Opferzahlen. Denn aus irgendeinem noch unbekannten Grund zerfielen die ausgetrockneten Leichen nach wenigen Minuten zu Staub. Sicherlich war anfangs nicht jeder auffällige Staubhaufen mit dem Verschwinden eines Menschen in Verbindung gebracht worden.
Steiners Kollegen gingen davon aus, dass ein Zusammenhang mit dieser neuen Droge namens AlbinoBlue bestand, die alle Opfer konsumiert hatten. Seit Monaten überschwemmte die Substanz die Straßen New Hopes. Steiner hatte einmal gewagt zu fragen, ob die Tode nicht einfach eine Folge der Droge selbst sein könnten, zum Beispiel als ungewöhnliches Ergebnis einer Überdosis. Seine Hoffnungen, dass dies keine Angelegenheit einer Mordkommission, sondern eine Sache des Drogendezernats sein könnte, zerschlugen sich jedoch schnell, als ihm Irina so effizient wie genervt die Fakten präsentierte:
Das AlbinoBlue war nicht tödlich, egal in welcher Dosierung. Das hatten alle Versuche an der neuesten Generation von Bio-Dummys gezeigt, die den menschlichen Organismus sogar in Echtzeit simulierten. Auch die Tests zu Wechselwirkungen mit anderen chemischen Elementen und Verbindungen hatten zu keinen nennenswerten Erkenntnissen geführt. Zwar bereitete die Formel des AlbinoBlues den Experten nach wie vor Kopfzerbrechen, da es sich dabei um ein völlig neuartiges und hochkomplexes Molekül handelte, dessen Struktur und Wirkungsweise selbst den hinzugezogenen Wissenschaftlern ein Rätsel war. Aber auch wenn die Experten der Polizei sich an AlbinoBlue die Zähne ausbissen, so sprach doch vieles für Mord. Denn bei allen Opfern hatten Forensiker vor dem Leichenzerfall eine kleine Einstichwunde an der Stirn entdeckt. Allerdings gab es nach wie vor keine einzige Videoaufnahme der vermuteten Morde, die von Argus‘ flächendeckender Überwachung aufgezeichnet worden wäre.
» … Es gibt also definitiv eine Verbindung zwischen den Toten und dem Blue. Wir wissen nur noch nicht, welche«, hatte Irina damals ihre Ausführungen beendet. Seitdem waren sie in ihren Nachforschungen keinen Schritt weiter gekommen. Selbst die Kollegen, die undercover im Drogenmilieu ermittelten, hatten nicht den Hauch einer Spur von den Hintermännern. Nur Websites, Spammails und Flyer, die das AlbinoBlue mal als bewusstseinserweiterndes Nonplusultra, mal als den heißesten Shit, den man unbedingt ausprobiert haben musste, anpriesen, fanden sie zuhauf.
In ihrer Ratlosigkeit hatte die New Hoper Polizei im Zusammenhang mit den Mumienmorden öffentlich vor dem Konsum von AlbinoBlue gewarnt. Die Medien stürzten sich begierig darauf: Der »Fluch des Pharao« war geboren. Die Droge, die dir den Trip deines Lebens verschafft – es sei denn du triffst den Pharao, der dich in eine Mumie verwandelt. Game over. Leider hatte die Polizeiwarnung für viele, die den Kick suchten, den Reiz erst erhöht. Seufzend stellte der Kommissar fest, dass er in einer Zeit der Ressourcenknappheit lebte: Da der Konsumgesellschaft die Güter ausgegangen waren, war das Sammeln von Erfahrungen als höchster Lebensinhalt geblieben. Synthetische Drogen florierten.
Steiner machte sich auf den Weg zu seinem Zeugen. Vielleicht war dieser Rivera ja tatsächlich der Pharao, der hinter all diesen Morden steckte. Steiner stieß ungewollt auf. Sein eigener vergammelter, nach Alkohol riechender Atem stieg ihm in die Nase,
›Memo an mich selbst: Ich muss mir unbedingt eine zweite Zahnbürste für Madame Ming oder die Arbeit zulegen. Mundwasser tut es vielleicht auch.‹
Beim Verlassen des Gebäudes machte Steiner an einem Snackautomaten halt. Eine Packung Kaugummi mit Minzgeschmack musste vorerst ausreichen.
*
Rivera lag nackt auf seinem Bett. Er starrte die Decke an. Aus dem Hintergrund hörte er den laustarken Protest des kanadischen Premierministers gegen die Annexion Kanadas durch die USA. Es war irgendeine Dokumentation auf History Facts – AllAlternativeChannel 5. Wenn dieser Junkie, den er sich eingefangen hatte, wenigstens die Lautstärke etwas drosseln würde … Er strich sich durch sein kurzes, schwarzes Haar und atmete mehrfach tief durch. Er atmete rein aus Gewohnheit, denn sein transhumaner Körper benötigte natürlich keinen Sauerstoff. Aber es wirkte entspannend, also tat er es trotzdem.
Eigentlich müsste er angewidert sein. Dennoch war er es nicht. Irgendwie ließen ihn die Ereignisse des gestrigen Abends erstaunlich kalt. Klar, er war mit einem Kerl in der Kiste gelandet, aber dieses sexuelle Experiment war letztendlich nichts weiter als eine neue Erfahrung gewesen, von der er noch nicht ganz wusste, wie er sie einordnen sollte. Das hatte ihn selbst etwas überrascht. Homophobe nahmen ihr Anliegen eindeutig zu wichtig.
Rational betrachtet war er, Rivera, ein Psychopath, darüber machte er sich keine Illusionen. Sein Gefühlsleben entsprach nicht dem des Durchschnitts. Er empfand nichts für seine Mitmenschen, genau genommen nahm er sie mehr als Dinge, denn als Lebewesen wahr. Die naheliegendste Erklärung für ihn war wohl die, dass er schon als Psychopath geboren worden war. Warum die Ärzte das damals trotz des amtlich vorgeschriebenen postnatalen Gehirnscanns nicht erkannt hatten, würde wohl für immer ein Rätsel bleiben. Vielleicht gab es tatsächlich keine neurologischen Ursachen, vielleicht hatte ihn irgendetwas so werden lassen. Irgendein furchtbares Erlebnis, an das er sich nicht mehr erinnerte. Dabei waren seine Eltern stets liebevoll zu ihm gewesen. Auch hatte er nie ein Trauma erlebt, zumindest keines, das seine jetzigen Neigungen rechtfertigen würde.
Warum auch immer er war, wie er war, er war ein begnadeter Serienkiller. Aber nicht irgendein gewöhnlicher Serienkiller, oh nein. Rivera verschränkte die Arme hinter seinem Kopf und grinste ein zufriedenes, selbstsicheres Haifischgrinsen. Im Gegensatz zum gemeinen Serienmörder, der ein spezielles Opferprofil bevorzugte, war Rivera geradezu universell: Für ihn war die gesamte Menschheit Beute. Selbst bei der Todesart ließ er sich nicht festlegen, das wäre eine absolut unnötige Einschränkung seiner Kreativität gewesen. So hatte er allen Spaß der Welt, während die Polizei unmöglich in der Lage war, seine einzelnen Morde miteinander in Beziehung zu setzen.
Wenn er so darüber nachdachte, dann war die Erklärung für seinen gestrigen Ausrutscher eigentlich recht einfach: Psychopathen liebten Macht. Er war ein Psychopath. Ergo liebte er Macht. Nach seiner Ohnmacht gegenüber diesem Kafkaliebhaber hatte er sich seine Macht zurückerobert, indem er ihn gefickt hatte. Dieser pseudopsychologische Ansatz überzeugte Rivera. Natürlich entsprach diese Denkweise einem überkommenen Männlichkeitsbild, wie er aus dem Sozialkundeunterricht wusste. Damals, als ihn sein Lehrer in der Schule über den Unterschied zwischen den Kategorien Gender und Sex aufgeklärt hatte. Rivera hatte das nie ernst genommen.
›Bin ich wirklich so einfach gestrickt?‹ Sein Grinsen wich einem nachdenklichen Blick. Er sah zu dem jungen Mann hinüber, der seinen nackten ausgemergelten Körper in eine Decke gehüllt hatte und auf dem Boden saß, von wo aus er den Wandbildschirm anstarrte.
›Vor allem, was mache jetzt mit ihm?‹ Rivera hatte nicht das Gefühl, dass ihn jetzt noch irgendetwas davon abhielt, diesen Typen zu killen. Da sein synthetischer Körper keine DNA-Spuren hinterließ und er die Kameras vor seiner Wohnung manipuliert hatte, würden wie immer keine Rückschlüsse auf ihn möglich sein. Doch sollte er ihn wirklich hier töten?
Einen Mord in einer auf ihn registrierten Wabe hatte Rivera noch nie begangen. Privates und Vergnügen hatte er bisher immer getrennt gehalten. Es gab also noch keinen Präzedenzfall, an dem er sich orientieren konnte. Er drehte sich zur Seite und ging die ganze Angelegenheit sachlich in Gedanken durch.
Die Sauerei könnte er auf die Küche oder das Bad beschränken, da wäre es einfach sauberzumachen. Der Abtransport der Leiche wäre da schon eher das Problem. Wenn er mit einem großen Sack auf dem Rücken durch New Hope laufen würde, wäre das wahrscheinlich ein wenig zu auffällig. In seiner Not müsste er den Junkie womöglich zerkleinern und ihn über mehrere Tage hinweg in der Stadt verteilen. Das Zerkleinern würde er wohl am besten in der Duschkabine erledigen, die Körperteile dann in Ökoplastik abpacken und vorerst im Tiefkühlfach seines Kühlschrankes lagern. Doch das Fach war kaum groß genug, um den gesamten Junkie aufzunehmen.
Rivera erhob sich, begab sich in die Küchenecke seiner Wohnwabe und öffnete seinen Kühlschrank. Er warf noch einmal einen Blick auf Rien. Nein, das Tiefkühlfach reichte definitiv nicht aus. Den Rest müsste er wohl im Kühlschrank lagern und schnellstmöglich paketweise entsorgen, wenn er verhindern wollte, in seiner Wohnung am Leichengestank zu ersticken. Wobei er die Geruchssensoren seines Körpers nach unten regulieren könnte, das Problem wäre nicht sein eigenes Befinden. Die Gefahr läge vielmehr in der Entdeckung durch die Nachbarn, denen der bestialische Gestank vermodernden Fleisches auffallen würde. Was für ein Stress! Warum musste das nur so kompliziert sein, dabei wollte er doch nur dieses bedeutungslose Mitglied der Gesellschaft loswerden, um den sich wirklich niemand scherte … Ach, hätte er es doch in dem Augenblick getan, in dem er ihm begegnet war, dann hätte er nun kein Entsorgungsproblem. Aber da Rien nun einmal hier war …
Forschend öffnete Rivera die Schublade mit dem Besteck. Die Messer durchtrennten problemlos Fleisch, kämen aber ganz sicher nicht durch die Knochen. Nun, die konnte er mit seinen modifizierten Händen durchbrechen. Recyclingsäcke? Hatte er zum Glück erst vor kurzem wieder vom städtischen Service Center geholt. Zielstrebig steuerte er auf sein Opfer zu.
» …wodurch Großbritannien auf den Stand einer amerikanischen Kolonie herabsank. Doch die Annexion sollte nicht von Dauer sein: Die Einführung des flächendeckenden Waffenrechts für alle führte zu heftigen Widerständen seitens der britischen Bevölkerung und löste eine Welle antiamerikanischer Proteste aus, die in mehreren Anschlägen gipfelten, die den britischen Unabhängigkeitskrieg auslösten …«
Rivera ignorierte die Dokumentation. Mit einem unbarmherzigen Griff packte er Rien an den Haaren und zerrte ihn ins Bad, wo er dessen Kopf an der Kante des Duschkabinenrandes zertrümmerte. Riens Körper erschlaffte schon beim zweiten Aufprall. Es war für Rivera ein leichtes, den Körper in die Kabine zu hieven. Ganz offensichtlich war der junge Mann nur kurz bewusstlos gewesen, denn als Rivera begann, ihn in Scheiben zu schneiden, versuchte er sich zu wehren. Mit einem Schlag brach er ihm den Unterkiefer, um das einsetzende Geschrei zu unterdrücken. Entsetzen starrte Rivera aus dem zermanschten Gesicht entgegen. Oh ja, das tat so gut. Belebender als jeder Orgasmus.
Gerade kugelte er Riens Arm aus, als ihn ein Klingeln an seiner Haustür aus seinen Tagträumen riss.
Sofort schaltete Rivera in seinem Kopf auf die Kamera, die über seiner Wabentüre angebracht war. Es war dieser Bulle, der ihn gestern verhört hatte. Mist, den konnte er nicht warten lassen. Gereizt blickte Rivera zu Rien, der immer noch seelenruhig und unversehrt auf den wandfüllenden Holobildschirm starrte.
»Versteck dich und bleib ruhig!«, schnauzte er ihn an »Lass ja das Licht aus, ich will nicht, dass man den Abzug hört!« fuhr er Rien an, als er ihn ins Bad zerrte und die Tür hinter ihm zuschlug. Der Polizist sollte ihn ganz sicher nicht mit der Person zusammen sehen, deren Teile entsetzte Passanten in den nächsten Wochen aus Recyclingeimern in ganz New Hope fischen würden.
Ein weiteres Klingeln trieb Rivera zur Eile an. Hastig versuchte er Ordnung in seine Wabe zu bringen, denn von der Tür aus war beinahe die gesamte in schlichtem Bauhausstil gehaltene Wohnung zu überblicken. Nichts sollte auf Rien hindeuten. Schnell warf er ihre vom Vorabend herumliegenden Klamotten unter das Bett, ehe er sich aus seinem Wandschrank eine schwarze Boxershorts und ein weißes T-Shirt angelte, die er beide sofort überzog. Es klingelte schon zum dritten Mal. Er hätte gerne im Spiegel überprüft, ob er genauso leger aussah, wie er sich das vorstellte, aber da der Spiegel im Bad hing, verließ er sich auf seine natürliche Ausstrahlung, versprühte noch Deo gegen den Männergeruch, und warf die Dose hektisch zu den Klamotten unter dem Bett. Kurz bevor er die Tür öffnete, streifte er sich noch eine Jeans über.
»Oh, Sie sind es, Herr Kommissar«, spielte er den Überraschten, als er die Türe öffnete »Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Womit kann ich Ihnen weiterhelfen? Hat sich der Verdacht gegen mich erhärtet, oder besuchen Sie mich nur zum Vergnügen?«
Rivera merkte dem Kommissar an, wie sehr diesen seine aufgesetzte Freundlichkeit abstieß. Das amüsierte ihn und tröstete ihn immerhin für den Moment darüber hinweg, die geplante Zerstückelung noch ein wenig aufzuschieben.
»Darf ich eintreten?«
»Wenn Sie so direkt fragen, dann möchte ich Ihnen genauso direkt antworten: Nein.« Er wollte wirklich nicht, dass der Bulle seine Wabe betrat. So wie er diesen Rien einschätzte, würde es nicht lange dauern, bis der sich auf die eine oder andere Weise bemerkbar machte. Wahrscheinlich rutschte der Junkie im Bad aus, schlug sich als Folge dessen vollkommen von allein den Kopf auf und er, Rivera, wäre schon wieder der Verdächtige in einem Todesfall, den er nicht verschuldet hatte.
»Sie wissen, dass es sich dabei um eine rhetorische Frage handelt. Durch die Antiterrorgesetzgebung ist es der Polizei auch ohne Durchsuchungsbefehl erlaubt, fremde Wohnungen zu betreten«, entgegnete ihm der Beamte im Trenchcoat trocken. Sein künstliches, tief dunkelgrünes Auge funkelte Rivera bösartig an.
»Aber das können Sie nur, sofern Terrorverdacht besteht.«
»Es liegt vollkommen in meinem Ermessenspielraum, ob ich einen terroristischen Hintergrund vermute, unabhängig davon, ob sich dieser Verdacht im Nachhinein als gerechtfertigt herausstellt. Wenn Sie mir in diesem Fall Widerstand leisten, dann kann ich sie ohne weiteres festnehmen.
Also, darf ich reinkommen oder muss ich Sie erst als Terrorist verdächtigen?«
Gut gespielt. Unter anderen Umständen würde der Kommissar so etwas wohl nicht machen, aber jetzt kam die Retourkutsche für gestern.
»Es ist mir unangenehm, Sie sehen ja an meinem Casual Look, dass ich nicht auf Besuch vorbereitet bin. Meine Wohnung ist daher nicht gerade das, was man ordentlich nennen würde.«
»Damit habe ich kein Problem.«
»Dann treten sie ein«, entgegnete ihm Rivera mit einem scheinbar überlegenen Lächeln, von dem er wusste, dass es diesen Steiner ärgern musste »Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oder Tee?« Er bekam keine Antwort.
»Ich hatte mir Ihre Wohnung größer vorgestellt. Auch die Wohngegend überrascht mich. Was arbeiten Sie denn?«, meinte der Polizist, als er die Wabe betreten hatte und die Türe hinter sich schloss. Rivera fragte sich, warum ihn der Beamte das fragte. Hatte der Kommissar ihn denn nicht überprüft? Was für ein lausiger Polizist …
»Sie meinen, weil mein Körper sehr kostspielig gewesen sein muss? Mit nahezu unbezahlbarer Nanotechnologie und allen Extras im High-End-Bereich ausgestattet? Ich bin Privatier und lebe von dem Vermögen, das mir meine Eltern hinterlassen haben. Hier wohne ich übrigens nur während der Frühlings- und Sommermonate«, der letzte Satz klang blasiert, sollte auch so klingen und war blanker Unsinn.
»Sie leben hier alleine?«
Rivera wollte gerade verneinen, doch dann hielt er inne: Um ein Haar hätte ihn der Polizist erwischt. Wahrscheinlich konnte der Kommissar mit seinem Augenimplantat durch Wände sehen. Sein Zögern überspielte Rivera dadurch, dass er in der Küche die Kaffeemaschine neu befüllte und aktivierte. Möglicherweise hatte der Polizeibeamte beobachtet, wie er seinen Gast ins Bad gezerrt hatte. Glück gehabt! Hätte der Kommissar nur zehn Sekunden später geklingelt – es wäre wirklich schwierig geworden, eine mit dem Gesetz im Einklang stehende Erklärung dafür zu finden, warum er gerade Riens Schädel zertrümmert hatte.
»Die Wohnung ist auf mich angemeldet, aber es kann passieren, dass ich hin und wieder Gäste im Haus habe.«
»Haben Sie momentan Gäste?«
»Sie meinen welche, die ich einem unerwarteten Besuch vorstellen möchte?«
Seinen Gesprächspartner hatte Rivera damit überrumpelt. Er beschloss, dem Kommissar den Wind aus den Segeln zu nehmen:
»Ich bin bi«, log er »Aber ich will nicht, dass das bekannt wird. Meine Kontakte zu Männern behandele ich lieber diskret. Da bin ich etwas konservativ. Jetzt kennen Sie auch den tatsächlichen Grund, warum ich sie nicht in meiner Wohnung haben wollte«, fügte er mit einem guten Schuss Pathos hinzu.
Es war offensichtlich, dass der Kommissar unzufrieden mit seiner Antwort war, da er wohl gehofft hatte, ihn in diesem Punkt ins Schwitzen zu bringen oder ihn zumindest in einen Widerspruch zu verwickeln.
»Kann ich Ihren Besuch sehen?«, meinte Steiner mürrisch.
Das war keine rhetorische Frage, das war Rivera klar.
»Wollen Sie auch einen Kaffee?«, versuchte er vom Thema abzulenken, während er sich selbst eine Tasse einschenkte. Genießerisch roch er daran, ehe er einen Schluck daraus nahm. Bei Riveras hervorragenden Aussehen und seinem schauspielerischen Talent hätte er es mit den besten Werbemodels aufgenommen.
»Ich bin nicht hier, um mit Ihnen Kaffee zu trinken. Das Gespräch wird ab dem jetzigen Zeitpunkt übrigens aufgezeichnet«, entgegnete der Kommissar. Ohne weitere Erklärung legte er seinen Smartpod auf den Küchentisch:
»›Beweisaufnahme: Start.‹
Herr Ben Rivera, meine Kollegen und ich sind die Aufzeichnungen der Überwachungskameras am Erasmus-von-Rotterdam-Platz durchgegangen und haben dabei festgestellt, dass Sie in keiner einzigen Einstellung zu sehen sind.«
»Und?«
»Nach unserem bisherigen Wissensstand hätten Sie sich mindestens zweieinhalb Stunden in der Toilette aufhalten müssen, ohne von einer einzigen Kamera auf dem Platz gesehen zu werden. Ziemlich viel Zeit, wenn man bedenkt, dass Sie es ohnehin nicht nötig haben, eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Dealen Sie mit Drogen?«
Rivera grinste sein höflichstes Raubtiergrinsen, während er zuckersüß entgegnete:
»Nein, das habe ich nicht nötig. Überprüfen Sie ruhig meine Finanzen, falls Sie mir nicht glauben. Gerne auch mit Verdacht auf terroristischen Hintergrund, sofern Ihnen das den Zugriff auf meine Konten erleichtert. Ansonsten können Sie mich und meine Wohnung jederzeit durchsuchen, Drogen werden Sie keine finden.
Aber um zu Ihrem anderen Punkt zu kommen, dass ich mich zweieinhalb Stunden in der öffentlichen Toilette aufgehalten haben soll … Das kann schlicht nicht sein. Befragen Sie ruhig die anderen Personen, die in diesem Zeitraum dieselbe Örtlichkeit aufgesucht haben. Dank Ihrer Kameras dürfte es nicht schwierig werden, die dafür in Betracht kommenden Zeugen zu identifizieren. Mit meinem weißen Anzug hätten sie mich nur schwer übersehen. Falls Sie und Ihre Kollegen es nicht von sich aus tun sollten, dann werden es meine Anwälte in die Wege leiten, keine Sorge. Ich weiß, dass ich mich damit entlaste.
Aber haben Sie vielleicht einmal in Betracht gezogen, dass Sie die Aufzeichnungen von Argus vielleicht nicht sorgfältig genug durchgegangen sind?«
Er hatte beim Kommissar einen Nerv getroffen. Natürlich wusste Rivera nicht, dass sich Steiner fragte, ob Irina nicht doch ein Fehler unterlaufen sein könnte, der ihn nun in eine peinliche Situation brachte. Doch Rivera, der große Manipulator, erkannte am kurzen Zögern des Kommissars die Schwäche seines Gegners. Nachdem er Steiner schon am laufenden Band vorgeführt hatte, war dies die Chance, eine Verbrüderung vorzutäuschen.
»Sie wollen wirklich keinen Kaffee? Dieser Kaffee ist echt, kein fades, mit Geschmacksstoffen vollgestopftes Ersatzprodukt, so wie Sie es sonst überall erhalten. Kommen Sie, nehmen Sie auch einen«, und er befüllte eine zweite Tasse, die er liebenswürdig dem Polizisten reichte »Der wird Sie wieder auf Trab bringen. Sie sehen schon so müde aus, seitdem ich Sie an der Türe gesehen habe. Ich akzeptiere kein Nein als Antwort.«
Der Kommissar nahm den Kaffee tatsächlich an und trank einen Schluck.
»Wenn ich Sie richtig verstehe …«, begann der Beamte nach kurzem Zögern » … Sie zweifeln die Zuverlässigkeit der Videoaufzeichnungen an?«
»Oh, wie sage ich Ihnen das jetzt, ohne Sie zu verletzen? Ich zweifle nicht die Aufzeichnungen an – auch wenn sie natürlich manipuliert sein könnten. Ich zweifle eher die Sorgfältigkeit an, mit der Sie die Aufzeichnungen überprüft haben.«
»Meine Kollegin arbeitet sehr zuverlässig«, blaffte der Polizist zurück »Und das Polizeinetz ist absolut sicher. Wir haben eine erstklassige Firewall.«
»Alles ist hackbar.« Da war sie wieder, Riveras Arroganz. Herablassend wie ein Fallbeil enthaupteten seine Worte die positive Stimmung, die er zwischen sich und seinem Verhörer aufgebaut hatte »Wer nicht will, dass sensible Daten gestohlen oder manipuliert werden, darf sein System nicht ans Netz hängen. Das ist die einzige halbwegs sichere Lösung.«
Wenige Sekundenbruchteile später bereute Rivera seine Worte bereits. Den Polizisten auf die Fährte zu lotsen, dass die Aufnahmen manipuliert sein könnten, war genau das, was er tunlichst vermeiden sollte. Gönnerisch versuchte er von seinem Fauxpas abzulenken:
»Vielleicht überprüfen Sie einfach noch einmal eingehend Ihre Aufnahmen. Falls dann weiterhin Unstimmigkeiten bestehen sollten, dann komme ich auch gerne auf Ihr Revier und beantworte Ihnen alle Fragen dort. Das erspart Ihnen den Weg hierher und mir die Notwendigkeit, in einer derart unvorzeigbaren Aufmachung befragt zu werden.«
Steiner antwortete ihm nicht sogleich. Stattdessen schüttete er seinen Kaffee in einem Zug hinunter. Suchend sah er sich nach einer geeigneten Stelle um, um seine Tasse abzustellen. Rivera nahm sie ihm ab und stellte sie auf den Spültisch.
»Wahrscheinlich wäre das das Beste«, murmelte Steiner. Dann sagte er etwas lauter: »›Beweisaufnahme: Ende.‹« Er nahm seinen Smartpod wieder auf und heftete ihn an sein Armgelenk.
»Bevor ich gehe, erfasse ich die Daten Ihrer Begleitperson.«
»Ist das wirklich nötig? Er ist wirklich nur eine flüchtige Bekanntschaft«, versuchte Rivera den Kommissar davon abzubringen. Dieser Kill wäre der alleinige Höhepunkt seines Tages, den durfte er sich nicht nehmen lassen! Doch Steiner beachtete ihn nicht weiter. Mittlerweile war er zur verschlossenen Badtüre gegangen, an die er bestimmt klopfte:
»Kommen Sie aus dem Bad. Hier ist die Polizei.«
Nach wenigen Augenblicken vollkommener Regungslosigkeit hörten Rivera und Steiner ein Klicken. Die Türe öffnete sich. Hervor trat Rien, immer noch lediglich mit einer Decke bekleidet.
»Ich bin Kommissar Steiner. Im Rahmen meiner Ermittlertätigkeit werde ich Ihre Daten aufnehmen.«
»Hi, ich bin Rien«, meinte Rien müde.
»Und Ihr Nachname?«
»Also, der ist ziemlich schwierig zu buchstabieren …«
»Können Sie sich ausweisen?«, seufzte der Beamte.
»Ne, meinen Personalausweis habe ich verloren. Oh, aber ich habe einen Studierendenausweis, geht das auch?«
»Zeigen Sie her.«
Rien ging in den Wohnbereich. Desorientiert blieb er in dessen Mitte stehen. Nachdem er dort eine halbe Minute tatenlos herumgestanden war, fragte ihn der Beamte:
»Was für Drogen haben Sie genommen?«
»Drogen? Ich? Puh, ich nehme doch keine … Oh, Sie können mit Ihrem Auge … hm, in meinen Körper sehen und so? Schon verstanden. Können wir darauf nachher zurückkommen? Momentan suche ich meine Hose, da ist nämlich auch mein Ausweis.«
»Hat er die Drogen von Ihnen?«, meinte der Polizist mit einem Seitenblick zu Rivera.
»Ich bin kein Kindermädchen. Was meine Sexualbekanntschaften in ihrer Freizeit machen, geht mich nichts an. Ehrlich.
Die Hose ist unter dem Bett!«
»Haben Sie keine Angst, sich da Krankheiten zu holen?«, fragte Steiner beiläufig, während sie beide Riens tollpatschigen Versuchen zusahen, seine Hose unter dem Bett hervorzuziehen.
»Wie sie bereits wissen, besteht mein Körper zu 100% aus TransTech. Viren, Bakterien, Pilze – ich bin gegen so ziemlich jede Geißel der Menschheit immun. Und sollte es irgendetwas geben, das meine Materialien tatsächlich befallen sollte, dann kümmert sich meine speziell programmierte Immunabwehr aus Nanorobotern darum.«
»Nur so aus Interesse, was hat Ihr Körper gekostet?«
Statt einer Antwort nahm Rivera einen weiteren Schluck Kaffee aus seiner Tasse. Rien hatte inzwischen seine Hose unter dem Bett hervorgekramt. Umständlich kramte er aus einer Hosentasche einen zerfledderten Geldbeutel heraus.
Die Dokumentation auf Channel 5 war inzwischen bei dem Zerfall der USA angekommen; eine animierte Landkarte veranschaulichte die Chronologie der Ereignisse: die Aufspaltung in Republikanische und Demokratische Staaten von Amerika, die Unabhängigkeitserklärung Kaliforniens gefolgt vom britischen Unabhängigkeitskrieg, das chinesische Protektorat über Hawaii, die Wiederherstellung der Grenzen Mexikos von 1823 (mit Ausnahme von Kalifornien), zuletzt die Gründung der Französischen Republik Quebec.
Die Geschichte Amerikas seit der Jahrtausendwende war eine sehr bewegte.
Hätte einer der drei Protagonisten in diesem Augenblick auf die Dokumentation geachtet, so hätte ihn die Darstellung der Landkarten und die Menge des gesprochenen Texts zutiefst irritiert. So viel Sachlichkeit war ungewöhnlich für eine Dokumentation ihrer Zeit. Wo waren die nachgestellten fiktiven Spielszenen, wo die eingeschobenen Meinungen der Celebrities? Stattdessen erzählten die Fakten, Zahlen und Karten nüchtern vom Leben all der Individuen, die diese stürmischen Zeiten miterlebt hatten. Die Lebenszeit von Millionen zusammengefasst in den Sekunden weniger Sätze. Wie vergänglich und überschaubar menschliches Handeln und Streben doch war. Doch während diese epochemachenden Ereignisse nüchtern an ihnen vorbeizogen, löste eine andere Entwicklung große Emotionen aus:
»Hier ist er!«, triumphierte Rien in demselben Moment, in dem ihm die Decke herunterrutschte. Nackt und scheinbar ungeniert hielt er dem Polizisten seinen Studierendenausweis unter die Nase. Steiner nahm den Ausweis entgegen und musterte ihn skeptisch. Rien zog währenddessen seine Hose an.
»Dieser Ausweis ist nicht mehr aktuell. Sind Sie noch Student der Adenauer-de Gaulle-Universität New Hope City?«
»Nein.«
»Was machen Sie momentan beruflich?«
»Nichts.«
»Und wo wohnen Sie?«
»Meine letzte Wohnung musste ich vor zwei Tagen verlassen. Heute Nacht habe ich hier geschlafen.«
Steiner hielt einen Augenblick für einen tiefen und deutlich hörbaren Atemzug inne, ehe er fortfuhr:
»Wie kann man Sie erreichen? Haben Sie wenigstens einen Smartpod?«
»Ja, aber ich kann mir meine aktuelle Virtuelle Identifikationsnummer nicht merken. Warten Sie, sie ist in meinem Pod gespeichert. Ich kann nachschauen. Er müsste hier eigentlich irgendwo herumliegen …«
»Er liegt auch unter dem Bett«, meinte Steiner stoisch, der das Gerät schon längst entdeckt hatte. Genauso stoisch ließ er sich von Rien die Buchstaben- und Zahlenkombination diktieren, überprüfte sie und verabschiedete sich schließlich genauso wortkarg wie er gekommen war. Er ging und hinterließ eine große Angepisstheit, von der er nicht ansatzweise etwas ahnte.
Rien war an den Kühlschrank gegangen. Wahrscheinlich um nach etwas Essbarem zu suchen. Rivera kam es wie eine Verhöhnung durch die Schicksalsgöttin Fortuna vor, dass sich ausgerechnet die Person an seinem Kühlschrank zu schaffen machte, die er vor nicht einmal einer Viertelstunde darin hatte lagern wollen. War auf den ersten Blick alles gut gelaufen – er war den Polizisten losgeworden, hatte sich bei keinem Mord erwischen lassen, außerdem würde die Zeugenüberprüfung die Polizei ablenken und sie vielleicht sogar von seiner, in diesem Fall tatsächlichen Unschuld überzeugen – so lernte Rivera nun eine vollkommen neue Lektion: Auch Unsichtbarkeit hinterließ Spuren. Denn er war nicht nur auf keiner der Aufnahmen vom Erasmus zu sehen, sondern auch auf keiner der Aufnahmen von so ziemlich jeder Kamera des städtischen Videoüberwachungssystems!
Er war praktisch ein Geist. Dafür hatte er gesorgt, als er sich vor Jahren in das Polizeinetz gehackt hatte, um dort verdeckt seine Manipulationssoftware einzuspielen. Zwar überprüfte er regelmäßig, ob sein kleines Programm inzwischen entdeckt worden war, aber bisher vollkommen ohne Notwendigkeit. Die besten Hacker arbeiteten in der Wirtschaft, nicht für die Polizei. Aber nun wandte sich sein Genie gegen ihn. Angepisst setzte sich Rivera auf sein Bett.
»Wow! Ist das echtes Fleisch?«, hörte er Rien in ungläubiger Begeisterung ausrufen. Offensichtlich hatte er das Steak entdeckt. Riveras synthetische biologische Komponenten benötigten so gut wie keine Nahrung. Doch die seltenen Male, die er Nährstoffe zu sich nehmen musste, bevorzugte er etwas, das einst gelebt und gefühlt hatte. Das befriedigte ihn auf eine zutiefst dekadente Art und Weise. Natürlich war es echtes Fleisch, dachte der Penner denn, dass er irgendeinen synthetisch erzeugten Mist in sich hineinstopfte? Rivera vertrieb jeglichen Gedanken an Rien und fokussierte sich auf seine bevorstehende Aufgabe.
›Ich muss mich sofort in die Polizeidatenbank hacken und die Aufzeichnungen vom Erasmusplatz soweit manipulieren, dass ich darin auftauche. Das sollte ihre Zweifel zerstreuen und mir Zeit verschaffen. Und dann …‹ er stöhnte innerlich, als ihm die gesamte Tragweite seines Unterfangens bewusst wurde. Sollten die Ermittler wirklich mehr zu Riveras Person recherchieren, dann mussten die Videoaufzeichnungen sein öffentliches Leben nahezu lückenlos präsentieren.
Zu seinem Vorteil speicherte sein Quantenhirn sämtliche Erinnerungen. Unter Ausklammerung der Morde, die er begangen hatte, könnte er damit einen weitgehend realitätsnahen Verlauf seiner Aktivitäten in die Aufnahmen einbauen, sodass Rivera sich später nicht in unnötige Widersprüche verwickelte. Das war eine gewaltige Menge Arbeit, selbst mit den richtigen Programmen. Zwar hatte er die dafür notwendigen Apps, aber er musste schnell handeln. Für eine solche Datenmenge, die es unbemerkt und tadellos zu manipulieren galt, musste er sich mit seinem Bewusstsein vollkommen ins Netz einloggen. Das war keine Sache, die er einfach nebenher erledigen konnte, wenn er dies in der kurzen Zeit bewältigen wollte, die ihm noch blieb, bis der Kommissar wieder auf seinem Revier war, um die Videoaufnahmen zu checken.
»Hast du Hunger? Also ich hätte Hunger.« Rien stand neben ihm. In den Händen hielt er das in einer Recyclingverpackung eingeschweißte Stück Rindersteak.
»Verschwinde aus meiner Wohnung«, entgegnete ihm Rivera frostig.
»Ähm. Okay. Das kommt jetzt etwas überraschend«, sagte Rien sichtlich vor den Kopf gestoßen.
»Nimm das Steak und verschwinde sofort aus meiner Wabe.« Die Betonung lag auf ›sofort‹.
»Ist ja gut. Ich bin schon weg.« Verwirrt kramte Rien seine restliche Kleidung unter dem Bett hervor. Das Steak gab er dabei nicht mehr aus der Hand, schließlich war es eine absolute Delikatesse, unerschwinglich für jemanden wie ihn. Es wurde in der Europäischen Föderation nur noch in geringen Mengen produziert, da Nutztierhaltung viel zu viele Ressourcen erforderte. Nur so war die allgemeine Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten.
Halbnackt, seine Kleidung und seinen unverhofften Schatz an sich gepresst, verließ Rien die Wohnung. Sehnsüchtig blickte Rivera ihm hinterher. Da verließ sie ihn, die verbotene Frucht. Da Steiner sie beide zusammen gesehen hatte, würde er Rien wohl erst töten können, wenn Steiner selbst tot oder zumindest pensioniert war. Das würde bei seinem Alter wahrscheinlich beides nicht mehr lange dauern, aber ein paar Jahre müsste Rivera sich sicher noch gedulden. Jetzt benötigte er Ruhe und alle Zeit, die er bekommen konnte.
Rivera veränderte die Holoumgebung, indem er den Telesender gegen ein Ambiente austauschte. Nach kurzer Überlegung entschied er sich für Space. Obwohl er nichts davon mitbekommen würde, stellte er den 3D-Modus ein. Die 3D-Hologramm-Umgebung vermittelte ihm das Gefühl, bei absoluter Stille mit seinem Bett um den Jupitermond Ganymed zu kreisen.
Rivera legte sich hin. Ein Check seiner Körperwerte verlief zufriedenstellend. Er konnte problemlos zwei Wochen ohne externe Energiezufuhr aushalten, sein Nährstoffspeicher war sogar noch für einen ganzen Monat gefüllt. Das sollte mehr als ausreichen. Er brauchte sicherlich nur ein paar Stunden, auch wenn diese unglaublich anstrengend werden würden. Die Wohnungstemperatur war etwas zu heiß, aber da die Belüftungssysteme in der gesamten Stadt schon seit Jahren auf ihre Erneuerung warteten, war das normal für diese Jahreszeit. Nachdem er alles überprüft hatte, loggte er sein Bewusstsein ins Netz ein.
Einmal hatte Rivera einen alten Abenteuerfilm gesehen, der den digitalen Raum gezeigt hatte, so wie ihn sich die Menschen früher vorgestellt hatten, lange bevor sie in der Lage gewesen waren, ihr Bewusstsein mit dem Cyberspace zu verbinden. Ach, was waren sie naiv gewesen; so bunt, so voller Möglichkeiten … Aber so war das Netz nicht. Als Netwalker wusste Rivera es genau. Der Cyberspace war unsichtbar, er war mehr ein abstraktes Gefühl. Hätte Rivera eine Farbe wählen müssen, um ihn zu beschreiben, dann hätte er wohl Grau gewählt. Ein Grau, das auf der Quantenbasis von Überlagerungszuständen existierte, die er genauso wahrnahm wie die Metagebilde, die diesen Raum durchzogen: die Programme.
Nein, das Netz war kein bunter Ort ungeahnter Möglichkeiten, beeindruckender Welten oder großer Abenteuer. Im Netz erschufen Gedanken auch nicht innerhalb von Sekundenbruchteilen ganze Programme oder Welten, wie es sich die Science Fiction-Autoren der Vergangenheit erträumt hatten. Als Netwalker zu programmieren war sehr viel mühseliger, denn auch Gedanken brauchten ihre Zeit, um konkret zu werden. Das einzige, womit die Denker der Vergangenheit recht behalten hatten, war die Tödlichkeit des Cyberspaces. Eine unachtsame Firewall, schon verarbeitete ein Virus den eigenen Verstand zu Gemüse, im schlimmsten Fall für immer. Deswegen war es auch verboten, sein Bewusstsein ans Netz zu koppeln. Wie nicht anders zu erwarten, gab es nichtsdestoweniger eine ganze Szene von Netwalkern, meist Wannabe-Rebellen, die irgendetwas gegen die Gesellschaft im Allgemeinen und das Establishment im Besonderen hatten. Unbestätigten Gerüchten zufolge setzten auch zahlreiche Regierungen in der Cyberkriegsführung auf Netwalker. Doch das waren – wie gesagt – nur Gerüchte.
Rivera startete seine Analyseprogramme, um das Netz in seinem Bewusstsein zu strukturieren. In ein paar Stunden sollte er mit den Videoaufzeichnungen fertig sein. Dann wäre er vorerst vor der Polizei sicher. Vorerst. Denn Rivera wusste, dass er erst wieder in Ruhe seiner Jagd nachgehen konnte, wenn er für die Ermittler uninteressant würde. Überließ er dies tatsächlich dieser Pfeife Steiner und seinen unfähigen Kollegen, dann konnte das noch verdammt lange dauern. So lange wollte der Killer nicht warten.
Jemand musste die Mumienmorde aufklären, damit die Bürger New Hopes und vor allem Rivera selbst wieder ruhig schlafen konnten. Und dieser jemand war er. Darin war sich der Killer mit einem dezenten Schuss Größenwahn sicher. Das war irgendwie absurd.
Am Abend desselben Tages war Rivera tot.
*
Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Offenes Feuer war in den Unterebenen New Hopes verboten, doch in den verlassenen Bezirken störte es niemanden. Selbst wenn eine der seltenen Patrouillendrohnen die Rauchsäule aufspüren sollte, hätte Rien sein Rindersteak schon längst verdrückt, bis die Polizei bei ihm war. Er musste unbedingt etwas gegen das flaue Gefühl in seinem Magen unternehmen. Rien wusste nicht, ob es daher kam, dass er schon seit zwei Tagen nichts mehr gegessen hatte, oder daher, dass er allmählich dem Entzug gefährlich nahe kam.
Unglaublich, dass er sich mit einem Rindersteak vollstopfen würde. Es lag sicher Jahre zurück, dass er echtes Fleisch zwischen die Zähne bekommen hatte. Der Qualm der brennenden Ökoverpackungen, die er aus mehreren öffentlichen, vor Müll überquellenden Recyclingbehältern gefischt hatte, verpassten dem tierischen Überbleibsel zwar einen rauchigen Geschmack, ebenso fehlten Salz und Pfeffer, aber da er ansonsten vollkommen mittellos war, gab es keinen Grund zur Klage.
Dem seltsamen transhumanen Typen musste er echt penetrant auf die Nerven gegangen sein. Nur so konnte sich Rien das Stück Steak erklären. Wobei er nicht das Gefühl hatte, dass er seinen Rauswurf selbst verschuldet hätte. Nicht dieses Mal. Vielleicht hatte es etwas mit dem Kommissar zu tun gehabt?
Ein Rascheln schreckte Rien auf. Aber zwischen den Ruinen aus kaltem Beton entdeckte er nichts weiter als ein einsames Graffiti, das vollkommen allein und verloren auf den Weiten einer im Nichts endenden Wand gesprayt war. Es war sehr klein geschrieben. Rien stand auf und ging mehrere Schritte darauf zu, um es zu lesen:
Denn wir werden dann immer noch hier sein, wir, die Narben dieser Welt.
Remo
Rien erstarrte. Er kannte diesen Satz. Dies waren der letzten Worte seines Romanmanuskripts. Nur wie kamen sie an diese Wand? Er hatte seinen Roman nie veröffentlicht, nicht einer Seele davon erzählt. War er vielleicht früher schon einmal hier gewesen? Im Rausch, sodass er sich nicht mehr daran erinnerte, dass er es selbst an die Wand gesprayt hatte? Aber das war nicht seine Schrift.
Denn wir werden dann immer noch hier sein, wir, die Narben dieser Welt … Diese Worte stammten von Remo, dem sprechenden Tiger. Sie sollten das Wesen aufmuntern, zu dem der Priester Primus und der gefallene Seraph Lazaliel verschmolzen waren. Ein Wesen, das in den kommenden Jahrhunderten nach und nach vergessen wird, wer es einmal war, nur um sich dann allmählich wieder zu erinnern. Dann würde Remo endlich erfahren, warum Lazaliel wirklich die Götter stürzen wollte. Aber dieser Teil der Geschichte lag außerhalb des Romans.
Das plötzliche Auftauchen des Graffitis war für Rien wie das Hereintreten einer anderen Wirklichkeit. Als ob ihm der universale Code der Weltformel etwas mitteilen wollte. Lag es am Blue? Vor kurzem erst hatte er eine geringe Menge davon probiert, aber nichts davon gemerkt, wahrscheinlich, weil er es mit anderen Drogen zusammen eingeworfen hatte. Vielleicht war das die Quittung dafür.
Er schaute über die Mauer hinweg und ließ seinen Blick steil nach oben gleiten. Dort wären die Wasser des Atlantiks zu sehen gewesen, aber in diese Tiefe des Meeres drang kein Licht vor, es wurde vom Ozean sprichwörtlich verschluckt. Die doppelte Außenverkleidung New Hopes aus einem durchsichtigen Spezialpolymer, die den unter dem Meeresspiegel liegenden Teil der Metropole von dem sie umgebendem Wasser abschirmte, war eine schöne Idee gewesen. Doch nur auf der obersten Unterebene, der sogenannten Upper Class, entfalteten die durchsichtigen Doppelwände ihren Reiz, wo die Bewohner New Hopes von innen das Brechen der Wellen beobachten konnten. Hier unten in der Undercity hingegen war die Schwärze einfach nur bedrohlich. Rien erahnte die Macht der zurückgehaltenen Naturgewalten. So mussten sich die Israeliten gefühlt haben, als sie unter Moses‘ Führung das Rote Meer durchquerten. Würden die Außenverkleidungen jemals brechen, würde die todbringende Flut Millionen verschlucken. Natürlich gab es innerhalb der Stadt zahlreiche Schutzschleusen, aber wer wusste schon, ob die im Ernstfall erneut hielten?
Rien fröstelte. Kein Wunder, dass die Außenbezirke bei diesem Anblick gar nicht erst fertiggestellt worden waren. Täglich die Fragilität der eigenen Existenz vor Augen … Er drehte sich um.
Zuerst erfüllte ihn tiefe Ungläubigkeit. Dann stieß er einen wehleidigen Schrei zutiefst empfundener Ungerechtigkeit aus: Eine schwarze Katze machte sich über sein Steak her! Neeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn! Das war eine ganz andere Fragilität der Existenz, die ihm hier vor Augen geführt wurde! Entsetzt stürzte sich Rien auf das Tier, um es zu verscheuchen. Aber das Viech fauchte ihn derart bösartig an, dass der junge Mann erschrocken zurückzuckte.
Was auch immer sein Fleisch wegfraß, es war keine Katze. Wahrscheinlich waren es die Nachwirkungen der Black Light, aber je länger der junge Mann das Tier ansah, desto überzeugter war er davon, dass es längst ausgestorben war.
»Du bist ein Tasmanischer Teufel«, stellte Rien ernüchtert fest, da ihm beim besten Willen nicht einfiel, was er sonst machen sollte, als das Offensichtliche auszusprechen »Dich gibt es gar nicht mehr. Du dürftest gar nicht hier sein.« Aber die Realität schien es heute mit den Fakten nicht ganz so ernst zu nehmen. Erst das Graffiti und jetzt das.
Er versuchte sich der Kreatur zu nähern. Doch nachdem er ein weiteres Mal auf dieselbe bösartige Weise angefaucht wurde, ließ er es bleiben und schaute dem Teufel unglücklich dabei zu, wie er die Mahlzeit verspeiste, auf die er sich gerade noch gefreut hatte.
Das Tier war auf eine beunruhigende Art fremd, unwirklich, Rien konnte sich zuerst gar nicht erklären, warum. Er bemerkte, dass es kein Fell hatte, sondern auf eine merkwürdige Art metallisch wirkte. Nicht auf die Art metallisch, wie eine Maschine. Sondern als ob die Kreatur aus einem pulsierenden, biologischen, schon beinahe lebendigen Erz bestünde. Das war definitiv eine Drogennachwirkung, vielleicht auch schon eine Entzugserscheinung. Der Teufel war wahrscheinlich nicht halb so gefährlich wie er aussah, und außerdem handelte es sich dabei sicherlich nur um eine Katze. Es wurde für Rien schleunigst Zeit, das Viech wegzuscheuchen und die Reste seiner Mahlzeit zurückzuerobern. Wenn es so weitergehen würde, dann würde ihm vom Entzug bald übel werden. Bis dahin musste er das Steak verdaut haben, wenn er es nicht wieder auskotzen wollte.
Mit neuer Entschlossenheit griff er beherzt nach dem Tier und hob es auf, um es behutsam an eine andere Stelle zu setzen. Das hätte er besser gelassen. Die Katze/der Tasmanische Teufel/das was-auch-immer wandte sich so kräftig in seinen Armen, dass er es auf der Stelle fallenließ. Sofort sprang ihn die Kreatur an und krallte sich an seinem Pullover fest. Die unerwarteten kräftigen Kiefer bissen Rien schmerzhaft in die rechte Schulter. Er fiel zu Boden und versuchte das Tier mit beiden Armen von sich loszureißen. Aber die Zähne der Kreatur gruben sich nur noch tiefer in sein Fleisch! Der Schmerz trieb ihm Tränen in die Augen. In ihm keimte der schreckliche Verdacht auf, dass er mit einer Ausgeburt der Hölle zu tun hatte. War das der Bote, der ihm den Tod bringen würde?
Als ob sie seine Gedanken gelesen und Mitleid mit ihm bekommen hätte, ließ ihn die Kreatur los. Verängstigt und sich die blutende Schulter haltend, robbte Rien unbeholfen von dem schwarzen Wesen weg. Obwohl es wahrscheinlich nicht das war, was er im Augenblick vor sich sah, so war das ganz sicher keine normale Katze.
Vielleicht handelte es sich um irgendein grässlich missglücktes Bioexperiment, das aus einem strenggeheimen Militärlabor entkommen war. Er stellte sich das Labor bildlich vor, vollgestopft mit Reagenzgläsern voller Chemikalien, die in den unterschiedlichsten Farben blubberten – hauptsächlich in grün – und in dem sich überall Spulen und Drähte wanden, durch die ungesichert und funkenstobend Elektrizität floss. Alle Wissenschaftler trugen übergroße Brillen und Albert-Einstein-Frisuren, sprachen mit deutschem Akzent und beschäftigten bucklige, mit Narben an den Köpfen versehene Assistenten, die auf Namen wie »Igor« oder »Rasputin« hörten.
In einem solchen Labor war die Kreatur als Experiment gezeugt worden – ein einziger Fehlschlag – und wenn sich nicht einer der Igors oder Rasputins erbarmt hätte und es ohne Wissen des leitenden Professors Todtschlag, einer anerkannte Koryphäe auf seinem Gebiet, in seinem Spind aufgezogen hätte, dann hätte man diese Kreatur wieder genau dorthin zurückgeschickt, woher sie gekommen war: in die Hölle. Doch stattdessen war sie umsorgt worden, und sie war gewachsen und immer größer geworden, bis sie irgendwann zu dem gemeinen, hinterhältigen Biest ausgewachsen war, das sie immer hatte werden sollen und als erstes ihren armen, nichtsahnenden und liebevollen Igor- oder Rasputin-Vater hingeschlachtet hatte. Der ungläubige Ausdruck in seinem Gesicht war herzzerreißend gewesen. Doch er war nur das erste Opfer an diesem Tag, denn die restlichen Igors und Rasputins und verrückten deutschen Wissenschaftler des Labors sollten folgen, ehe die Kreatur zuletzt ihren Schöpfer Professor Doktor Wilhelm Todtschlag gegenüberstand.
Es wurde nie genau geklärt, was an diesem Tag zwischen ihnen passiert war, aber der Professor überlebte unverletzt. Seit diesem Tag wurde die Bestie jedoch unter Hochdruck vom Militär unter Leitung von Professor Todtschlag gejagt.
»Was bist du?«, schluchzte Rien, der Angst verspürte, gepaart mit dem Gefühl, vom Leben ungerecht behandelt zu werden.
Der kleine Teufel musterte Rien aufmerksam. Er leckte sich das Blut von der Schnauze, ehe sich seine zierlichen Beißwerkzeuge abermals bewegten:
»Man nennt mich Nachtmahr. Ich bin ein Alb«, sprach die Kreatur unvermittelt »Du bist in großer Gefahr. Wenn du weiterleben möchtest, dann solltest du in Zukunft auf mich hören.«
Rien verstand gar nichts. Aber plötzlich wirkte seine Hypothese mit Professor Todtschlags Labor gar nicht mehr so abwegig.