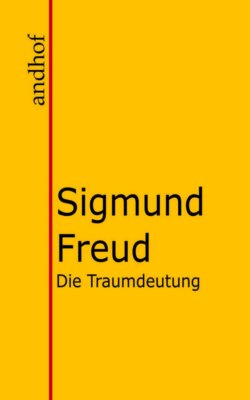Читать книгу Die Traumdeutung - Sigmund Freud, Йоханнес Вильгельм Йенсен - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV.
Die Traumentstellung.
ОглавлениеWenn ich nun die Behauptung aufstelle, daß Wunscherfüllung der Sinn eines jeden Traumes sei, also daß es keine anderen als Wunschträume geben kann, so bin ich des entschiedensten Widerspruches im vorhinein sicher. Man wird mir entgegenhalten: »Daß es Träume gibt, welche als Wunscherfüllungen zu verstehen sind, ist nicht neu, sondern längst von den Autoren bemerkt worden.« (Vgl. Radestock [p. 137 bis 138], Volkelt [p. 110 bis 111], Purkinje [p. 456], Tissié [p. 70], M. Simon [p. 42 über die Hungerträume des eingekerkerten Barons Trenck] und die Stelle bei Griesinger [p. 111].)(45) Daß es aber nichts anderes als Wunscherfüllungsträume geben soll, das ist wieder eine ungerechtfertigte Verallgemeinerung, die sich aber zum Glück leicht zurückweisen läßt. Es kommen doch reichlich genug Träume vor, welche den peinlichsten Inhalt erkennen lassen, aber keine Spur irgend einer Wunscherfüllung. Der pessimistische Philosoph Ed. v. Hartmann steht wohl der Wunscherfüllungstheorie am fernsten. Er äußert in seiner Philosophie des Unbewußten, II. Teil (Stereotypausgabe, p. 344):
»Was den Traum betrifft, so treten mit ihm alle Plackereien des wachen Lebens auch in den Schlafzustand hinüber, nur das einzige nicht, was den Gebildeten einigermaßen mit dem Leben aussöhnen kann: wissenschaftlicher und Kunst-Genuß . . . .« Aber auch minder unzufriedene Beobachter haben hervorgehoben, daß im Traume Schmerz und Unlust häufiger sei als Lust, so Scholz (p. 33), Volkelt (p. 80) u. a. Ja die Damen Sarah Weed und Florence Hallam haben aus der Bearbeitung ihrer Träume einen ziffermäßigen Ausdruck für das Überwiegen der Unlust in den Träumen entnommen. Sie bezeichnen 58% der Träume als peinlich und nur 28.6% als positiv angenehm. Außer diesen Träumen, welche die mannigfaltigen peinlichen Gefühle des Lebens in den Schlaf fortsetzen, gibt es auch Angstträume, in denen uns diese entsetzlichste aller Unlustempfindungen schüttelt, bis wir erwachen, und von solchen Angstträumen werden gerade die Kinder so leicht heimgesucht (vgl. Debacker, Über den Pavor nocturnus), bei denen wir die Wunschträume unverhüllt gefunden haben.
Wirklich scheinen gerade die Angstträume eine Verallgemeinerung des Satzes, den wir aus den Beispielen des vorigen Abschnittes gewonnen haben, der Traum sei eine Wunscherfüllung, unmöglich zu machen, ja diesen Satz als Absurdität zu brandmarken.
Dennoch ist es nicht sehr schwer, sich diesen anscheinend zwingenden Einwänden zu entziehen. Man wolle bloß beachten, daß unsere Lehre nicht auf der Würdigung des manifesten Trauminhaltes beruht, sondern sich auf den Gedankeninhalt bezieht, welcher durch die Deutungsarbeit hinter dem Traume erkannt wird. Stellen wir manifesten und latenten Trauminhalt einander gegenüber. Es ist richtig, daß es Träume gibt, deren manifester Inhalt von der peinlichsten Art ist. Aber hat jemand versucht, diese Träume zu deuten, den latenten Gedankeninhalt derselben aufzudecken? Wenn aber nicht, dann treffen uns die beiden Einwände nicht mehr; es bleibt immerhin möglich, daß auch peinliche und Angst-Träume sich nach der Deutung als Wunscherfüllungen enthüllen(46).
Bei wissenschaftlicher Arbeit ist es oft von Vorteil, wenn die Lösung des einen Problems Schwierigkeiten bereitet, ein zweites hinzuzunehmen, etwa wie man zwei Nüsse leichter miteinander als einzeln aufknackt. So stehen wir nicht nur vor der Frage: Wie können peinliche und Angst-Träume Wunscherfüllungen sein, sondern wir können auch aus unseren bisherigen Erörterungen über den Traum eine zweite Frage aufwerfen: Warum zeigen die Träume indifferenten Inhalts, welche sich als Wunscherfüllungen ergeben, diesen ihren Sinn nicht unverhüllt? Man nehme den weitläufig behandelten Traum von Irmas Injektion, er ist keineswegs peinlicher Natur, er ist durch die Deutung als eklatante Wunscherfüllung zu erkennen. Wozu bedarf es aber überhaupt einer Deutung? Warum sagt der Traum nicht direkt, was er bedeutet? Tatsächlich macht auch der Traum von Irmas Injektion zunächst nicht den Eindruck, daß er einen Wunsch des Träumers als erfüllt darstellt. Der Leser wird diesen Eindruck nicht bekommen haben, aber auch ich selbst wußte es nicht, ehe ich die Analyse angestellt hatte. Heißen wir dieses der Erklärung bedürftige Verhalten des Traumes: die Tatsache der Traumentstellung, so erhebt sich also die zweite Frage: Wovon rührt diese Traumentstellung her?
Der Onkeltraum.
Wenn man hierüber seine ersten Einfälle befrägt, könnte man auf verschiedene mögliche Lösungen geraten, z. B. daß während des Schlafes ein Unvermögen bestehe, den Traumgedanken einen entsprechenden Ausdruck zu schaffen. Allein die Analyse gewisser Träume nötigt uns, für die Traumentstellung eine andere Erklärung zuzulassen. Ich will dies an einem zweiten Traume von mir selbst zeigen, welcher wiederum vielfache Indiskretionen erfordert, aber für dies persönliche Opfer durch eine gründliche Aufhellung des Problems entschädigt.
Vorbericht: Im Frühjahr 1897 erfuhr ich, daß zwei Professoren unserer Universität mich für die Ernennung zum Prof. extraord. vorgeschlagen hatten. Diese Nachricht kam mir überraschend und erfreute mich lebhaft als Ausdruck einer durch persönliche Beziehungen nicht aufzuklärenden Anerkennung von Seite zweier hervorragender Männer. Ich sagte mir aber sofort, daß ich an dieses Ereignis keine Erwartungen knüpfen dürfe. Das Ministerium hatte in den letzten Jahren Vorschläge solcher Art unberücksichtigt gelassen, und mehrere Kollegen, die mir an Jahren voraus waren und an Verdiensten mindestens gleich kamen, warteten seitdem vergebens auf ihre Ernennung. Ich hatte keinen Grund, anzunehmen, daß es mir besser ergehen würde. Ich beschloß also bei mir, mich zu trösten. Ich bin, soviel ich weiß, nicht ehrgeizig, übe meine ärztliche Tätigkeit mit zufriedenstellendem Erfolge aus, auch ohne daß mich ein Titel empfiehlt. Es handelte sich übrigens gar nicht darum, ob ich die Trauben für süß oder sauer erklärte, da sie unzweifelhaft zu hoch für mich hingen.
Eines Abends besuchte mich ein befreundeter Kollege, einer von denjenigen, deren Schicksal ich mir zur Warnung hatte dienen lassen. Seit längerer Zeit ein Kandidat für die Beförderung zum Professor, die den Arzt in unserer Gesellschaft zum Halbgott für seine Kranken erhebt, und minder resigniert als ich, pflegte er von Zeit zu Zeit seine Vorstellung in den Bureaus des hohen Ministeriums zu machen, um seine Angelegenheit zu fördern. Von einem solchen Besuche kam er zu mir. Er erzählte, daß er diesmal den hohen Herrn in die Enge getrieben und ihn gerade heraus befragt habe, ob an dem Aufschub seiner Ernennung wirklich – konfessionelle Rücksichten die Schuld trügen. Die Antwort hatte gelautet, daß allerdings – bei der gegenwärtigen Strömung – Se. Exzellenz vorläufig nicht in der Lage sei usw. »Nun weiß ich wenigstens, woran ich bin,« schloß mein Freund seine Erzählung, die mir nichts Neues brachte, mich aber in meiner Resignation bestärken mußte. Dieselben konfessionellen Rücksichten sind nämlich auch auf meinen Fall anwendbar.
Am Morgen nach diesem Besuche hatte ich folgenden Traum, der auch durch seine Form bemerkenswert war. Er bestand aus zwei Gedanken und zwei Bildern, so daß ein Gedanke und ein Bild einander ablösten. Ich setze aber nur die erste Hälfte des Traumes hieher, da die andere mit der Absicht nichts zu tun hat, welcher die Mitteilung des Traumes dienen soll.
I. Freund R. ist mein Onkel. – Ich empfinde große Zärtlichkeit für ihn.
II. Ich sehe sein Gesicht etwas verändert vor mir. Es ist wie in die Länge gezogen, ein gelber Bart, der es umrahmt, ist besonders deutlich hervorgehoben.
Dann folgen die beiden anderen Stücke, wieder ein Gedanke und ein Bild, die ich übergehe.
Die Deutung des Onkeltraumes.
Die Deutung dieses Traumes vollzog sich folgendermaßen:
Als mir der Traum im Laufe des Vormittags einfiel, lachte ich auf und sagte: Der Traum ist ein Unsinn. Er ließ sich aber nicht abtun und ging mir den ganzen Tag nach, bis ich mir endlich am Abend Vorwürfe machte: »Wenn einer deiner Patienten zur Traumdeutung nichts zu sagen wüßte als: Das ist ein Unsinn, so würdest du es ihm verweisen und vermuten, daß sich hinter dem Traume eine unangenehme Geschichte versteckt, welche zur Kenntnis zu nehmen er sich ersparen will. Verfahre mit dir selbst ebenso; deine Meinung, der Traum sei ein Unsinn, bedeutet nur einen inneren Widerstand gegen die Traumdeutung. Laß dich nicht abhalten.« Ich machte mich also an die Deutung.
»R. ist mein Onkel.« Was kann das heißen? Ich habe doch nur einen Onkel gehabt, den Onkel Josef(47). Mit dem war’s allerdings eine traurige Geschichte. Er hatte sich einmal, es sind mehr als 30 Jahre her, in gewinnsüchtiger Absicht zu einer Handlung verleiten lassen, welche das Gesetz schwer bestraft, und wurde dann auch von der Strafe betroffen. Mein Vater, der damals aus Kummer in wenigen Tagen grau wurde, pflegte immer zu sagen, Onkel Josef sei nie ein schlechter Mensch gewesen, wohl aber ein Schwachkopf; so drückte er sich aus. Wenn also Freund R. mein Onkel Josef ist, so will ich damit sagen: R. ist ein Schwachkopf. Kaum glaublich und sehr unangenehm! Aber da ist ja jenes Gesicht, das ich im Traume sehe, mit den länglichen Zügen und dem gelben Barte. Mein Onkel hatte wirklich so ein Gesicht, länglich von einem schönen blonden Barte umrahmt. Mein Freund R. war intensiv schwarz, aber wenn die Schwarzhaarigen zu ergrauen anfangen, so büßen sie für die Pracht ihrer Jugendjahre. Ihr schwarzer Bart macht Haar für Haar eine unerfreuliche Farbenwanderung durch; er wird zuerst rotbraun, dann gelbbraun, dann erst definitiv grau. In diesem Stadium befindet sich jetzt der Bart meines Freundes R.; übrigens auch schon der meinige, wie ich mit Mißvergnügen bemerke. Das Gesicht, das ich im Traume sehe, ist gleichzeitig das meines Freundes R. und das meines Onkels. Es ist wie eine Mischphotographie von Galton, der, um Familienähnlichkeiten zu eruieren, mehrere Gesichter auf die nämliche Platte photographieren ließ. Es ist also kein Zweifel möglich, ich meine wirklich, daß mein Freund R. ein Schwachkopf ist – wie mein Onkel Josef.
Ich ahne noch gar nicht, zu welchem Zwecke ich diese Beziehung hergestellt, gegen die ich mich unausgesetzt sträuben muß. Sie ist doch nicht sehr tiefgehend, denn der Onkel war ein Verbrecher, mein Freund R. ist unbescholten. Etwa bis auf die Bestrafung dafür, daß er mit dem Rade einen Lehrbuben niedergeworfen. Sollte ich diese Untat meinen? Das hieße die Vergleichung ins Lächerliche ziehen. Da fällt mir aber ein anderes Gespräch ein, das ich vor einigen Tagen mit einem anderen Kollegen N., und zwar über das gleiche Thema hatte. Ich traf N. auf der Straße; er ist auch zum Professor vorgeschlagen, wußte von meiner Ehrung und gratulierte mir dazu. Ich lehnte entschieden ab. »Gerade Sie sollten sich den Scherz nicht machen, da Sie den Wert des Vorschlages an sich selbst erfahren haben.« Er darauf, wahrscheinlich nicht ernsthaft: »Das kann man nicht wissen. Gegen mich liegt ja etwas Besonderes vor. Wissen Sie nicht, daß eine Person einmal eine gerichtliche Anzeige gegen mich erstattet hat? Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, daß die Untersuchung eingestellt wurde; es war ein gemeiner Erpressungsversuch; ich hatte noch alle Mühe, die Anzeigerin selbst vor Bestrafung zu retten. Aber vielleicht macht man im Ministerium diese Angelegenheit gegen mich geltend, um mich nicht zu ernennen. Sie aber, Sie sind unbescholten.« Da habe ich ja den Verbrecher, gleichzeitig aber auch die Deutung und Tendenz meines Traumes. Mein Onkel Josef stellt mir da beide nicht zu Professoren ernannte Kollegen dar, den einen als Schwachkopf, den anderen als Verbrecher. Ich weiß jetzt auch, wozu ich diese Darstellung brauche. Wenn für den Aufschub der Ernennung meiner Freunde R. und N. »konfessionelle« Rücksichten maßgebend sind, so ist auch meine Ernennung in Frage gestellt; wenn ich aber die Zurückweisung der beiden auf andere Gründe schieben kann, die mich nicht treffen, so bleibt mir die Hoffnung ungestört. So verfährt mein Traum, er macht den einen, R., zum Schwachkopf, den anderen, N., zum Verbrecher; ich bin aber weder das eine noch das andere; unsere Gemeinsamkeit ist aufgehoben, ich darf mich auf meine Ernennung zum Professor freuen, und bin der peinlichen Anwendung entgangen, die ich aus R.s Nachricht, was ihm der hohe Beamte bekannt, für meine eigene Person hätte machen müssen.
Ich muß mich mit der Deutung dieses Traumes noch weiter beschäftigen. Er ist für mein Gefühl noch nicht befriedigend erledigt, ich bin noch immer nicht über die Leichtigkeit beruhigt, mit der ich zwei geachtete Kollegen degradiere, um mir den Weg zur Professur frei zu halten. Meine Unzufriedenheit mit meinem Vorgehen hat sich bereits ermäßigt, seitdem ich den Wert der Aussagen im Traume zu würdigen weiß. Ich würde gegen jedermann bestreiten, daß ich R. wirklich für einen Schwachkopf halte, und daß ich an N.s Darstellung jener Erpressungsaffäre nicht glaube. Ich glaube ja auch nicht, daß Irma durch eine Injektion Ottos mit einem Propylenpräparat gefährlich krank geworden ist; es ist hier wie dort nur mein Wunsch, daß es sich so verhalten möge, den mein Traum ausdrückt. Die Behauptung, in welcher sich mein Wunsch realisiert, klingt im zweiten Traume minder absurd als im ersten; sie ist hier in geschickter Benutzung tatsächlicher Anhaltspunkte geformt, etwa wie eine gut gemachte Verleumdung, an der »etwas daran ist«, denn Freund R. hatte seinerzeit das Votum eines Fachprofessors gegen sich, und Freund N. hat mir das Material für die Anschwärzung arglos selbst geliefert. Dennoch, ich wiederhole es, scheint mir der Traum weiterer Aufklärung bedürftig.
Ich entsinne mich jetzt, daß der Traum noch ein Stück enthielt, auf welches die Deutung bisher keine Rücksicht genommen hat. Nachdem mir eingefallen, R. ist mein Onkel, empfinde ich im Traume warme Zärtlichkeit für ihn. Wohin gehört diese Empfindung? Für meinen Onkel Josef habe ich zärtliche Gefühle natürlich niemals gehabt. Freund R. ist mir seit Jahren lieb und teuer; aber käme ich zu ihm und drückte ihm meine Zuneigung in Worten aus, die annähernd dem Grad meiner Zärtlichkeit im Traume entsprechen, so wäre er ohne Zweifel erstaunt. Meine Zärtlichkeit gegen ihn erscheint mir unwahr und übertrieben, ähnlich wie mein Urteil über seine geistigen Qualitäten, das ich durch die Verschmelzung seiner Persönlichkeit mit der des Onkels ausdrücke; aber in entgegengesetztem Sinne übertrieben. Nun dämmert mir aber ein neuer Sachverhalt. Die Zärtlichkeit des Traumes gehört nicht zum latenten Inhalt, zu den Gedanken hinter dem Traume; sie steht im Gegensatze zu diesem Inhalt; sie ist geeignet, mir die Kenntnis der Traumdeutung zu verdecken. Wahrscheinlich ist gerade dies ihre Bestimmung. Ich erinnere mich, mit welchem Widerstand ich an die Traumdeutung ging, wie lange ich sie aufschieben wollte und den Traum für baren Unsinn erklärte. Von meinen psychoanalytischen Behandlungen her weiß ich, wie ein solches Verwerfungsurteil zu deuten ist. Es hat keinen Erkenntniswert, sondern bloß den einer Affektäußerung. Wenn meine kleine Tochter einen Apfel nicht mag, den man ihr angeboten hat, so behauptet sie, der Apfel schmeckt bitter, ohne ihn auch nur gekostet zu haben. Wenn meine Patienten sich so benehmen wie die Kleine, so weiß ich, daß es sich bei ihnen um eine Vorstellung handelt, welche sie verdrängen wollen. Dasselbe gilt für meinen Traum. Ich mag ihn nicht deuten, weil die Deutung etwas enthält, wogegen ich mich sträube. Nach vollzogener Traumdeutung erfahre ich, wogegen ich mich gesträubt hatte; es war die Behauptung, daß R. ein Schwachkopf ist. Die Zärtlichkeit, die ich gegen R. empfinde, kann ich nicht auf die latenten Traumgedanken, wohl aber auf dies mein Sträuben zurückführen. Wenn mein Traum im Vergleiche zu seinem latenten Inhalt in diesem Punkte entstellt, und zwar ins Gegensätzliche entstellt ist, so dient die im Traume manifeste Zärtlichkeit dieser Entstellung oder, mit anderen Worten, die Entstellung erweist sich hier als absichtlich, als ein Mittel der Verstellung. Meine Traumgedanken enthalten eine Schmähung für R.; damit ich diese nicht merke, gelangt in den Traum das Gegenteil, ein zärtliches Empfinden für ihn.
Die psychische Zensur.
Es könnte dies eine allgemein gültige Erkenntnis sein. Wie die Beispiele in Abschnitt III gezeigt haben, gibt es ja Träume, welche unverhüllte Wunscherfüllungen sind. Wo die Wunscherfüllung unkenntlich, verkleidet ist, da müßte eine Tendenz zur Abwehr gegen diesen Wunsch vorhanden sein, und infolge dieser Abwehr könnte der Wunsch sich nicht anders als entstellt zum Ausdruck bringen. Ich will zu diesem Vorkommnis aus dem psychischen Binnenleben das Seitenstück aus dem sozialen Leben suchen. Wo findet man im sozialen Leben eine ähnliche Entstellung eines psychischen Aktes? Nur dort, wo es sich um zwei Personen handelt, von denen die eine eine gewisse Macht besitzt, die zweite wegen dieser Macht eine Rücksicht zu nehmen hat. Diese zweite Person entstellt dann ihre psychischen Akte oder, wie wir auch sagen können, sie verstellt sich. Die Höflichkeit, die ich alle Tage übe, ist zum guten Teile eine solche Verstellung; wenn ich meine Träume für den Leser deute, bin ich zu solchen Entstellungen genötigt. Über den Zwang zu solcher Entstellung klagt auch der Dichter:
»Das Beste, was du wissen kannst, darfst du den Buben doch nicht sagen.«
In ähnlicher Lage befindet sich der politische Schriftsteller, der den Machthabern unangenehme Wahrheiten zu sagen hat. Wenn er sie unverhohlen sagt, wird der Machthaber seine Äußerung unterdrücken, nachträglich, wenn es sich um mündliche Äußerung handelt, präventiv, wenn sie auf dem Wege des Druckes kundgegeben werden soll. Der Schriftsteller hat die Zensur zu fürchten, er ermäßigt und entstellt darum den Ausdruck seiner Meinung. Je nach der Stärke und Empfindlichkeit dieser Zensur sieht er sich genötigt, entweder bloß gewisse Formen des Angriffes einzuhalten oder in Anspielungen anstatt in direkten Bezeichnungen zu reden oder er muß seine anstößige Mitteilung hinter einer harmlos erscheinenden Verkleidung verbergen, er darf z. B. von Vorfällen zwischen zwei Mandarinen im Reiche der Mitte erzählen, während er die Beamten des Vaterlandes im Auge hat. Je strenger die Zensur waltet, desto weitgehender wird die Verkleidung, desto witziger oft die Mittel, welche den Leser doch auf die Spur der eigentlichen Bedeutung leiten.
Die bis ins einzelne durchzuführende Übereinstimmung zwischen den Phänomenen der Zensur und denen der Traumentstellung gibt uns die Berechtigung, ähnliche Bedingungen für beide vorauszusetzen. Wir würden also als die Urheber der Traumgestaltung zwei psychische Mächte (Strömungen, Systeme) im Einzelmenschen annehmen, von denen die eine den durch den Traum zum Ausdruck gebrachten Wunsch bildet, während die andere eine Zensur an diesem Traumwunsche übt und durch diese Zensur eine Entstellung seiner Äußerung erzwingt. Es fragt sich nur, worin die Machtbefugnis dieser zweiten Instanz besteht, kraft deren sie ihre Zensur ausüben darf. Wenn wir uns erinnern, daß die latenten Traumgedanken vor der Analyse nicht bewußt sind, der von ihnen ausgehende manifeste Trauminhalt aber als bewußt erinnert wird, so liegt die Annahme nicht fern, das Vorrecht der zweiten Instanz sei eben die Zulassung zum Bewußtsein. Aus dem ersten System könne nichts zum Bewußtsein gelangen, was nicht vorher die zweite Instanz passiert habe, und die zweite Instanz lasse nichts passieren, ohne ihre Rechte auszuüben und die ihr genehmen Abänderungen am Bewußtseinswerber durchzusetzen. Wir verraten dabei eine ganz bestimmte Auffassung vom »Wesen« des Bewußtseins; das Bewußtwerden ist für uns ein besonderer psychischer Akt, verschieden und unabhängig von dem Vorgang des Gedacht- oder Vorgestelltwerdens, und das Bewußtsein erscheint uns als ein Sinnesorgan, welches einen anderwärts gegebenen Inhalt wahrnimmt. Es läßt sich zeigen, daß die Psychopathologie dieser Grundannahmen schlechterdings nicht entraten kann. Eine eingehendere Würdigung derselben dürfen wir uns für eine spätere Stelle vorbehalten.
Wenn ich die Vorstellung der beiden psychischen Instanzen und ihrer Beziehungen zum Bewußtsein festhalte, ergibt sich für die auffällige Zärtlichkeit, die ich im Traume für meinen Freund R. empfinde, der in der Traumdeutung so herabgesetzt wird, eine völlig kongruente Analogie aus dem politischen Leben der Menschen. Ich versetze mich in ein Staatsleben, in welchem ein auf seine Macht eifersüchtiger Herrscher und eine rege öffentliche Meinung miteinander ringen. Das Volk empöre sich gegen einen ihm mißliebigen Beamten und verlange dessen Entlassung; um nicht zu zeigen, daß er dem Volkswillen Rechnung tragen muß, wird der Selbstherrscher dem Beamten gerade dann eine hohe Auszeichnung verleihen, zu der sonst kein Anlaß vorläge. So zeichnet meine zweite, den Zugang zum Bewußtsein beherrschende Instanz Freund R. durch einen Erguß von übergroßer Zärtlichkeit aus, weil die Wunschbestrebungen des ersten Systems ihn in einem besonderen Interesse, dem sie gerade nachhängen, als einen Schwachkopf beschimpfen möchten(48).
Träume von einem versagten Wunsch.
Vielleicht werden wir hier von der Ahnung erfaßt, daß die Traumdeutung im stande sei, uns Aufschlüsse über den Bau unseres seelischen Apparates zu geben, welche wir von der Philosophie bisher vergebens erwartet haben. Wir folgen aber nicht dieser Spur, sondern kehren, nachdem wir die Traumentstellung aufgeklärt haben, zu unserem Ausgangsproblem zurück. Es wurde gefragt, wie denn die Träume mit peinlichem Inhalt als Wunscherfüllungen aufgelöst werden können. Wir sehen nun, dies ist möglich, wenn eine Traumentstellung stattgefunden hat, wenn der peinliche Inhalt nur zur Verkleidung eines erwünschten dient. Mit Rücksicht auf unsere Annahmen über die zwei psychischen Instanzen können wir jetzt auch sagen: die peinlichen Träume enthalten tatsächlich etwas, was der zweiten Instanz peinlich ist, was aber gleichzeitig einen Wunsch der ersten Instanz erfüllt. Sie sind insofern Wunschträume, als ja jeder Traum von der ersten Instanz ausgeht, die zweite sich nur abwehrend, nicht schöpferisch, gegen den Traum verhält. Beschränken wir uns auf eine Würdigung dessen, was die zweite Instanz zum Traume beiträgt, so können wir den Traum niemals verstehen. Es bleiben dann alle Rätsel bestehen, welche von den Autoren am Traum bemerkt worden sind.
Daß der Traum wirklich einen geheimen Sinn hat, der eine Wunscherfüllung ergibt, muß wiederum für jeden Fall durch die Analyse erwiesen werden. Ich greife darum einige Träume peinlichen Inhaltes heraus und versuche deren Analyse. Es sind zum Teil Träume von Hysterikern, die einen langen Vorbericht und stellenweise ein Eindringen in die psychischen Vorgänge bei der Hysterie erfordern. Ich kann dieser Erschwerung der Darstellung aber nicht aus dem Wege gehen.
Wenn ich einen Psychoneurotiker in analytische Behandlung nehme, werden seine Träume regelmäßig, wie bereits erwähnt, zum Thema unserer Besprechungen. Ich muß ihm dabei alle die psychologischen Aufklärungen geben, mit deren Hilfe ich selbst zum Verständnis seiner Symptome gelangt bin, und erfahre dabei eine unerbittliche Kritik, wie ich sie von den Fachgenossen wohl nicht schärfer zu erwarten habe. Ganz regelmäßig erhebt sich der Widerspruch meiner Patienten gegen den Satz, daß die Träume sämtlich Wunscherfüllungen seien. Hier einige Beispiele von dem Material an Träumen, welche mir als Gegenbeweise vorgehalten werden.
»Sie sagen immer, der Traum ist ein erfüllter Wunsch,« beginnt eine witzige Patientin. »Nun will ich Ihnen einen Traum erzählen, dessen Inhalt ganz im Gegenteil dahin geht, daß mir ein Wunsch nicht erfüllt wird. Wie vereinen Sie das mit Ihrer Theorie? Der Traum lautet wie folgt:
Ich will ein Souper geben, habe aber nichts vorrätig als etwas geräucherten Lachs. Ich denke daran, einkaufen zu gehen, erinnere mich aber, daß es Sonntag nachmittag ist, wo alle Läden gesperrt sind. Ich will nun einigen Lieferanten telephonieren, aber das Telephon ist gestört. So muß ich auf den Wunsch, ein Souper zu geben, verzichten.«
Ich antworte natürlich, daß über den Sinn dieses Traumes nur die Analyse entscheiden kann, wenngleich ich zugebe, daß er für den ersten Anblick vernünftig und zusammenhängend erscheint und dem Gegenteil einer Wunscherfüllung ähnlich sieht. »Aus welchem Material ist aber dieser Traum hervorgegangen? Sie wissen, daß die Anregung zu einem Traume jedesmal in den Erlebnissen des letzten Tages liegt.«