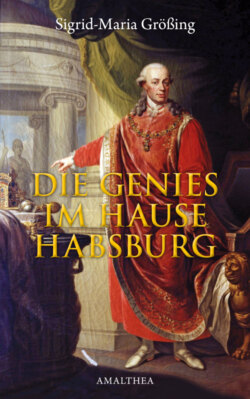Читать книгу Die Genies im Hause Habsburg - Sigrid-Maria Größing - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein junger Mann bewirkte Großes
ОглавлениеRudolf IV.
War er nun der Sohn des habsburgischen Herzogs Albrecht II., oder war er es nicht? Rätsel um Rätsel gab seine Geburt schon seinen Zeitgenossen auf, denn sein Vater, der verschiedene Beinamen wie Albrecht der Lahme oder Albrecht der Weise im Laufe der Zeit führte, galt ab dem dreißigsten Lebensjahr als gelähmt. Von ungewöhnlicher Weitsicht, aber auch gebildet war Albrecht auf alle Fälle. Ob er wirklich seit seinem dreißigsten Lebensjahr gehbehindert war, darüber sind auch heute noch die Experten geteilter Meinung. Denn seit dem Jahre 1330 war die Mär im Umlauf, dass man dem jungen Mann bei einem Fest vergiftete Speisen vorgesetzt habe, was zu schweren Krämpfen geführt haben soll. Als Albrecht, der jüngste Sohn von König Albrecht I., die zunächst lebensbedrohlichen Komplikationen überwunden hatte, konnte er weder Arme noch Beine bewegen. Sein Zustand besserte sich auch in Zukunft nicht, sodass er sich bis zu seinem Tode im Jahre 1358 in einer Sänfte tragen lassen musste. Wahrscheinlich litt er in dieser Zeit an einer schweren Polyarthritis, die ihm jede Bewegung zur Qual machte.
Dass Albrecht überhaupt Chancen auf ein Regierungsamt hatte, verdankte er dem Zufall, denn seine Brüder Friedrich, Leopold und Otto, von denen Friedrich als Gegenkandidat zu Ludwig dem Bayern zum König gewählt worden war und der im Grunde ein unglückliches Leben geführt hatte, waren alle vom Tod heimgeholt worden, sodass am Ende nur er als Herzog in den österreichischen Gebieten, die den Habsburgern unterstanden, übrig geblieben war. Albrecht hatte jahrelang ein Schattendasein nach der Ermordung seines Vaters König Albrecht im Jahre 1308 geführt, seine Brüder hatten mehr oder weniger sein Leben bestimmt, auch als es darum ging, für ihn eine Braut zu suchen. Es war sein dynamischer Bruder Leopold, der die Fäden nach Basel gezogen hatte, als er in Erfahrung gebracht hatte, dass der letzte Graf Ulrich III. von Pfirt 1324 überraschend die Augen für immer geschlossen hatte. Denn jetzt war die Chance groß, auf dem Weg über das Brautbett wichtige Gebiete im Elsass für das Haus Habsburg zu erwerben, da Ulrich nur zwei Töchter hinterließ, die beide erbberechtigt waren. Da man aber landauf, landab wusste, dass in der Pfirtfamilie ein gutes Einvernehmen herrschte, hoffte Leopold, dass sich die Erbschaftsangelegenheiten gütlich würden regeln lassen. Und er sollte recht behalten! Denn einerseits wollte der Vormund von Johanna und Ursula, Papst Johannes XXII., keinen Konflikt mit den Habsburgern, andererseits war die Mutter der beiden Mädchen Johanna von Mömpelgard politisch so klug, einen Vertrag mit den Töchtern zu schließen, in dem die jüngere mit einem Batzen Geld abgefunden wurde, sodass es innerhalb der Familie zu keinen Streitigkeiten kommen konnte. Johanna aber brachte interessante Gebiete für Albrecht mit in die Ehe, denn nicht nur der Sundgau, auch die südlichen Vogesen, die Burgunder Pforte und Teile des Jura waren vielleicht begehrenswerter als die Braut!
Denn Johanna von Pfirt war mit ihren 24 Jahren keineswegs ein junges Mädchen mehr, als sie Albrecht die Hand fürs Leben reichte. Im Allgemeinen wurden im 14. Jahrhundert schon die zukünftigen Ehekontrakte unterzeichnet, wenn Braut und Bräutigam noch in den Windeln lagen. Am 26. März 1324 fand die Hochzeit in Wien statt und jedermann machte sich mit dem Gedanken vertraut, dass die junge Herzogin noch ehe sich das Jahr dem Ende zuneigte, einem Kind das Leben schenken würde. Als sich nach einiger Zeit keine Anzeichen einer Schwangerschaft bemerkbar machten, schüttelte man beinah ungläubig den Kopf, denn ein Erbprinz schien dringend im Hause Habsburg vonnöten zu sein. Jahr um Jahr verging und die Herzogin war immer noch nicht gesegneten Leibes, als 1330 die Katastrophe mit ihrem Gemahl eintrat. Wie sollte der unbewegliche Albrecht in Hinkunft in der Lage sein, ein Kind zu zeugen? Hier konnte nur der Himmel ein Wunder schicken!
Albrecht, aber auch Johanna waren tiefgläubige Menschen, die die Hoffnung nicht aufgaben, mithilfe der rheinischen Heiligen ein Kind zu bekommen. Albrecht unternahm aus diesem Grunde 1337 eine Wallfahrt nach Köln und Aachen, wo die Reliquien der Heiligen ruhten. Und der Himmel hatte tatsächlich ein Einsehen mit dem Ehepaar.
Groß war die Freude, als Johanna von Pfirt mit ihren 39 Jahren einem gesunden Knaben im Jahre 1339 das Leben schenkte. Kaum lag das Kind in der Wiege, als sich aber schon Zweifler zu Wort meldeten, ob der Kindsvater tatsächlich der Herzog sein konnte. Als dann noch weitere elf Kinder folgten, waren aber diejenigen, die die Gerüchteküche jahrelang geschürt hatten, nicht etwa mundtot gemacht. Im Gegenteil: Es konnte nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, dass sich erst nach 15-jähriger Ehe so ein gewaltiger Kindersegen einstellte, noch dazu, wo sich die Mutter für damalige Begriffe schon beinah dem Greisenalter näherte!
Die Zweifel an der Vaterschaft Albrechts sind bis heute nicht ganz ausgeräumt, wobei man kaum annehmen kann, dass Johanna, die in vielen Dingen ihren gesunden Menschenverstand bewiesen hatte, sich tatsächlich mit einem Liebhaber vergnügte und dabei Kopf und Kragen riskierte. Denn einerseits hätte ihr Ehemann kaum Verständnis gezeigt und andererseits beobachtete man Johanna von allen Seiten peinlichst genau, sodass es für sie äußerst gewagt gewesen wäre, irgendeinem jungen Mann Zutritt zu ihrer Kemenate zu gewähren.
Wie immer sich die Geschichte abgespielt haben mochte, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass es auch in unserer Zeit noch sensationell ist, wenn eine Frau mit 51 Jahren ein Kind zur Welt bringt. Heute würde sie höchstwahrscheinlich aufgrund der Kunst der Ärzte überleben, Johanna allerdings starb bei der Geburt des letzten Kindes. Während sechs Kinder am Leben geblieben waren, starben fünf weitere unmittelbar nach der Geburt – eine Tragödie für die ganze Familie, wahrscheinlich aber vor allem für die Mutter!
Trotz dieser merkwürdigen Lebensumstände war Johanna von Pfirt eine tatkräftige Frau, die ihren kranken Mann immer und überall bestens vertrat. Sie bereiste die habsburgischen Länder und kümmerte sich allerorts um Recht und Gerechtigkeit, sie ging mit offenen Augen durch die Welt und jedermann wusste, wenn sich die Herzogin zu Besuch angesagt hatte, konnte man auf ihren Rat und ihre Hilfe hoffen. Viel von ihrem Wesen schien ihr ältester Sohn Rudolf geerbt zu haben, wenngleich auch Charakterzüge seines wahrscheinlichen Vaters bei ihm zu erkennen waren.
Schon sehr bald wurde er von seinem Vater Albrecht II. zu den wichtigsten Versammlungen mitgenommen, der Knabe sollte von klein auf lernen, sich in fremder Umgebung zu Hause zu fühlen und andere Menschen zu beurteilen.
Die Kindheit und frühe Jugend Rudolfs liegt größtenteils im Dunkeln, bekannt ist nur, dass er schon im zarten Alter von acht Jahren mit Isabella, der Tochter Eduards III. von England, verlobt worden war. In dieser Zeit standen die Sterne günstig, diese Heirat zu forcieren. Aber schon bald hatte sich das Blatt gewendet, andere Konstellationen zeigten auf, dass es in Zukunft für die Habsburger wesentlich günstiger wäre, wenn der Erbprinz eine Tochter des römischen Königs Karl IV. aus dem Hause Luxemburg heiraten würde. Ohne sich viel um die frühere Verlobung zu kümmern, wurde Albrecht II. nicht nur von Karl in Seefeld in Niederösterreich belehnt, zugleich wurde eine neue Verlobung ausgesprochen, die Familien sollten fest durch eheliche Bande verknüpft werden. Dabei war die kleine Tochter Karls auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, denn der Vater hatte das erst zweijährige Kind mit dem Sohn des Thüringer Landgrafen Friedrich II. von Meißen, mit dem jungen Balthasar, verlobt, da ihm eine Verbindung von Böhmen zum Reich erstrebenswert schien. Aber so schnell der Heiratskontrakt geschlossen war, so schnell wurde er wieder gelöst, nachdem es Karl opportun schien, auch im Süden Unterstützung durch die Habsburger zu bekommen. Daher nahm er seine Tochter Katharina gleich nach Seefeld in Niederösterreich mit, wo man die Kinder Rudolf und Katharina als zukünftiges Ehepaar präsentierte. Dass Karl seine kleine Tochter an einen Habsburger verheiraten wollte, sahen freilich besonders die Wittelsbacher mit scheelem Blick, denn sie konnten alles brauchen, nur kein erstarktes Gebiet im Osten.
Das Treffen in Seefeld diente nicht nur der Verlobung der Kinder, Karl belehnte hier auch Albrecht mit den österreichischen Gebieten, der Steiermark und Kärnten. Dass Katharina nicht mehr nach Hause nach Prag zurückkehren sollte, sondern in ihrer neuen Heimatstadt Wien erzogen werden sollte, berührte den Vater wahrscheinlich herzlich wenig, denn Töchter waren nun einmal zu dieser Zeit nicht viel mehr als eine wichtige Handelsware!
Ob die beiden Kinder Rudolf und Katharina einander in den nächsten Jahren besser kennen lernten, davon schweigen die Chronisten. Gespielt haben die Kinder wahrscheinlich nicht miteinander, zu sehr sah man in ihnen die kleinen Erwachsenen, die ihre Pflicht zu erfüllen hatten. Für Rudolf setzte auch schon bald ein intensives Lernprogramm ein, die besten Philosophen sollten den jungen Mann lehren, die Probleme der Zukunft zu erkennen und möglichst gut zu lösen. An eine kindliche Entwicklung in unserem Sinn ist dabei kaum zu denken. Die Schriften, die dem erst neunjährigen Rudolf gewidmet wurden, geben Aufschluss über die hohen Ansprüche, die man an den Knaben stellte, sie wären für ein normales Kind kaum verständlich gewesen. Aber es war, als hätte man geahnt, dass Rudolf kein langes Leben beschieden war, sonst hätte man sich vielleicht mit den vielfältigen Instruktionen Zeit gelassen und dem Kind nicht ungewöhnlich früh lesen und schreiben beigebracht.
Der Vater trachtete außerdem danach, dass Rudolf seine Aufgabe, immer wieder seine Länder zu bereisen und nach dem Rechten zu sehen, schon bald erkannte. Es gab viel zu tun in der nächsten Zeit, die Wirren der kaiserlosen Zeit waren immer noch nicht ganz überwunden, das wussten sowohl Karl IV. als auch Albrecht II. Es gab immer noch ständig Reibereien mit den Schweizern, nur ein starker König wie Karl war in der Lage, sie im Zaum zu halten. Es war kein Wunder, dass der junge Rudolf von seinem Schwiegervater in spe ungewöhnlich beeindruckt war, vor allem, als er mit seinen vierzehn Jahren zum symbolischen Beilager nach Prag reiste. Für die beiden Väter waren damit die verwandtschaftlichen Bande offiziell geknüpft, wenn sich auch unter der Bettdecke keineswegs etwas abgespielt hatte. Rudolf kam in Prag aus dem Staunen nicht heraus, die Stadt mit ihren neuen Bauten erschien ihm wie im Märchen, die Straßen waren gepflastert, sodass man bei Regenwetter nicht mehr im Morast versank, die Häuser schienen sauber und gepflegt, am meisten bewunderte der Jüngling allerdings das Wunderwerk des Veitsdomes und die Universität. Obwohl Rudolf in seinem jungen Leben schon weit herumgekommen war, hatte er so eine Stadt noch nie gesehen, eine wahre Hauptstadt des Reiches! Und er nahm sich vor, auch Wien zu einer modernen Metropole zu machen, zu einem Zentrum im Osten, das Prag in nichts nachstehen sollte!
Natürlich war sich Rudolf damals schon bewusst, dass er als Herzog von Österreich in keiner Weise die Machtposition erlangen würde, wie sie Karl, zuerst als erwählter römischer König und später als gekrönter deutscher Kaiser, innehatte. Aber er musste einen Weg finden, aus der zweiten Reihe herauszutreten, in die die Habsburger durch die Gesetze der Goldenen Bulle, die 1356 von Karl IV. erlassen worden waren, gestellt waren. Der Schwiegervater hatte nämlich in dem Gesetzeswerk mitnichten die Absicht gehabt, die Habsburger irgendwie aufzuwerten, im Gegenteil, er zog nicht einmal die großen Gebiete, über die sie herrschten, ins Kalkül, als es darum ging, die Herzöge eventuell in die Reihe der Kurfürsten aufzunehmen.
Wie immer sich die Stimmung zwischen diesen beiden hochbegabten Männern entwickelte, so fühlte sich Rudolf sicherlich hintangestellt. Er musste also versuchen, irgendetwas aus der Tasche zu ziehen, um Karl zu beweisen, dass er nicht nur der kleine Herzog aus den Alpenregionen war. Auf den Reisen, die er mit dem Schwiegervater unternommen hatte, hatte Rudolf genug Gelegenheit gehabt, den Charakter des Luxemburgers kennenzulernen, vor allem aber auch seine tiefe Religiosität, die sich darin zeigte, dass Karl, wo er nur konnte, die Skelette von Heiligen ausgraben ließ, um sich entweder einen Schädel oder einzelne Knochen als Reliquien nach Böhmen mitzunehmen, wo er sie in kostbaren Gefäßen zur Schau stellte. So machte Karl seinem Schwiegersohn ein besonderes Geschenk, von dem er glaubte, es würde den jungen Mann erfreuen: Er schenkte ihm eine Reliquie des Heiligen Pelagius.
Viele Kunstschätze ließ Karl nach Karlstein in Böhmen bringen, wo auch die Reichsinsignien aufbewahrt wurden. Der Kaiser war von diesen Kostbarkeiten so hingerissen, dass er einen eigenen Tag bestimmte, an dem den Insignien gleichsam besondere Ehren erwiesen werden sollten.
Im Jahr 1356 war es schließlich offiziell so weit, dass die Ehe zwischen Rudolf und Katharina in Wien vollzogen wurde. Vorher aber mussten noch die finanziellen Angelegenheiten geregelt werden, da Katharina als Mitgift 10 000 Schock großer Prager Pfennige bekommen sollte, dazu eine jährliche Rente von 1000 Schock sowie als Morgengabe 15 000 Schock. Aber erst als der Kaiser 4000 Schock in bar aus seinen Geldtruhen holen ließ und die Stadt Laa an der Thaya und eine böhmische Festung verpfändet waren, durfte Rudolf mit Katharina das Brautbett besteigen. Der Herzog von Österreich wollte auf Nummer sicher gehen!
Weder Rudolf noch Katharina war es vergönnt, längere Zeit gemeinsam zu verbringen, denn auf Rudolf, der nach dem Tod seines Vaters am 20. Juli 1358 nicht nur die österreichischen Gebiete, die Steiermark und Kärnten geerbt hatte, warteten in den Vorlanden, im Elsass und im Sundgau große und vor allem schwierige Aufgaben. Vielleicht wäre es dem jungen Mann gar nicht möglich gewesen, all die Probleme, die sich auch aus der Ferne der Schweizer Städte, die ständig um ihre Freiheit kämpften, zu lösen, hätte er nicht als junger Reichslandvogt eine mit allen politischen Wassern gewaschene Frau als Beraterin gehabt: seine Tante Agnes, die einstige Gemahlin des früh verstorbenen letzten Arpadenkönigs Andreas III. von Ungarn. Nach dem Tod ihres Mannes war Agnes in den Westen gezogen, wobei sie freilich vorausschauend genug war, ein kleines Vermögen mitzunehmen. Als Johann Parricida, ihr Cousin, König Albrecht I. im Jahre 1308 heimtückisch umgebracht hatte, ging Agnes’ ganzes Trachten dahin, Rache an dem Königsmörder zu nehmen. Da sie einsah, dass ihr dies im Diesseits kaum gelingen konnte, sann sie auf die Vergeltung Gottes im Jenseits. Sie stiftete das Doppelkloster Königsfelden sowie das Kloster Töss, wo ein erstes Opfer ihrer übergroßen Religiosität ihre Stieftochter Elisabeth wurde, die keineswegs davon begeistert war, für immer den Schleier nehmen zu müssen.
So sehr Agnes von den Eidgenossen mit scheelen Blicken betrachtet wurde, so sehr man sie auch mit unflätigen Ausdrücken bedachte – die Schweizer bezeichneten sie gar als »listiges Weib«, vor dem man sich in Acht nehmen müsste, oder als »alte Trugnerin« –, so erfolgreich war sie als Helfershelferin ihrer habsburgischen Verwandten. 1333 schloss sie den »Landfriedensbund«, ein einmaliger diplomatischer Erfolg in den Vorlanden, da in den nächsten Jahren die Waffen schweigen würden.
Wahrscheinlich erkannte der junge Rudolf sehr schnell, wie wichtig seine Tante in den westlichen Teilen seiner Länder war, die ihm als Reichslandvogt unterstanden, sie glich einem Schutzschild, an dem alles abprallte. Deshalb reiste er im Jahr 1357 zusammen mit seiner jungen Ehefrau Katharina nach Königsfelden, um nicht nur politische Probleme mit Agnes zu besprechen, sondern auch persönliche Gespräche mit ihr zu führen. Mit jedem Tag erstaunte Agnes den jungen wissbegierigen Mann mehr, denn sie war eine hochgebildete Frau, die in bestem Kontakt mit den bedeutendsten Wissenschaftlern ihrer Zeit stand. Der große Meister Eckhart widmete ihr das Buch »Liber benedictus«, damals eine hohe Auszeichnung für eine Frau. Durch die Tante beeinflusst, bekam Rudolf, der selber tief religiös war, Zugang zu den mystischen Strömungen im Lande, wenngleich er sich auf der anderen Seite als krasser Realist gegen einen zunehmenden politischen Einfluss der Kirche aussprach. Als Privatperson akzeptierte er es voll und ganz, dass seine Schwester Katharina, die das »Büchlein von der göttlichen Weisheit« des Mystikers Heinrich Seuse besaß, in das Rudolf selbst in seiner Geheimschrift den Satz »Das Puchel hat ein ent« geschrieben hatte, ihr Leben im Klarissenkloster in Wien zubrachte. Aber als Herzog in seinen Landen waren ihm die anfänglich guten Beziehungen zum Kaiser und zu Papst Innozenz VI. von großer Wichtigkeit, wobei Schwiegervater und Schwiegersohn darin wetteiferten, wer die meisten Reliquien geschenkt bekam oder sie gegen bare Münze erwarb. Denn schon bald entwickelte der dynamische Rudolf geradezu eine Sucht, die Gebeine, Zähne und Haare von echten, aber auch scheinbaren Heiligen nach Wien bringen zu lassen, ja seiner Tante übersandte er als Geschenk einen heiligen Zahn, an dem noch Blutspuren des einstigen Besitzers zu sehen waren. Geld und Gold waren in dieser Zeit offenbar weniger wichtig als die morschen Knochen der heiligen Verblichenen!
Obwohl es schien, dass Rudolf in verschiedenen Welten zu Hause war, so wirkte er doch auf seine Zeitgenossen keineswegs blass und blutleer. Der bekannte Chronist Heinrich von Dießenhofen berichtete über einen Besuch des Habsburgers am Oberrhein, dass der junge Herr eine beachtenswerte, weise Person sei, daneben großzügig, vor allem aber sei die Weisheit des 18-Jährigen bemerkenswert.
Wahrscheinlich setzte sich Rudolf schon sehr bald hohe Ziele, denn für ihn konnte es nicht angehen, dass Wien weit hinter Prag zurückstand und nicht einmal den Status eines Bistums hatte. Er musste es geradezu als Schmach empfunden haben, dass man dem Bischof von Passau unterstellt war. 1356, im gleichen Jahr, in dem Kaiser Karl IV. in der Goldenen Bulle die Reichsgesetze niederschreiben ließ, unternahm Rudolf die ersten Schritte, um die Stephanskirche, deren Bau sein Vater Albrecht II. begonnen hatte, in eine Kardinalskirche umzuwandeln. Natürlich war ihm bewusst, dass dies mit großen Schwierigkeiten verbunden sein würde, daher suchte er von allem Anfang an ein gutes Einvernehmen mit dem Papst. Um seine Frömmigkeit auch öffentlich auszudrücken, ließ er den Heiligen Vater wissen, dass er sein Geburtszimmer in der Hofburg zu einer Kapelle umgewandelt hatte, die allen Heiligen gewidmet wurde. Rudolf selber machte sich die Mühe, Regeln für den Gottesdienst in dieser Kapelle aufzustellen.
Rudolf war ganze 19 Jahre alt, als er die Herrschaft über Österreich, die Steiermark, Kärnten und die großen Gebiete im Westen übernahm. Dadurch, dass er von seiner Mutter das Elsass, Gebiete am Oberrhein, Schweizer Städte und kleinere Gebiete in Schwaben geerbt hatte, war er ständig gezwungen, unterwegs zu sein. Wie er all die Aufgaben, die auf ihn zugekommen waren, in den wenigen Jahren seiner Regierungszeit überhaupt bewältigen konnte, ist bis heute ein Rätsel, bedenkt man die schlechten Verkehrsverhältnisse, die Unbilden der Witterung, denen er auf seinen Reisen ständig ausgesetzt war, die Gefahren, die ihm von der Natur, aber auch von missliebigen Menschen drohten. Es war vielleicht seinem ausgleichenden Naturell zu verdanken, dass er sich zumindest im Westen einigermaßen Luft verschaffte, obwohl er schon als Reichslandvogt eine besondere Stellung auf dem Gebiet der Rechtsprechung vom Kaiser einforderte. Aber Karl IV. sah wahrscheinlich zunächst mit mildem Auge auf den hochaktiven Schwiegersohn und ließ ihn schalten und walten, wie dieser es für richtig hielt. Denn es grenzte in der damaligen Situation beinah an ein Wunder, dass sich Rudolf mit den Schweizern, namentlich mit der Stadt Luzern friedlich einigte, sodass sich in den Städten keine nennenswerte Opposition breitmachte. »Stadtluft macht frei«, so dachten viele bettelarme Bauern, die unter der Leibeigenschaft stöhnten und die ihr Glück in der Stadt versuchten. Der Reichslandvogt galt als Freund der Schweizer, der Waffengewalt verabscheute und in seiner Position als Vertreter des Kaisers zum Wohl der Bürger Recht sprach. Schon bald machte sich das Gerücht breit, Rudolf wäre »ain frommer weiser Herr, ein gotliebender, frommer Fürst« und ein »fridlicher Herr«, für einen jungen Mann ganz ungewöhnliche Attribute. Aber für Rudolf galt in den ersten Jahren seiner Regentschaft die Devise, dass die weltlichen Fürsten nur Glieder eines Hauptes, des Kaisers, wären. Ihre Aufgabe sah er darin, in den ererbten oder erworbenen Ländern Ruhe und Ordnung zu halten.
Auf allen Gebieten schien Rudolf seiner selbst gestellten Aufgabe nachgekommen zu sein, denn zur Verwunderung aller ließ er eine 1425 Meter lange Brücke über den Zürichsee in Rapperswil in nur zwei Jahren erbauen. Damit hatte er Verbindungsmöglichkeiten in die Schweiz geschaffen, die nicht nur den Rapperswilern zugutekamen, sondern die ihn von Zürich unabhängig werden ließen. Geschäftstüchtig, wie er war, veranlasste er auch sofort, dass die Brücke nur nach Entrichtung einer Maut betreten werden durfte, wobei Reiter zwei Pfennige, die Viehhändler und Kaufleute etwas weniger zu zahlen hatten, damit der Handel nicht beeinträchtigt wurde. Die Brückenmaut sollte für den Bau der Burg verwendet werden, die er prunkvoll ausstatten ließ.
Rudolf war ein Regent, der sein Auftreten in der Öffentlichkeit zelebrierte, vielleicht auch im Hinblick auf seinen übermächtigen Schwiegervater in Prag. Er imponierte damit allen, die ihm begegneten, vor allem weiten Teilen des reichsunmittelbaren Adels, den er ganz auf seine Seite zog. In den Trinkstuben entstanden überall Rittergesellschaften, die voll des Lobes über den jungen Herrscher waren. Rudolf war in seiner unwahrscheinlichen Dynamik ein Mann, der in vielerlei Hinsicht die Jugend anzog, der es meisterlich verstand, nach außen hin seine Position kundzutun. Schon im Jahr 1359 ließ er ein neues Siegel entwerfen, auf dem zu lesen war: »Rudolf, von Gottes Gnaden, des Heiligen Römischen Reiches Erzjägermeister und Erstgeborener des Herzogs Albrecht und der Herzogin Johanna.« Dieses Siegel, das auch auf der Gegenseite und an den Rändern mit Titeln versehen war, wurde erstmalig bei der Erhebung von St. Stephan zur Probstei im Jahre 1359 verwendet.
Später allerdings, als Rudolf durch sein von ihm in Auftrag gegebenes Privilegium maius den Bogen überspannte, verlangte Kaiser Karl IV. von ihm, dass der Titel des Herzogs von Schwaben und Elsass aus dem Siegel entfernt werde.
Auch dem Titel »des Heiligen Römischen Reiches Erzjägermeister« war nur ein kurzes Leben beschieden, obwohl Rudolf sich vielleicht auf das Amt des Jägermeisters als Herzog von Kärnten berufen konnte, da die Kärntner in früheren Zeiten für den Kaiser die Jagd auszurichten hatten. Aber was für Karl IV. zu viel war, das war eben zu viel! Wenngleich Rudolf auch sehr geschickt seine Vorrechte begründet hatte, indem er auch den Kärntner Herzogstuhl umbauen ließ, um zu zeigen, dass hier schon seit alters her Geschichte gemacht worden war. Er versuchte nicht nur nachzuweisen, dass der erste römische Kaiser ein gewisser Julius gewesen war, der vom Rhein nach Rom gekommen war, sondern ging noch weiter in der Geschichte zurück, sodass beinah Adam und Eva die Stammeltern der Habsburger gewesen sein könnten. Auch für seine Schöpfung, die Zackenkrone fand er eine plausible Begründung, wobei dies alles nur Äußerlichkeiten waren. Denn die wichtigsten Punkte des gefälschten Privilegiums waren außerordentliche Rechte, die dem Herzog von Österreich angeblich zugebilligt worden waren: »Ganz gleich, was der Herzog von Österreich in seinen Ländern und Gebieten macht oder anordnet, weder der Kaiser noch eine sonstige Macht darf das auf irgendeine Weise oder auf irgendeinem Wege künftig irgendwie verändern.«
Unabhängigkeit von Entscheidungen im Reich, freies Schalten und Walten in den habsburgischen Ländern, freie Gerichtsbarkeit und das Erbrecht auch in der weiblichen Linie waren die wichtigsten Punkte, die Rudolf durch dieses Privileg festgeschrieben haben wollte, das sich in einigen der 18 Punkte auf das im Jahre 1156 von Kaiser Friedrich Barbarossa erlassene Privilegium minus bezog. Das war auch der Grund, weshalb Kaiser Karl IV., als der von ihm beauftragte Dichter Petrarca das ganze Machwerk als Fälschung identifizierte, nicht alles, was das neue – uralte – Privileg enthielt, in Grund und Boden verdammte. Natürlich konnte es nicht angehen, dass der Herzog in seinen Rechten dem Kaiser gleichgestellt wurde. Das war Karl IV. doch zu viel! Außerdem akzeptierte er niemals die Unabhängigkeit Österreichs vom Reich, ganz abgesehen davon, dass die Urkunden Caesars und Neros ihm wahrscheinlich nur ein Lächeln entlockten.
Den Titel Erzherzog durfte der Schwiegersohn in Hinkunft beibehalten, genauso wie er sich mit der zwölfzackigen Krone über dem Herzogshut hatte abbilden lassen. Das Bild Rudolfs, das um das Jahr 1364 entstanden sein dürfte, ist das zweite Porträt eines Herrschers.
Auch die Steinfiguren am Stephansdom und die Plastiken über dem Kenotaph, die Rudolf und seine Gemahlin Katharina darstellen, sind mit dieser Zackenkrone geschmückt. Vielfältig sind die Darstellungen des Herzogspaares am und im Stephansdom, Rudolf hatte schon zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass sein Name als »Fundator« – als Gründer des Domes – nicht in Vergessenheit geraten werde. Allerdings ließ er vieles in seiner Geheimschrift anbringen, eine Sitte, die der Zeit entsprach, in der Fälschungen und Geheimschriften durchaus üblich waren. Irgendwie musste man sich vor nicht immer zuverlässigen Mitwissern schützen und da die Wahrheit in manchen Fällen selten an den Tag kam, schreckte man vor diversen Fälschungen nicht zurück. Bis heute ist nicht ganz geklärt, ob Margarete Maultasch in München tatsächlich ihre Länder den Wittelsbachern vermachen wollte oder nicht, denn bis in unsere Tage ist die Frage der Fälschung nicht geklärt.
Es war geradezu seltsam für einen so jungen Mann, dass er als er die Zwanzig kaum überschritten hatte, schon an seine sichtbare Präsenz nach seinem Tode dachte. Aber in Prag, wo er seinen Schwiegervater aufgesucht hatte, wahrscheinlich um neue Zugeständnisse zu erwirken, herrschte 1358 die Pest und das Memento mori war gleichsam an allen Ecken und Enden sichtbar. Sein Aufenthalt in der Stadt an der Moldau war nur kurz gewesen, anscheinend hatte das einst gute Verhältnis zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn schon einen Riss bekommen, denn Karl, der in Rudolf eventuell seinen Nachfolger als Kaiser gesehen hatte, kamen nun doch Zweifel an seinen Vorstellungen für die Zukunft, vor allem als Rudolf den Wunsch äußerte, vom Kaiser den Titel eines Königs der Lombardei übertragen zu bekommen.
Für die Position Rudolfs im Reich wäre diese Ehre eine ungewöhnliche Aufwertung gewesen, was natürlich auch Karl IV. bekannt war. Längst war aber seine Beziehung zu seinem Schwiegersohn dermaßen abgekühlt, dass er keine Veranlassung sah, Rudolf mit der eisernen Krone der Langobarden, die freilich eine Imitation war, die einst Heinrich VII. hatte herstellen lassen, zu krönen.
Rudolf und der Kaiser schieden im Streit, etwas, das eigentlich nicht verwunderlich war, bedenkt man, dass beide äußerst dynamische Herrscher waren, von denen der jüngere als Herzog von Österreich gegenüber dem Kaiser freilich die schlechteren Karten haben musste. Daher versuchte jeder, seine Hausmacht durch Eheschließungen oder Bündnisse zu erweitern. Karl streckte seine Fühler nach Ungarn aus, verheiratete nicht nur seine erst dreijährige Tochter Margarete mit dem späteren Ludwig I. von Anjou, er selber reichte in seiner dritten Ehe der Schwester des ungarischen Königs die Hand für ein kurzes gemeinsames Leben. Karl wusste, was er tat, denn der ungarische König war nicht nur ein verlässlicher Partner im Osten Österreichs, er war auch Anwärter auf den polnischen Thron. Und sollte es das Schicksal wollen, so könnte es durchaus sein, dass sich das Luxemburger Einflussgebiet weit in den Osten hinein erstrecken würde …
Rudolf hatte andere Pläne. Er hatte darüber nachgesonnen, auf welche Weise er dem Kaiser wirklich schaden konnte. Und da Fälschungen für ihn eine besondere Herzensangelegenheit waren, griff er auch in diesem Fall wieder zu einer List. Am 20. Juli 1359 tauchte plötzlich ein angeblich vom Freisinger Bischof Paul von Jägerndorf verfasster Brief an die römische Kurie auf, in der die Absetzung des Kaisers gefordert wurde und Ludwig von Ungarn zum Gegenkönig ausgerufen werden sollte, von dem sich Rudolf trotz der umgekehrten verwandtschaftlichen Beziehungen Vorteile erhoffte.
Auch diese Sache verlief im Nichts, sodass Rudolf andere Ideen durch den Kopf gingen. Schon sein Vater hatte sich mit der leidigen Tiroler Angelegenheit befasst und versucht, von Papst Innozenz VI. die Lösung des Bannes, der über dem Tiroler Landesfürstenpaar schwebte, zu erreichen. Knapp vor dem Ziel starb Albrecht II. Sein Sohn Rudolf sprang für ihn sofort in die Bresche, denn immerhin konnte es sein, dass die Habsburger einmal die lachenden Erben Tirols sein würden, da Margarete Maultasch und ihrem zweiten Ehemann Ludwig von Brandenburg nur der ungewöhnlich schwächliche Sohn Meinhard beschert war, der mit einer Tochter von Herzog Albrecht II., also mit einer Schwester Rudolfs, verheiratet war. Daher war es für Rudolf unendlich wichtig, die Tiroler Angelegenheit so bald wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Er selbst ritt nach Salzburg, um Ludwig von Brandenburg zu treffen, als der Papst signalisiert hatte, dass er eventuell bereit war, den Bann zu lösen, wenn Margarete und Ludwig sich bereit erklärten, die Bedingungen die Innozenz in finanzieller und materieller Hinsicht stellte, zu erfüllen. Rudolf stellte sich als Bürge für die Einhaltung der Gelöbnisse zur Verfügung. Und nachdem in München die Ehe, die Margarete und Ludwig kirchenwidrig im Jahr 1342 geschlossen hatten, durch Kommissare getrennt wurde, fand am nächsten Tag in der Münchner Burg die neuerliche Trauung feierlich statt. Das Brautgeschenk war allerdings nicht für das Brautpaar bestimmt, Margarete unterzeichnete als Erbin Tirols eine Vermächtnisurkunde zugunsten der Habsburger! Ob und wie weit der Kanzler Rudolfs Johann Ribi von Lenzburg, Bischof von Gurk, die Hände mit im Spiel hatte und die Nachwelt wieder mit einer Fälschung konfrontierte, ist bis heute nicht bekannt.
So lang und so oft sich Rudolf auf Reisen aufhielt, um die verschiedensten Angelegenheiten zu regeln, so viel gab es für ihn in Wien zu tun. Schon sein Vater Albrecht II. hatte mit dem Bau des Stephansdomes begonnen, jetzt war der Sohn an der Reihe, die große Aufgabe fortzuführen und wenn möglich zu vollenden. Und bereits zwei Jahre nach seinem Regierungsantritt konnte im Jahre 1340 mit einer feierlichen Zeremonie der Chor eingeweiht werden. Der Spatenstich zum Langhaus, das als Verbindung zu den schon bestehenden Teilen des Domes fungieren sollte, erfolgte allerdings erst 1359, weshalb Rudolf seine Vollendung nicht mehr erleben sollte. Der Bau schritt verhältnismäßig langsam voran, denn die Inschrift »Hic est sepultus dens dux Rudolfus fundator«, die nach dem frühen Tode des Herzogs in etwa zwei Metern Höhe in Rudolfs Geheimschrift angebracht war, deutet darauf hin.
Der Stephansdom stellte für den zielstrebigen Herzog geradezu ein Prestigeobjekt dar, er wollte unter allen Umständen ein geistiges Zentrum schaffen, das von jeglichen äußeren Einflüssen unabhängig sein sollte. Vor allem durfte das Bistum Passau keine wie immer geartete Rolle mehr in Wien spielen. Deshalb beauftragte Rudolf mit beinah hellseherischen Fähigkeiten seine Brüder, nach seinem überraschenden Tod den Bau fertigzustellen. Er ruhte nicht, bis der neue Papst Urban V. sich endlich im Jahre 1364 herbeiließ, die Stephanskirche zur Kollegiatskirche zu erheben, wobei das Kapitel aus 24 Chorherren und 26 Kaplänen bestehen sollte. St. Stephan wurde ab dieser Zeit als »Tumkirche« also als Dom bezeichnet, dem ein Probst im Rang eines Fürsten vorstand. Rudolf selbst, aber auch seine Gemahlin Katharina, seine Schwester Katharina und sein Bruder Albrecht unterzeichneten die Stiftungsurkunde. Natürlich war der Bischof von Passau keineswegs erfreut über diese Entwicklung in Wien, entgingen den Passauern jährliche Einnahmen in nicht unbeträchtlicher Höhe. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als gute Miene zum – wie er meinte – abgekarteten Spiel zu machen.
Es war auch äußerst schwierig, sich dem dynamischen jungen Mann, der vor Ideen nur so sprühte, in den Weg zu stellen und der in seiner tiefen Religiosität eines der bedeutendsten Klöster in Österreich gründete, nämlich Melk an der Donau und es mit vielen Sonderrechten, welche es jahrhundertelang behalten sollte, ausstattete. Und mancher Zeitgenosse traute wahrscheinlich seinen Augen nicht, mit welcher Energie der junge Herzog alles vorantrieb und welcher persönliche Elan vor allem hinter der Bautätigkeit steckte. Dabei achtete Rudolf streng darauf, dass die Bauten, die im Entstehen waren, nicht nur zweckdienlich, sondern auch kunstvoll ausgestattet waren. Und damit er als Laie nicht alles akzeptieren musste, was ihm die Handwerker vorschlugen, ließ er sich angeblich in die Zunft der Steinmetzen und Bauleute aufnehmen. Der Herzog setzte alles daran, aus Wien eine Stadt zu machen, die in keinerlei Hinsicht Prag nachstand, wo die berühmtesten Meister ihrer Zeit, wie die bekannten Brüder Parler, im Auftrag des Schwiegervaters ihre Kunstwerke schufen. Aus der bisher einfachen, unansehnlichen Stadt schuf Rudolf eine Kunst- und Kulturstadt, in der sich über 35 Kirchen und 25 Hauskapellen befanden – ein enormer Schatz, hält man sich die bescheidene Größe des damaligen Wien vor Augen! Auch Dichter und Philosophen entdeckten Wien, denn hier, so merkte man bald, regierte ein Mann, der Kunst und Wissenschaft in jeder Hinsicht förderte, auch schon vor der Gründung der Universität.
Dass es Rudolf IV. gelingen konnte, die nach ihm benannte Alma Mater ins Leben zu rufen, wurde von ihm gut vorbereitet. Denn die Voraussetzungen waren durch die zahlreichen »Vorschulen«, neben den kirchlichen Hauslehranstalten, die die Stadt beherbergte, auf alle Fälle gegeben. Nur durch sie konnten genügend Lehrer und Professoren für die Universität gefunden werden. Allerdings war sich Rudolf, der gewohnt war, sich eingehend zu informieren, darüber im Klaren, dass nicht nur sein Wille die Entscheidung herbeiführen würde, sondern auch der Papst einverstanden sein musste, da nur der Heilige Vater verschiedene Privilegien vergeben konnte. Da aber Papst Urban V. zu Ohren gekommen war, dass der junge Heißsporn auf dem österreichischen Herzogstuhl Steuerprivilegien des Klerus drastisch beschnitten hatte, war er nicht besonders gut auf Rudolf zu sprechen. Die Abgaben, die der Klerus in Hinkunft zu leisten hatte, empörten nicht nur den Heiligen Vater, auch die österreichische Geistlichkeit war dem Herzog keineswegs freundschaftlich gesinnt, ja man bezeichnete Rudolf sogar als »neuen Pharao«.
Rudolf ließ allerdings nicht locker. Im September 1364 schickte er Abgesandte nach Avignon, wo die Päpste zu dieser Zeit residierten. Es gelang ihnen, den Papst von Rudolfs lauteren Plänen zu überzeugen. Urban gab endlich den Weg frei für die Universität in Wien, die nach den Vorbildern Prag und Krakau mit vier Fakultäten – der theologischen, der medizinischen, der juristischen und einer Artistenfakultät – ausgestattet sein sollte. Rudolf hatte eingehend die Privilegien studiert, die Professoren und Studenten an den bestehenden Universitäten hatten, und kam zu dem Schluss, dass die geistige Elite der Stadt und des Landes in einem eigenen Viertel, wo sie einer speziellen Sozialordnung und einer gesonderten Rechtsprechung unterliegen, wohnen sollte. Schon auf der Anreise nach Wien garantierte der Herzog den Wissenschaftlern Freiheit und Schutz, außerdem wurde für sie ein eigenes Erbrecht geschaffen.
Der für die Welt der Wissenschaft und für die geistige Zukunft des Landes so ausschlaggebende Tag der Gründung war der Namenstag des Heiligen Gregors, der als Schutzpatron der Lehrer gilt. Die beiden Urkunden, von denen eine in deutscher und eine in lateinischer Sprache abgefasst ist, wurden von Rudolf und seinen beiden Brüdern Albrecht III. und Leopold III. unterzeichnet. Es war für die Zeit etwas ganz Besonderes, dass Rudolf die deutsche Sprache sowohl als Amts- als auch als Urkundensprache verwendete, was natürlich manchmal Probleme aufwarf, denn das Wort »Rektor« lässt sich nun einmal schwer ins Deutsche übersetzen. Der Herzog wählte für diesen Ausdruck die eher kuriose Bezeichnung »obrist Maister der egenannten Phaffheit«.
Erst am 18. Juni 1365 kam der endgültige Sanctus durch eine Bulle des Papstes, indem er die Gründung der Universität Wien genehmigte, zunächst allerdings ohne theologische Fakultät. Was der erst 26-jährige Herzog damals nicht ahnen konnte, war die traurige Tatsache, dass er die »Volluniversität« nicht mehr erleben sollte, da seine Tage bereits gezählt waren.
Ob Rudolf IV. in seiner nur siebenjährigen Regierungszeit, die angefüllt war von Reformen, der Umsetzung von zukunftsorientierten Ideen, mit Streitereien und Fälschungen, in der er rast- und ruhelos versuchte, seine Ziele zu verwirklichen, ahnte, dass ihm nicht viel Zeit blieb, kann man nur vermuten. Denn auch die Sozialreformen, die er in Wien und in seinen Ländern durchführen ließ, waren von einer Schnelligkeit, die beinah unvorstellbar war. Überall, wohin er auf seinen Reisen kam, versuchte er der Wirtschaft Impulse zu geben, wobei er vor allem und immer wieder den Klerus im Auge hatte. Hier war auch für ihn Geld zu holen. Denn seiner Meinung nach hatte man schon zu lange den Besitz der »toten Hand« toleriert – Kirchenbesitz, der durch Schenkungen zustande gekommen war. Bis in seine Tage waren nämlich Klöster und Kirchen von jeglicher Steuer ausgenommen gewesen. Das sollte anders werden! Jetzt war unter ihm das Zeitalter der Geldwirtschaft angebrochen, er hatte die Münzprägung, die sein Vater Albrecht II. begonnen hatte, fortgeführt, sodass auch die Klöster Abgaben in Form von Goldgulden leisten mussten. Und um alles genau im Auge zu behalten, ließ Rudolf Grundbücher einführen, durch die die fälligen Zinssätze genau überprüft werden konnten, vor allem weil die Menschen plötzlich mobil geworden waren und vom Land in die Städte zogen, da sie sich hier mehr Möglichkeiten für ihr Fortkommen und vor allem mehr Schutz erhofften. Der Herzog hatte nämlich per Gesetz den einengenden Zunftzwang aufgehoben und eine Art Gewerbefreiheit eingeführt. Jeder sollte nach seinen Fähigkeiten den Beruf ausüben können, zu dem er sich befähigt fühlte. So modern diese Anschauung auch war, so stieß sie doch vonseiten der Handwerker vielfach auf Kritik, denn die etablierten Meister ihres Faches fürchteten die Konkurrenz, die von außen kam.
Aber Rudolf ließ sich in seinen Reformen nicht von Misstönen beirren: Er kümmerte sich selber um alles. Da er der Meinung war, dass Brot und Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln des einfachen Mannes gehörten, erließ er eine »Fleischhackerordnung« für die Stadt Wien, in der nicht nur der Ort des Schlachtens beim »roten Turm«, sondern auch die Entsorgung der Abfälle direkt in die Donau festgelegt wurden.
Natürlich stammten die Ideen für diese revolutionierenden Neuerungen nicht alle von Rudolf selber: Tüchtige Berater, von denen der hochintelligente Bischof von Gurk eine besondere Stellung einnahm, unterstützten den Herzog in seinem Tun. Außerdem hatte Rudolf in seinem Schwiegervater einen genialen Lehrmeister, sodass er sich vielfach an der Umsetzung der modernen Zeitströmungen am Prager Hof orientieren konnte. Auch die Verordnungen der Stadt Nürnberg enthielten für den Herzog zukunftsweisende Ideen, die ins Konzept des Habsburgers hervorragend passten.
Natürlich brauchte der Herzog wie alle Herrscher zu jeder Zeit Geld, um alles, was ihm vorschwebte, in die Tat umsetzen zu können. Und da durch eine gewaltige Naturkatastrophe in der Silbergrube in Zeiring in der Steiermark der Geldhahn plötzlich abgedreht war, musste Rudolf eine neue Einnahmequelle finden. Er brauchte nicht lang zu suchen, denn die Idee lag für ihn auf der Hand: Er erließ auf alle Getränke, die in Gaststätten konsumiert wurden, eine Art Getränkesteuer in Höhe von zehn Prozent, das sogenannte »Ungeld«, das natürlich bei seinen trinkfreudigen Wienern nicht allzu beliebt war. Aber der Herzog war in dieser Hinsicht gnadenlos, er gab sogar – um auf Nummer sicher zu gehen – Order, das Öffnen der Fässer zu überwachen. Selbst in der Dichtung der Zeit findet das Ungeld seinen Niederschlag, wenn Peter Suchenwirt folgende Zeilen verfasste:
Den Ungelt auf den Weinen
Lat ab durch ewer edel Zucht …
Der gemeine Fluch pringt lützel Frucht.
Die Einnahmen aus dem Ungeld waren beträchtlich: 30 563 Pfund flossen in die Kassen des Herzogs, was einem Silberwert von achthundert Kilo entsprach. Jetzt konnte Rudolf Münzen mit seinen Initialen prägen lassen, die in allen seinen Ländern, von der ungarischen Grenze bis ins Elsass, allgemeine Gültigkeit haben sollten.
Geprägtes Geld hatte längst überall Eingang gefunden, wobei das Verleihen größerer Beträge in den Händen der Juden lag, denn es war einem Christen nicht erlaubt, Zinsen zu nehmen. Man war wohl gezwungen, Geld zu leihen, wenn es aber an die Rückzahlung ging, bezeichnete man die Juden als Wucherer und verfolgte sie. Obwohl Rudolf so wie seine Vorgänger immer noch gewisse Ressentiments gegenüber den Juden hatte, verhielt er sich ihnen gegenüber loyal, wenngleich er auch nicht alle Kredite, die er aufgenommen hatte, zurückzahlte. Aber er bemühte sich wenigstens um ein friedliches Nebeneinander, sodass sich die Juden bei Streitigkeiten vertrauensvoll an den Herzog wandten, denn es war bekannt, dass er nach jüdischem Recht sein Urteil fällte.
Nachdem sich Rudolf mit seinem Schwiegervater nach etlichen schweren Konflikten ausgesöhnt hatte, legte er sein Hauptaugenmerk auf die an seine Länder angrenzenden Gebiete in Oberitalien, vor allem auf das Friaul, wo es immer wieder zu Kämpfen kam. Vielleicht war Italien wirklich das Land seiner Sehnsucht, denn Rudolf ließ sich hier auch aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen zu dem dubiosen Herzog von Mailand Bernabò Visconti in alle möglichen Bündnisse hineinziehen. Bernabò war ein gefährlicher Machtmensch, der eine Unzahl von unehelichen Kindern besaß, die er standesgemäß verheiraten wollte. Jede der Töchter der »Viper von Mailand«, wie Bernabò aufgrund seines Wappentieres genannt wurde, brachte 10 0000 Gulden mit in die Ehe. Eine Tatsache, die vielleicht den Bruder Rudolfs IV. besonders lockte, denn Leopold III. feierte mit Viridis in Mailand eine glanzvolle Hochzeit. Die Hofhaltung Bernabòs beeindruckte die habsburgischen Herzöge zutiefst. Leopold galt zwar sicherlich nicht als besonders attraktive Partie, wenngleich er aufgrund der habsburgischen Hausordnung von 1355 theoretisch die gleichen Rechte wie seine Brüder Rudolf IV. und Albrecht III. haben sollte. Papier war auch damals schon geduldig, denn Rudolf verstand es sehr geschickt, seine Position als Ältester auszunützen, obwohl er anscheinend in diesen Jahren schon von Todesahnungen geplagt war. Da man Jahrhunderte später bei einer Öffnung seines Sarkophags stark verwachsene Schädelknochen feststellte, ist anzunehmen, dass er an einem Hirntumor litt, der sein Gesicht lähmte. Daher regelte er nicht nur seine Nachfolge, sondern setzte noch alles daran, Margarete Maultasch zu überzeugen, dass sie ein reichliches Ausgedinge in Wien finden würde. Rudolf selber holte die Fürstin von Tirol nach dem Tod ihres einzigen Sohnes ab und brachte sie nach Wien. Die jugendliche Witwe Meinhards III. von Tirol Margarete, eine Schwester Rudolfs, musste auf Geheiß des Bruders den abgelegten ehemaligen Ehemann ihrer Schwiegermutter Margarete Maultaschs, Johann von Böhmen, heiraten und verzichtete damit auf Tirol.
Es war wahrscheinlich dem Einfluss Rudolfs, der den Beinamen »der Stifter« nicht zu Unrecht verdiente, zuzuschreiben, dass allmählich auch die Wittelsbacher sich mit der neuen Situation in Tirol abgefunden hatten und ihre Kämpfe einstellten. Wie allerdings die Zukunft ausgesehen hätte, wäre der Herzog nicht für viele überraschend in Mailand am 27. Juli 1365 gestorben, stand in den Sternen. Denn auch im Westen waren die habsburgischen Gebiete abgerundet, sodass einem einheitlichen Staat nichts mehr im Wege gestanden hätte.
Der geniale Mann, dem vom Schicksal nur 26 Lebensjahre vergönnt waren, hinterließ keinen Erben, obwohl seine Ehe anscheinend nicht unglücklich gewesen war. Denn seine Witwe Katharina, die von ihrem Vater Kaiser Karl IV. gezwungen worden war, schon ein Jahr nach dem Tod Rudolfs den unfähigen, unattraktiven Markgrafen von Brandenburg Otto V., den Faulen, zu heiraten, beschloss nach dem Tod dieses Mannes im Jahr 1379 wieder nach Wien zurückzukehren, wo sie in Perchtoldsdorf am 26. April 1395 als alte Frau kinderlos starb. Sie wurde neben ihrem ersten Gemahl Rudolf im Stephansdom beigesetzt.
Die Trauer um den allseits tätigen, gerechten Herzog war in seinen Ländern groß. Angeblich kochte man die Leiche Rudolfs in Mailand in Rotwein, um seine sterblichen Überreste besser nach Wien bringen zu können. Man wickelte die Knochen in eine Ochsenhaut, über die man einen kostbaren persischen Mantel breitete. So wurde er in der Fürstengruft unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. Als man 1739 den Sarkophag öffnete, fand man auf dem Skelett liegend ein Kreuz mit einer Inschrift, einen goldenen Ring und ein doppelschneidiges Schwert, nicht viel von einem genialen Mann, der Überzeitliches geschaffen hatte.