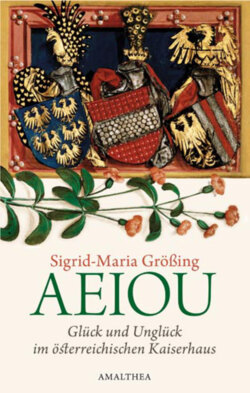Читать книгу AEIOU - Sigrid-Maria Größing - Страница 6
Eine Schlacht auf Leben und Tod begründete die habsburgische Weltmacht RUDOLF VON HABSBURG UND SEINE SÖHNE
ОглавлениеDüster und wirr war die Zeit, in die der älteste Sohn von Rudolf von Habsburg Albrecht hineingeboren wurde, hoffnungslos und ohne Zukunft. Die Welt schien aus allen Fugen geraten zu sein, niemand fand etwas dabei, Recht und Ordnung mit Füßen zu treten, sodass der Schrecken der Fehde allerorts das menschliche Leben verunsicherte. Der Nachbar misstraute dem Nachbarn, der Lehensherr verlangte rücksichtslos von seinen Bauern weit mehr als den Zehent, der Ritter versuchte, so gut es ihm möglich war, seine Burg vor den Übergriffen bewaffneter Meuten, die planlos im Reich herumzogen, zu schützen. Denn nicht allzu viele waren von den Kreuzzügen ins Heilige Land nach langer Abwesenheit als reiche Leute nach Hause zurückgekehrt, die Zahl der mittellosen Ritter übertraf sie bei weitem. Sie waren ohne Hoffnung in ein Reich heimgekommen, das ihnen keine Sicherheiten mehr bieten konnte. Und so nimmt es einen nicht wunder, dass so mancher sein Glück selber in die Hand nehmen wollte und sich auf eigene Faust zu bereichern suchte. Die Raubritter, die das Land verunsicherten und den Handel an manchen Orten zum Erliegen brachten, waren erfinderisch, wenn es galt, einen Weg zu finden, um an besonders verlockende Beute heranzukommen. So sperrten sie mit Ketten die Donau ab oder überfielen ahnungslose Kaufleute auf die verwegenste Art und Weise. Um irgendwie noch Handel betreiben zu können, war man gezwungen, sich zu Handelskarawanen zusammenzuschließen, um sich so gegen die Überfälle verteidigen zu können. Denn einen Kaiser, der bis dahin einigermaßen für die Sicherheit im Lande gesorgt hatte, gab es nicht mehr, dafür hatte der Papst in all seiner Grausamkeit gesorgt. Karl von Anjou, der zu dieser Zeit auf dem Stuhle Petri saß, hatte den letzten Staufer, den romantischen Jüngling Konradin, der voller Enthusiasmus und Träumen nach Süden gezogen war, um die Krone seiner Väter zu erringen, nach der verlorenen Schlacht bei Tagliacozzo auf der Flucht gefangen nehmen und zusammen mit zwölf Getreuen in Neapel am 29. Oktober 1268 grausam hinrichten lassen. Voller Genugtuung registrierte Karl den Sieg über das den Päpsten so verhasste Geschlecht der Staufer.
Der 16-jährige Konradin hatte keine Nachkommen hinterlassen. Die »kaiserlose, die schreckliche Zeit« hatte begonnen, denn plötzlich stand man im Reich vor einem absoluten Nichts. England und Frankreich waren zunächst sofort zur Stelle und wollten einen ihrer Favoriten auf den deutschen Kaiserthron setzen; Richard von Cornwall hieß der Auserwählte des englischen Königs, während der französische König Alfons von Kastilien favorisierte. Im Reich selbst kümmerte sich niemand darum, wer wohl das Rennen um die Krone Karls des Großen machen würde oder machen sollte. Denn hier bestimmten Fehden landauf, landab das Geschehen. Jeder wollte sich auf Kosten der anderen bereichern und sich eine möglichst große Hausmacht schaffen. Nicht eine zentrale Macht wie bisher erschien nunmehr für das Land erstrebenswert zu sein, man wollte einen möglichst schwachen Herrscher küren, damit er von allen Seiten abhängig und beeinflussbar sein würde.
Da sich die Zustände im Reich immer mehr verschlechterten und man allgemein zu der Ansicht kam, dass es so nicht weitergehen konnte, ergriffen die sieben Kurfürsten die Initiative. Sie schauten sich nach einem geeigneten Mann um, der die deutsche Krone tragen sollte. Die drei Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier gehörten diesem Kur-Kollegium genauso an, wie der Pfalzgraf bei Rhein, der Markgraf von Brandenburg, der Herzog von Sachsen und der mächtige König von Böhmen. Letzterer wäre sofort gewillt gewesen, die schwere Bürde auf sich zu nehmen, die ein König in dieser Situation akzeptieren musste. Denn der neue Herrscher sah keiner leichten Zukunft entgegen, darüber waren sich alle einig.
So mancher erblickte in dem jungen Böhmenkönig Přemysl Ottokar II. tatsächlich den richtigen Mann, der mit starker Hand das Wirrwarr im Reich entflechten würde.
Und wie es schien, deutete alles auf eine Wahl dieses dynamischen, aktiven Mannes hin, der schon in den Babenberger Ländern im Osten des Reiches bewiesen hatte, dass er mit seinen politischen Konzepten zum Wohle der Bevölkerung zu handeln fähig war. Und wo er nicht auf Einsicht der Bevölkerung gestoßen war, hatte er Gewalt sprechen lassen. Schon waren die meisten Kurfürsten geneigt, Ottokar ihre Stimme zu geben, als im letzten Augenblick die Stimmung im Kurkollegium plötzlich umschlug und die Kurfürsten sich für einen anderen Kandidaten entschlossen. Wahrscheinlich war es einerseits die Macht, die der junge Ottokar schon jetzt in Händen hatte, die die Wahlmänner davon Abstand nehmen ließ, ihn auch noch zum König zu wählen, andererseits könnte auch das dubiose Privatleben des jungen Böhmen für seine Ablehnung eine Rolle gespielt haben.
Denn Ottokar war auf allen Gebieten ein Glücksritter, nicht nur, was seine politische Position betraf. Er hatte als ganz junger Mann um die Hand der alternden Babenberger-Erbin Margarete angehalten und diese allein stehende Frau, die Witwe des ehemaligen deutschen Kaisers Konrads IV., mehr oder weniger gezwungen, seine Frau zu werden. Dabei spielten weder Zuneigung noch Liebe eine Rolle – der junge Ottokar hätte gut und gerne der Sohn seiner Gemahlin sein können –, sondern einzig und allein ihre Länder übten einen Reiz auf den besitzgierigen Böhmenkönig aus. Denn Margarete war nach dem frühen Tod ihres Bruders, Friedrichs des Streitbaren, der in der Schlacht an der Leitha im Kampf gegen die Ungarn gefallen war, zu einer reichen Erbin geworden. Diese Situation war für die Babenbergerin nicht vorhersehbar gewesen. Nach dem frühen Tod ihres Mannes Konrad und ihrer Kinder hatte sie vor Jahren, entmutigt wie sie war, den Schleier genommen und ein Gelübde abgelegt, dass sie den Rest ihres Lebens in stillem Gebete hinter Klostermauern verbringen wollte. Niemals wieder, so hatte Margarete geschworen, wollte sie einem Manne angehören.
Margarete hatte für sich zwar eine Entscheidung getroffen, doch geriet sie als Erbin der weiten österreichischen Gebiete, die noch dazu unmittelbar an die böhmischen Länder angrenzten, ins Blickfeld von Přemysl Ottokar, der seine Fühler nach allen Seiten hin ausgestreckt hatte, um seinen Machtbereich zu erweitern. Deshalb warb er mit der ganzen Dynamik seiner Jugend um die vergrämte Witwe, schlug all ihre Argumente, warum sie ihn nicht erhören konnte, in den Wind und schließlich war es Margarete nicht mehr möglich, die Werbungen des Böhmen abzuschlagen, wollte sie eine gewaltsame Übernahme ihrer Länder durch Ottokar verhindern.
Dass diese Ehe nur eine Farce war, das ahnten alle. Der junge Böhmenkönig holte sich auch bei der ersten sich bietenden Gelegenheit eine ganz andere Frau ins Bett. Ottokar hatte aus seinem Herzen noch nie eine Mördergrube gemacht und so gab er auch schon bald seine eigentlichen Absichten allgemein bekannt, da er sich in seiner Position sehr sicher fühlte. Doch hatte er nicht mit den moralischen Bedenken gerechnet, die plötzlich die anderen Kurfürsten ihm gegenüber geltend machten. Wahrscheinlich hätte man Kunigunde von Halicz, eine glutvolle, rassige Ungarin, als Geliebte Ottokars sogar noch in Kauf genommen, hätte er nicht begonnen, sich in aller Öffentlichkeit abfällig über seine alte, welke Gemahlin zu äußern, die nicht mehr in der Lage war, ihm einen Erben zu schenken. Vieles verzieh man in dieser Zeit redseligen, vom Wein berauschten Männern, nur schmähliche Worte über die Damen waren tabu. Zu sehr war man noch von den ritterlichen Idealen beeinflusst und geprägt, wo die »hohe« Frau eine besondere Stellung in der Gesellschaft eingenommen hatte, ja, sie war beinahe anbetungswürdig für den »minniglichen« Sänger und Ritter.
Es erwies sich für Ottokar in seiner Spontaneität und Unachtsamkeit als gewaltiger Fehler, sich über diese Tradition hinwegzusetzen. Er war nie ein Kind von Traurigkeit gewesen und seine Gastmähler und Zechgelage waren in ganz Böhmen berühmt, aber auch berüchtigt durch die lockeren Reden, derer man sich zu vorgerückter Stunde befleißigte. Der schwere Wein, der in Strömen floss, löste Ottokar die Zunge und er begann im Kreise seiner Zechkumpanen sich über die körperlichen Schwächen seiner Gemahlin Margarete lustig zu machen. Er wähnte sich in einer Runde von Freunden, vergaß dabei ganz, dass auch die besten Zechkumpanen diese lästerlichen Geschichten mit Genuss weiterverbreiteten. So nahm es einen nicht wunder, dass die abfällige Einstellung des Böhmenkönigs Margarete gegenüber schon bald die Runde im Reich machte, wobei etwas geschah, was sich Ottokar kaum hatte vorstellen können: Plötzlich nahm man innerlich Anteil am Schicksal seiner alten Gemahlin, man bedauerte die verhärmte Frau, die vom Leben so hart geschlagen war, und so mancher nahm sich vor, ihr Schutz zu gewähren, wenn sie seinen benötigen sollte.
Der Augenblick kam früher, als man allgemein gedacht hatte: Als man nun daran ging, einen neuen König zu küren, stand den Kurfürsten das Verhalten Ottokars Margarete gegenüber mit einem Mal klar vor Augen. Und man kam zu dem Schluss, dass dieser Mensch, der seine eigene Frau nicht achtete, sicherlich nicht der richtige Mann auf dem deutschen Thron sein würde. Außerdem tauchten allenthalben noch andere Vorwürfe gegen den Böhmenkönig auf. Eine Abordnung der steirischen Landstände war vorstellig geworden und hatte sich über verschiedene Übergriffe von Seiten Ottokars und seiner Leute bitter beklagt, wobei natürlich die Abneigung der Steirer gegen alles Böhmische im Vordergrund stand. Denn nach anfänglichem freundlichem Verhalten des Adels in den österreichischen Ländern hatten verschiedene tief greifende, soziale Maßnahmen, die Ottokar in den babenbergischen Ländern größtenteils zum Wohle der Bevölkerung durchgeführt hatte, die Stimmung von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil umschlagen lassen. Man verstand die großen Konzepte nicht, die Ottokar durchführen wollte. Nach einer Bergwerkskatastrophe im steirischen Oberzeiring hatte der Böhmenkönig nicht nur den Auftrag gegeben, die mittellosen Witwen und Waisen der Bergleute zu versorgen, sondern auch eine Art Sozialversicherung eingeführt, die die Bevölkerung vor Armut und Not bewahren sollte. Natürlich mussten dabei die Wohlhabenden etwas von ihrem Reichtum zugunsten der Mittellosen abgeben, was den Zorn der Adelsschicht hervorrief. Es konnte nicht ausbleiben, dass die Mundpropaganda, die durchs ganze Land ging, nichts unterließ, was den Böhmenkönig schlecht machen konnte. Und schon bald war man der einhelligen Meinung: Was hatte ein Fremder, ein Böhme, in den babenbergischen Ländern eigentlich verloren?
Warum sich die anderen sechs Kurfürsten dem Vorschlag des Erzbischofs von Mainz und des Burggrafen von Nürnberg anschlossen und sich für die Wahl des Grafen Rudolf von Habsburg entschieden, der in den Augen des reichen Böhmenkönigs mit dem Nimbus eines Bettelgrafen versehen war, hatte vielfältige Gründe und Hintergründe. Kaum war die Wahl bekannt gegeben worden, ließ Přemysl Ottokar nichts unversucht, um den neu ernannten König in jeder nur möglichen Hinsicht zu schmähen.
Aber die Wahl war entschieden und am 29. September 1273 hatte man endlich einen neuen König: Rudolf von Habsburg.
Auch Papst Gregor X. war mit der Wahl des Aargauer Grafen einverstanden, nicht nur weil diesem der Ruf der Gottesfürchtigkeit, der Redlichkeit und der Welterfahrenheit vorauseilte. Entscheidend war für den Papst die Tatsache, dass Rudolf über keine allzu große Macht verfügte und deswegen immer wieder auf die Hilfe und das Wohlwollen anderer angewiesen sein würde. Dies würde dem Heiligen Vater eine Fülle von Möglichkeiten bieten, sich in die politischen Angelegenheiten des Reiches einmischen zu können.
Dass Rudolf von Habsburg, nachdem er die Wahl angenommen hatte, in dem jungen Böhmenkönig von vornherein ein unversöhnlicher Feind entstanden war, darüber war er sich von Anfang an im Klaren. Denn Ottokar war alles andere als gewillt, den Anordnungen und Aufforderungen des neuen deutschen Königs nachzukommen. Er ignorierte die Einladung zum Nürnberger Gerichtstag, wo er aus der Hand König Rudolfs seine Lehen in Empfang nehmen sollte. Als alle Großen des Reiches ihre Plätze eingenommen hatten, blieb der Stuhl König Ottokars leer. Rudolf überlegte nicht lange und tat, was er tun musste: Er verhängte über den Böhmenkönig die Reichsacht und ein Jahr später die Aberacht, allerdings ohne Ottokar besonders zu beeindrucken. Jeder andere wäre vor der Strafe der Reichsacht zurückgeschreckt, denn dies bedeutete nichts anderes, als dass der Betroffene für vogelfrei erklärt wurde. Aber keiner wagte es, irgendwelche Schritte gegen Ottokar zu unternehmen, denn er hätte sich die fatalen Folgen eines solchen Tuns genau ausrechnen können. Denn die harten Maßnahmen, mit denen Ottokar seine Feinde bekämpfte, steigerten sich von Jahr zu Jahr. Er duldete in seinen Ländern, und als solche bezeichnete er auch die österreichischen und steirischen, keinen wie immer gearteten Widerstand. Was konnte ihm der »kleine Graf« mit seiner lächerlichen Hausmacht, der plötzlich König geworden war, denn schon wirklich anhaben? Nie und nimmer würde Rudolf gegen ihn, den Herrn im Osten, wirkliche Chancen haben, dessen war er sich absolut sicher. Sollte es wider Erwarten doch zu einem bewaffneten Konflikt kommen, so würde er Rudolf schon zeigen, wie die wahren Machtverhältnisse verteilt waren.
Natürlich war auch Rudolf von Habsburg Realist genug um zu wissen, dass er allein gegen den mächtigen Böhmen nichts ausrichten konnte. Er war auf die Unterstützung der Großen im Reich angewiesen. Nur mit ihrer Hilfe würde er Schritte gegen den aufmüpfigen Böhmen unternehmen können. In langen Unterredungen unterbreitete er jedem Einzelnen seinen ausgeklügelten Plan, wie er Ottokar zur Vernunft bringen wollte. Dabei trat ein, was Rudolf gar nicht zu hoffen wagte: Immer mehr Angehörige des Adels und der hohen Geistlichkeit stellten sich auf seine Seite und bestärkten ihn in seinem Unterfangen. Außerdem schloss Rudolf ein Bündnis mit den Ungarn, die dem Böhmen schon lange nicht sehr freundschaftlich gesonnen waren. Die Lage für Ottokar wurde allmählich prekär, da er erkennen musste, dass er langsam, aber sicher eingekreist wurde.
Přemysl Ottokar war kein Fantast, der die Wirklichkeit nicht erkennen konnte oder wollte. Er merkte, dass sich die Karten in seiner Hand gegenüber dem deutschen König von Tag zu Tag verschlechterten, deswegen beschloss er, vorübergehend das Spiel aufzugeben. Er signalisierte, dass er gewillt sei, seine Länder Böhmen und Mähren als Lehen aus der Hand des deutschen Königs anzunehmen und auf die österreichischen Länder zu verzichten.
So recht glaubte keiner im Reich an die Unterwürfigkeit des Böhmenkönigs. Allgemein vermutete man eine Finte Ottokars, wodurch Rudolf in Sicherheit gewiegt werden sollte. Denn einen echten Gesinnungswandel traute man dem hinterlistigen Böhmen nicht zu. Und die Zweifler sollten sich nicht irren. Denn während Ottokar sich aller Welt gegenüber friedlich zeigte, rüstete er mit großer Umsicht und Konsequenz sein Heer auf. Eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den beiden ungleichen Männern schien unausweichlich zu sein.
Offizieller Grund für den Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den beiden Königen war das Verhalten Ottokars seiner Gemahlin Margarete gegenüber, das der sittenstrenge Habsburger in keiner Weise akzeptierte. Die geschmähte Königin hatte sich an ihn gewandt und als deutscher König fühlte er sich verpflichtet, Beschützer der Witwen und Waisen, der Armen und Schwachen zu sein. Er konnte daher nicht die Augen verschließen, wie König Ottokar Margarete behandelte. Dazu kam, dass der Böhmenkönig nach wie vor in den österreichischen und steirischen Gebieten herrschte, auf die er nach der Trennung von Margarete keinen Anspruch mehr hatte.
Es war alles andere als ein beeindruckendes Heer, eher ein bunt zusammengewürfelter Haufen, mit dem Rudolf von Habsburg die Donau hinunterzog, aber je weiter er nach Osten kam, desto mehr Männer schlossen sich ihm an, denn viele setzten Hoffnungen in den neuen König. Endlich war einer gekommen, der einen vertrauenerweckenden Eindruck machte und der es vielleicht schaffen würde, die verloren gegangene Ordnung im Reich wiederherzustellen. Übermächtig schien das Heer Ottokars, rekrutiert aus allen möglichen Volksstämmen, doch die wenigsten zogen freiwillig in den Krieg. Man hatte die Taglöhner und Bauern beinahe mit Gewalt hinter ihrem Pflug hervorgeholt und sie zu den Waffen gezwungen. Daher war die Kampfesmoral innerhalb der einzelnen Truppenteile alles andere als hoch.
Am 26. August 1278 kam es in Niederösterreich zwischen den beiden Orten Dürnkrut und Jedenspeigen zur Schlacht der großen Kontrahenten. Und was niemand erwartet hatte, war, dass der Böhmenkönig nicht nur die Schlacht und damit die babenbergischen Länder verlor, sondern auch sein Leben.
Nachdem endlich das stundenlange verbissene Gemetzel in der glühenden Augustsonne aufgehört hatte und der Kampf entschieden war, gab Rudolf von Habsburg den Befehl, das Schlachtfeld abzusuchen, um den Überlebenden Hilfe zukommen zu lassen. Dabei machte man eine schaurige Entdeckung: Inmitten seiner verblutenden Soldaten lag der erschlagene Böhmenkönig. Dabei sind sich die Chronisten bis heute noch nicht einig, ob er tatsächlich in der Schlacht gefallen oder aus Privatrache ermordet worden war. Rudolf hatte vor Beginn des Kampfes an seine Leute die Weisung ausgegeben, das Leben des Böhmenkönigs zu schonen. Aber was niemand voraussagen konnte, geschah wahrscheinlich hinter dem Rücken Rudolfs: Als Přemysl Ottokar die Aussichtslosigkeit seiner Lage erkannt hatte, gab er den Befehl zum Rückzug. Auch er selbst versuchte zu entkommen, wurde aber höchstwahrscheinlich von einem Verwandten Seyfrieds von Merenberg gestellt und mit dem Schwert erschlagen.
Es waren rein private Motive, die zu dieser Tat geführt hatten, denn der Merenberger war vor nicht allzu langer Zeit von Ottokar bezichtigt worden, Umsturzpläne ausgearbeitet zu haben. Aus diesem Grunde hatte man ihn ins tiefste Verlies geworfen und in aller Heimlichkeit auf Anordnung des Böhmenkönigs ohne Prozess getötet. Dabei hatte sich Ottokar nicht nur eines vermeintlichen Revolutionärs entledigt, sondern auch den sehr unangenehmen Nebenbuhler aus dem Weg räumen lassen. Der attraktive Mann hatte es gewagt, der Geliebten Ottokars, Kunigunde, schöne Augen zu machen, etwas, was den Böhmenkönig aufs äußerste erregte.
Für Rudolf von Habsburg war die Auseinandersetzung mit Přemysl Ottokar zunächst nur ein Kampf um das Recht gewesen. Unmittelbar nach der Schlacht auf dem Marchfeld nördlich von Wien empfing Rudolf Margarete, um deren Ehre er gekämpft hatte. Aus ihren Händen empfing er das babenbergische Erbe, die Länder an der Donau und in der Steiermark. Plötzlich hatte sich sein Besitz um riesige Gebiete erweitert, die allerdings von seinen Stammlanden weit entfernt lagen, aber in ihrer Bedeutung seinen eigenen Ländern gleichkamen.
Das habsburgische Heer nahm die Verfolgung der Gegner bis weit nach Böhmen hinein auf. Schon bald aber musste man erkennen, dass beide Seiten kriegsmüde geworden waren und sich das Blutvergießen nicht mehr auszahlte. Die leidgeprüfte Bevölkerung hörte voller Freude endlich die Friedensglocken läuten. Man feierte nicht nur das Ende der Kämpfe, es zeichnete sich auch noch ein neuer Lichtstreifen am Horizont ab: Zur endgültigen Aussöhnung zwischen dem Habsburger und den Böhmen schloss man einen Heiratsvertrag, wobei der zweitgeborene Sohn Rudolfs, der den gleichen Namen wie der Vater trug, die Tochter von Přemysl Ottokar, Agnes, ehelichen sollte und die Tochter Rudolfs, Guta, den böhmischen Thronerben Wenzel.
Der Friede zwischen den Familien schien gesichert, und da sich die bedeutendsten Reichsfürsten nicht in die Kämpfe zwischen dem Habsburger und dem Böhmen eingemischt hatten, konnte Rudolf jetzt ohne große Probleme mit den österreichischen und steirischen Ländern schalten und walten, wie er wollte. Dazu kam, dass es ihm im Westen gelungen war, verschiedene Landstriche durch Kauf zu erwerben, um so seine Hausmacht auch hier zu erweitern.
Weihnachten 1282 war für König Rudolf von Habsburg ein ganz besonderes Fest. In einer feierlichen Zeremonie belehnte er seine beiden älteren Söhne Albrecht und Rudolf »zur gesamten Hand« mit Österreich, Steiermark und Krain. Er hatte die Vorstellung, dass die beiden Brüder diese Gebiete gemeinsam verwalten und beherrschen sollten. Schon bald zeigte sich aber, dass es ein Ding der Unmöglichkeit war, die Länder gemeinsam zu regieren. Zu unterschiedlich waren die Auffassungen und Vorstellungen von Albrecht und Rudolf. Daher entschloss sich der Vater, König Rudolf, nach langen Beratungen und Überlegungen, sich an die sieben Kurfürsten zu wenden, um ihr Einverständnis zur Änderung der seinerzeitigen Bestimmungen zu erlangen.
Zu Rudolfs Überraschung trat das Unerwartete ein: Die Kurfürsten gaben ihren Sanctus für eine Alleinregierung Albrechts, was im Vertrag von Rheinfelden, den man am 1. Juni 1283 unterzeichnete, offiziell dokumentiert wurde. Auch die österreichischen Ministerialen entschlossen sich, dem Vertrag zuzustimmen. Allerdings bereuten sie schon nach kurzer Zeit diesen voreiligen Schritt. Damit der Frieden zwischen den Brüdern und deren Familien erhalten blieb, sollte Rudolf für seine verloren gegangenen Rechte eine große Summe als Abfindung und Entschädigung erhalten, eine Bestimmung, die allerdings zunächst nur auf dem Papier bestand und die man nicht sonderlich genau nahm. König Rudolf konnte damals noch nicht ahnen, dass gerade dieser Passus in den Verträgen zwischen den Brüdern zu einer Katastrophe innerhalb der Familie führen sollte.
Albrecht erwies sich schon in jungen Jahren als starker Mann, der mit ungewöhnlichem Elan und Konsequenz vorging. Er war zusammen mit seinen neun Geschwistern in einer harmonischen Familie im Aargau aufgewachsen, liebevoll betreut von der Mutter Gertrud von Hohenberg. Als zweites Kind seiner Eltern 1255 geboren, war ihm mehr als die übliche standesgemäße Erziehung zuteil geworden. Denn genauso wie seine Brüder und Schwestern lernte er nicht nur lesen und schreiben, er wurde auch in der lateinischen Sprache instruiert, wodurch ihm die Welt der Antike eröffnet wurde. Wenig Wert wurde allerdings auf das Erlernen der französischen Sprache gelegt, was für Albrecht später von Vorteil gewesen wäre. Wie alle adeligen Knaben zu dieser Zeit wurde auch Albrecht in die große Palette der ritterlichen Tugenden eingeweiht, sodass er schon sehr bald überall, wohin er kam, durch seine ungewöhnlich sorgfältige Erziehung auffiel. Von der Mutter hatte er einen gewissen Hang zum Übersinnlichen geerbt. Gertrud befragte immer wieder Leute, von denen sie annahm, dass sie mit überirdischen Wesen in Kontakt stünden, über die Zukunft ihrer Familienmitglieder. Und vieles, was ihr vorhergesagt worden war, soll auch eingetreten sein. So war ihr prophezeit worden, dass sie königliche Würden zu erwarten hätte, wenn sich ihr Gemahl vor Sünden hütete. Mit Sünden waren in der damaligen Zeit Übergriffe auf das Kirchengut gemeint. Rudolf hatte die Zeichen der Zeit verstanden und ließ tatsächlich seine Hände von geistlichen Besitztümern. Gertrud war stets eine Frau des Ausgleiches gewesen, die man wegen ihres mildtätigen Wesens besonders schätzte. So soll sie auch nach Aussagen von Zeitgenossen das Purpurtuch gestiftet haben, mit dem man den nackten, von Wunden entstellten Körper König Přemysl Ottokars bedeckt hatte.
Die Gemahlin König Rudolfs liebte ihre Heimat über alles, entschloss sich aber doch ohne langes Zögern, mit ihrer Familie nach Osten zu ziehen, um hier ihrem königlichen Gemahl näher sein zu können. Ab 1277 lebte sie in Wien, in einer für sie völlig fremden Umgebung. In ihrem Edelmut bedachte sie aber nicht, dass sich sowohl Rudolf als auch ihre Söhne und Töchter nur für kurze Zeit in Wien aufhielten, sodass sie die meiste Zeit allein in der düsteren Burg saß. Ihre einzige Freude war ihre Tochter Clementia, mit der sie sich ausgezeichnet verstand. Als dieses Mädchen, das ihrem Herzen so nahe stand, heiratete, verfiel Gertrud immer mehr in Schwermut. Im Jahre 1281 starb sie vor lauter Gram um den Verlust der Tochter, wollte man den zeitgenössischen Gerüchten Glauben schenken.
Rudolf, der seine Gemahlin ein Leben lang geliebt hatte, tröstete sich für einen alternden Mann überraschend schnell. 1284 ging er mit 66 Jahren zur Überraschung aller eine zweite Ehe ein, durch die er letztlich zum Gespött im Reich wurde. Er führte die erst 14jährige Agnes (Isabella) von Burgund zum Traualtar, wobei er nicht frei von politischen Hintergedanken war: Er vermeinte durch diese Eheschließung Burgund und damit Frankreich näher an das Reich binden zu können. Seine Hoffnungen erwiesen sich als trügerisch, denn plötzlich machten sich im Westen antihabsburgische Tendenzen bemerkbar, die vor allem von der Stadt Bern geschürt wurden. Die Schweizer traten zum ersten Mal vehement gegen die Habsburger auf und sollten ihre Ressentiments diesem Herrschergeschlecht gegenüber in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr abbauen.
Die junge Königin wurde schon bald zu einer Krankenschwester degradiert, die jedoch kaum von der Seite ihres Gemahls wich. Als König Rudolf sein Ende nahen fühlte, beschloss er nach Speyer zu ziehen, in die Stadt, in der die großen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Am 15. Juli 1291 starb der erste habsburgische König und hinterließ seinem ältesten Sohn eine schwere Erbschaft.
Noch zu seinen Lebzeiten war der Vater stets bemüht gewesen, Albrecht alle Wege zu ebnen. Als der Sohn noch in den Kinderschuhen steckte, machten sich die Eltern darüber Gedanken, wen er als seine Braut zum Altar führen sollte. Dabei war nicht nur die Herkunft des Mädchens von Bedeutung, Rudolf erkannte so wie seine Nachfahren in späterer Zeit, dass eine ansehnliche Mitgift für das zukünftige Glück seines Sohnes mindestens genauso interessant war wie das Aussehen der Braut. Albrecht zählte noch keine zehn Jahre, als ein erster Heiratsvertrag mit Graf Theobald von Bar geschlossen wurde. Die Tochter des Grafen Jolante sollte die Gemahlin Albrechts werden. Dabei setzte man den Tag als Hochzeitsdatum fest, an dem beide das zehnte Lebensjahr überschritten hatten.
Diese Kinderhochzeit kam allerdings nicht zustande. Warum dieser Heiratsplan platzte und Albrecht nicht Jolante, sondern die Tochter Meinhards von Tirol, Elisabeth, ehelichte, ist nicht genau bekannt. Der neue Schwiegervater war ein reicher und mächtiger Mann, dessen Einfluss überall zu spüren war. Würde Albrecht doch einst durch die verwandtschaftlichen Beziehungen enge Verbindung zu den wichtigen Ländern Tirol, Görz und Kärnten bekommen. Es gab für König Rudolf wahrscheinlich noch andere Hintergründe, seinen ältesten Sohn mit Elisabeth von Görz-Tirol zu verheiraten. Denn die Braut konnte mütterlicherseits auf eine hohe Verwandtschaft blicken, ihre Mutter Elisabeth war immerhin eine Halbschwester des letzten Hohenstaufen, des unglücklichen Konradin.
1274 wurde die Ehe geschlossen, die mit einer riesigen Kinderschar gesegnet war. Elisabeth brachte 21 Söhne und Töchter zur Welt, von denen allerdings zehn im Kindesalter starben. Die übrigen elf erwiesen sich als politisches Heiratsgut, denn die Eltern trachteten darnach, sie bestmöglich und Gewinn bringend zu verheiraten, wie dies später auch Maria Theresia im Brauch hatte.
Albrecht hätte keine bessere Wahl treffen können, denn Elisabeth unterstützte in ihrer klugen Art ihren Mann, wo sie nur konnte. Sie führte in ihrer Ehe nicht ein Schattendasein, wie es einer Frau dieser Zeit entsprochen hätte, sondern stand an der Seite ihres politisch kraftvollen Mannes im Lichte der Öffentlichkeit. Albrecht hatte schon sehr bald erkannt, welch wichtige Ratgeberin er in Elisabeth gefunden hatte, und übertrug ihr so manche, oft brisante politische Aufgabe, die sie trotz ihrer ständigen Schwangerschaften zu seiner vollsten Zufriedenheit löste. In vielerlei Hinsicht wirkte sie ausgleichend und beruhigend und versuchte immer wieder die Härten zu mildern, zu denen sich Albrecht in seiner impulsiven Art hatte hinreißen lassen.
Elisabeth musste eine starke Frau gewesen sein, physisch und psychisch, die trotz der Unbilden der Zeit sich mit voller Kraft behaupten konnte. Sie überlebte, wie kaum eine andere Gemahlin eines Herrschers, 21 Entbindungen, etwas, was bei den medizinischen und hygienischen Verhältnissen der Zeit an ein reines Wunder grenzte. Mutlosigkeit und Resignation waren für sie fremd, denn auch nach der schrecklichen Ermordung ihres Gemahls resignierte sie nicht, sondern setzte alles daran, dass seine Mörder zur Verantwortung gezogen würden.
Vieles im Leben hatte Albrecht beeinflusst, nicht nur die höfischen Sitten des Rittertums, auch das »moderne« Leben in den allmählich entstehenden Städten blieb nicht ohne Wirkung auf den jungen Habsburger, obwohl man sich von Seiten der Stadtbevölkerung noch redlich bemühte, das adelige Leben auch innerhalb der Stadtmauern zu kopieren. Nach wie vor spielten die Dichter und Sänger eine überragende Rolle, waren sie es doch, die in ihrer Welterfahrung die alten kulturellen Errungenschaften von Burg zu Burg getragen hatten. Hoch geehrt und gefördert zogen sie auch jetzt noch durch die Lande und verbreiteten in ihren Liedern die tragische Kunde vom Untergang des letzten Staufers.
Diese Geschichte musste auf den jungen Albrecht eine ganz besondere Wirkung gehabt haben. Sein Vater hatte Kaiser Friedrich II. noch persönlich gekannt und hatte den Kindern von seiner faszinierenden Persönlichkeit erzählt. Die hoch begabten Söhne dieses Kaisers und ihr bemitleidenswertes Schicksal standen ihm während seiner Kindheit deutlich vor Augen und auch die Rolle, die der Papst in der Tragödie um den letzten Staufer Konradin gespielt hatte, blieb ihm nicht verborgen. Viele Gedanken beschäftigten den jungen Mann und dann und wann überfielen ihn ernsthafte Zweifel, ob er die Aufgabe, die auf ihn zuzukommen schien, Herrscher über das Reich zu sein, würde erfüllen können. Denn am Beispiel seines Vaters hatte er die wechselhafte Haltung der Kurfürsten studieren können und dabei mit offenen Augen beobachtet, wie undurchsichtig politische Beschlüsse sein konnten, von wie vielen Faktoren sie abhingen.
Und jetzt – nach dem Tod seines Vaters – bekam er dieses Ränkespiel am eigenen Leibe zu spüren. Plötzlich dachte niemand mehr an gegebene Versprechungen, seine Wahl zum König war umstritten. Dabei hatte Albrecht in vielerlei Hinsicht bewiesen, dass er trotz seiner jungen Jahre ein durchaus tatkräftiger Mann war, wichtige Entscheidungen nicht lange vor sich herschob, jedoch auch manchmal zu spontan agierte.
Albrecht hatte schon mit 19 Jahren in den Oberen Landen, dem eigentlichen Hausgut der Habsburger, Herrschaftsrechte ausgeübt, auch während der Zeit, als sein Vater im Osten gegen den Böhmenkönig gekämpft hatte. Es war, als wollte König Rudolf den Sohn nicht der Gefahr des Kampfes aussetzen, er brauchte ihn für wichtigere Aufgaben. Während sich auf dem Marchfeld zwischen Dürnkrut und Jedenspeigen die Zukunft des Hauses entschied, begann Albrecht in den ihm anvertrauten Gebieten die Verwaltung von Grund auf umzukrempeln. Nüchtern wie er war, erkannte er die Notwendigkeiten einer Neuordnung und veranlasste die Aufnahme eines Urbars der habsburgischen Hausgüter.
Nach den Wirren der »kaiserlosen Zeit« erschien es Albrecht vorrangig, ein geregeltes Leben für alle Teile der Bevölkerung zu ermöglichen. Dass dies nicht von einem Tag auf den anderen geschehen konnte, erkannte er schon bald, obwohl er in seiner Ungeduld am liebsten alles von heute auf morgen geändert hätte. Vieles, was aus früheren Zeiten überkommen war, musste modernen Einrichtungen weichen. Bei diesem groß angelegten zukunftsweisenden Reformwerk schuf er sich natürlich nicht nur Freunde. Es waren vor allem die Reichsfürsten, die mit Argusaugen die Aktivitäten Albrechts verfolgten. Da ihn der Vater im Jahr 1279 nach Österreich hatte kommen lassen, verlagerte sich sein Interesse und seine Tatkraft in dieses Gebiet. 1280 zog er offiziell als Sohn des deutschen Königs in Wien ein, das auf König Rudolfs Veranlassung hin wieder die für jede Stadt so bedeutungsvolle Reichsunmittelbarkeit erlangt hatte – ein Privileg, das verloren gegangen war und große Vorteile mit sich brachte. Reichsunmittelbare Städte unterstanden nur dem König oder Kaiser, von allen anderen Landesherren waren sie unabhängig.
Albrecht war ein moderner junger Mann, der im Westen die Möglichkeiten wahrgenommen hatte, von Stadt zu Stadt zu ziehen und sich mit den Einrichtungen innerhalb der Stadtmauern vertraut zu machen. Es war etwas durchaus Neues, was in allen Teilen des Landes im Entstehen begriffen war. Denn immer mehr hatte sich in den letzten Jahrzehnten abgezeichnet, dass sich die Menschen in einer größeren Gemeinschaft sicherer fühlten, vielleicht hatten sie auch zunehmend Schutz in den wirren Jahren des ausgehenden 13. Jahrhunderts gesucht. Daher waren überall im Land größere Ansiedelungen entstanden, die man mit Mauern und Gräben umgab, ähnlich den beinahe uneinnehmbaren Burgen, mit einem zentralen Brunnen mitten im Ort. Es waren noch keine großen Städte, aber sie hatten ihre eigenen Rechte und Privilegien. So erreichte so mancher, dem es gelungen war, seinem Lehensherrn zu entkommen, nach einem Aufenthalt von einem Jahr und einem Tag in der Stadt die Freiheit, denn »Stadtluft macht(e) frei«.
Freilich unterschieden sich die Städte damals noch kaum von größeren Dörfern, denn nach wie vor bauten die Menschen ihr Gemüse vor dem Haus an und hielten sich in den Ställen, die neben den Häusern erbaut waren, ihre Tiere. Hygiene gab es so gut wie keine, da man alles, was man nicht mehr brauchen konnte, einfach aus den Fenstern warf, hinunter in die schmalen Gassen, wo sich mit der Zeit der Unrat in Bergen auftürmte und man daher vor bestialischem Gestank kaum atmen konnte. Nur wenn hoher Besuch angesagt war, ging man daran, die Gassen zu säubern oder Stege zu bauen, damit die Gäste nicht im stinkenden Morast versanken. Um halbwegs trockenen und sauberen Fußes von einem Teil der Stadt in den anderen zu gelangen, legten die Bewohner der Häuser auch große Strohballen vor die Türe. Das Bild der einzelnen Städte war nicht sehr unterschiedlich, in Wien sah es nicht viel anders aus als in den Städten am Oberrhein oder in Schwaben.
Es war vielleicht einzig und allein die Lage der Stadt an der Donau, die Wien zu einem bevorzugten interessanten Ort im Osten von Österreich werden ließ. Schon sehr bald hatte man dieser Stadt besondere Vorrechte eingeräumt, die Albrecht zunächst auch zur Gänze anerkannte, aber es dauerte nicht allzu lang, da waren ihm die einzelnen Verordnungen, auf die sich die Bürger bei den verschiedenen Gelegenheiten stützten, ein Dorn im Auge, da sie seinen Plänen hinderlich waren. Ohne lange zu zögern widerrief Albrecht daher alle möglichen Vergünstigungen, auch das Privileg der Reichsunmittelbarkeit. Die Empörung der Wiener war grenzenlos. Man hielt es kaum für möglich, dass der Sohn König Rudolfs, dem man mit herzlicher Zuneigung entgegengekommen war, mit derartiger Härte vorging. Aber schon in Albrechts Augen glaubte man die kalte Energie erkennen zu können, mit der er alles durchzusetzen trachtete, was er sich vorgenommen hatte. Die Wiener hatten allerdings kaum Zeit, über den Charakter des neuen Herzogs nachzudenken, denn schon holte er zum nächsten Schlag aus: Stadtrat und Bürgerschaft wurden mit aller Nachdrücklichkeit aufgefordert, den Treueid zu erneuern und mussten schwören, jeder geheimen oder öffentlichen Vereinigung zu entsagen. Dazu kam noch, dass von ihnen verlangt wurde, von sich aus offiziell auf die Reichsunmittelbarkeit zu verzichten.
Am härtesten trafen diese Verordnungen die Angehörigen der oberen Schichten, die sich um ihre Rechte betrogen sahen, während die Handel- und Gewerbetreibenden in dem neuen Herrn eher einen Garanten für ihre Sicherheit sahen. Dies führte zu einer Spaltung der Wiener Bevölkerung, in der die »Gewandschneider unter der Lauben« eine besondere Rolle spielten.
Die Revolte gegen die neuen einengenden Gesetze, die in Wien 1288 von einem unversöhnlichen Mann namens Paltram angezettelt worden war, konnte von Albrecht ohne große Schwierigkeiten niedergeschlagen werden. Der Kleinkrieg innerhalb der Wiener Bevölkerung hatte ihm die Sache wesentlich erleichtert.
König Rudolf hielt sich in dieser Situation, in die er eigentlich als oberste Instanz hätte eingreifen müssen, relativ bedeckt. Er ließ seinen Sohn schalten und walten, wahrscheinlich vertrat er die Ansicht, dass Albrecht mit Wien und den Wienern selber fertig werden musste …
Und Albrecht löste diese schwere Aufgabe: Was so mancher Pessimist unter der Wiener Bevölkerung nie für möglich gehalten hätte, trat ein: Albrecht verlieh Wien überraschenderweise im Jahre 1297 ein neues, umfangreiches Privilegium, das bis 1526 Geltung haben sollte und das die Grundlage für ein geregeltes Leben in der Stadt für die Zukunft bildete.
Der Herzog war ein glänzender Organisator. Er hatte schon bald erkannt, dass es ihm unmöglich sein würde, alle Probleme, die auf ihn zukamen und mit denen er sich zwangsläufig beschäftigen musste, selbst lösen zu können. Einerseits war er zu wenig Experte, andererseits fehlte ihm die Zeit, um sich manchmal auch mit Kleinigkeiten zu befassen. Daher richtete er eine bestens funktionierende Kanzlei ein, die aus zwei Oberbeamten, dem Pronotar, einem Notar und einigen Schreibkräften bestand.
Diese Kanzlei, die die grundrechtlichen Fragen zu bearbeiten hatte, wurde in den einzelnen Landesteilen allerdings beinah mit scheelen Augen betrachtet. So mancher konservative Landesherr sah – wie sich herausstellen sollte, mit Recht – seine Machtkompetenz bedroht. Denn schon sehr bald war klar zu erkennen, dass Albrecht keine »fremden Götter« neben sich dulden wollte. Er war an einer starken Zentralgewalt interessiert und da war ihm jeder im Wege, von dem er annehmen musste, dass er andere, egoistische Ziele verfolgte. Auch die Männer, mit denen er sich umgab, zum Teil ausgesprochene Glücksritter, die in ihre eigene Tasche arbeiteten, trugen nicht dazu bei, den Herzog in den verschiedenen Ländern, die ihm unterstellt waren, beliebt zu machen. Diese Vertrauten des Herzogs maßten sich Rechte an, die ihnen nicht zustanden, die sie aber auf Grund der Unterstützung, die ihnen Albrecht angedeihen ließ, mit aller Härte einfordern konnten, wie der gewalttätige Abt Heinrich von Admont, der schon unter König Rudolf Karriere gemacht hatte und jetzt bis zum Landeshauptmann der Steiermark aufgestiegen war. Heinrich schreckte vor keiner Brutalität zurück und so konnte es nicht ausbleiben, dass so mancher, der durch den Abt geschädigt worden war, blutige Rache schwor. Heinrich gehörte dem geheimen Rat der »Heimlichen« an, einer kleinen Gruppe von Männern, die Albrechts ganzes Vertrauen besaß und die er auch, wo er nur konnte, mit seinem besonderen Schutz bedachte.
König Rudolf hatte große Pläne für seinen ältesten Sohn gehabt. Albrecht sollte nicht nur Nachfolger des Vaters als König im Reich werden, er sollte seinen Herrschaftsbereich auch noch nach Osten ausdehnen. Der junge Mann hatte sich schon in den grenznahen Gebieten zu Ungarn einen umstrittenen Namen gemacht, da er die Aufstände, die in der Gegend um den Neusiedler See und an der Leitha aufgeflammt waren, mit starker Hand niederschlug. Einige Burgen und Städte unterwarfen sich ihm, als sie erkennen mussten, dass sie keine andere Chance hatten.
Als der König von Ungarn Ladislaus IV. starb, übertrug Rudolf seinem Sohn 1290 in schriftlicher Form Ungarn als erledigtes Reichslehen, was sich allerdings als kurzlebige Episode erweisen sollte. Denn kaum hatte König Rudolf 1291 die Augen für immer geschlossen, als in allen Landesteilen der Aufstand gegen Herzog Albrecht ausbrach, in den Oberen Landen genauso wie in der Steiermark und Niederösterreich. Die Revolte hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, denn der Erzbischof von Salzburg hatte ebenso wie der Herzog von Bayern nichts Besseres zu tun gehabt als die Mundpropaganda gegen Albrecht zu schüren. Zudem unterstützten die Salzburger und Bayern die Steirer auch tatkräftig und es schien zunächst, als würde sich ein Flächenbrand im Osten ausbreiten.
Manch anderer hätte in dieser prekären Situation vielleicht klein beigegeben, nicht so Albrecht. Es war für ihn keine Frage, mitten im Winter 1292 gegen die rebellierenden Steirer vorzugehen, ein Unterfangen, von dem ihm alle abgeraten hatten, denn der tief verschneite Semmering galt beinah als unüberwindliches Hindernis. Aber er und seine Leute trotzten allen Gefahren bei tiefem Schnee und eisiger Kälte und es gelang ihm, die unbotmäßigen Steirer zu besiegen und in seine Abhängigkeit zu zwingen.
Dies wirbelte auch im Reich viel Staub auf. Der Charakter des jungen Herzogs wurde landauf, landab in den düstersten Farben geschildert und diese Kunde blieb auch den Kurfürsten, die sich nach dem Tode König Rudolfs zu einer neuen Wahl entschließen mussten, nicht verborgen. Ein starker Mann schien im Kommen und das war etwas, was eigentlich niemand wollte. Womöglich würde sich wieder das Erbkönigtum durchsetzen und damit die Position der Kurfürsten ad absurdum führen.
Es dauerte nicht lange, bis Albrecht von allen Seiten umzingelt war. Die Gegner des Habsburgers schlossen ein gefährliches Bündnis gegen ihn, dem nicht nur die deutschen Kurfürsten, die Könige von Ungarn und Böhmen, der Erzbischof von Salzburg, der Herzog von Niederbayern, der Graf von Savoyen, die Kirchenfürsten von Aquileia und Konstanz, die lombardischen Städte und die Eidgenossen, sondern auch Papst Nikolaus IV. angehörten. Die Situation für Albrecht schien beinahe aussichtslos, als der frisch gekürte ungarische König Andreas III. ein gewaltiges Heer gegen ihn aufstellte und in die angrenzenden Gebiete raubend und plündernd mit seinen Heerscharen einzog. Auch der Erzbischof von Salzburg hatte zu den Waffen gegriffen und versucht, einzelne Orte im Ennstal an sich zu reißen. Lediglich der König von Böhmen war von einem kriegerischen Vorgehen Albrecht gegenüber abzubringen gewesen, da seine Frau Guta, eine Schwester des Habsburgers, ihn dazu überredet hatte.
Albrecht konnte sich in dieser äußerst unangenehmen Lage nur auf einen einzigen wahren Freund verlassen, auf seinen Schwiegervater Meinhard II. von Tirol, der ihn, wo er nur konnte, unterstützte. Er hatte sich einen starken Verbündeten gewählt, denn Meinhard galt als Landesherr, der in der Auswahl seiner Mittel nicht gerade zimperlich war und deshalb, auch aus vielen anderen Gründen, des Öfteren mit dem Kirchenbann belegt worden war. Mit seiner Hilfe, die vor brutalen Aktionen nicht zurückschreckte, gelang es, der großen Gefahr Herr zu werden, wobei Albrecht klar erkannte, dass der Erzbischof von Salzburg nur durch Zugeständnisse zum Frieden bereit sein würde.
Obwohl er sich in den österreichischen Gebieten behauptet hatte, war es ihm nicht möglich gewesen, die Kurfürsten in ihrer Meinung ihm gegenüber umzustimmen. Sie blieben bei ihrer ablehnenden Haltung und wählten, teilweise aus rein egoistischen Gründen wie der Erzbischof von Köln im Jahr 1292 einen Mann, der sich ihnen gegenüber sehr willfährig erwiesen hatte: Adolf von Nassau, der im wahrsten Sinne des Wortes ein armer Graf war, wodurch er natürlich für die Großen im Reich in jeder nur möglichen Hinsicht erpressbar war.
Gespannt wartete man landauf, landab auf die Reaktion des Habsburgers, denn man war allgemein der Ansicht, dass Albrecht die Wahl Adolfs keineswegs anerkennen würde. Aber man schien sich zunächst getäuscht zu haben, wenn man geglaubt hatte, dass Albrecht sofort zu den Waffen greifen würde. Er überraschte alle, indem er sich entschloss, Adolf von Nassau zu huldigen und offiziell seine Länder als Lehen aus dessen Hand zu empfangen. Denn mit sicherem Instinkt hatte er erkannt, dass die Sympathie der Kurfürsten nicht allzu lange Adolf erhalten bleiben würden. Der Nassauer hatte nur zwei Möglichkeiten: Entweder er blieb Befehlsempfänger der Kurfürsten oder er machte sich daran, wie sein Vorgänger allmählich eine Hausmacht zu erwerben. Dabei boten sich für ihn die Gebiete in Thüringen und um Meißen an. Als die Reichsfürsten seine Bestrebungen erkannten, merkten sie sehr bald, dass sie den Teufel vielleicht mit dem Beelzebub ausgetrieben hatten. Genauso wie sie Adolf von Nassau gewählt hatten, ließen sie ihn fallen. Denn sie vertraten den Standpunkt, dass sie den von ihnen gewählten König ebenso absetzen konnten, wie sie ihn seinerzeit gekürt hatten. Es war das erste Mal, dass ein gewählter römischer König von den einstigen Wahlmännern abgesetzt worden war, ohne dass er mit dem Papst in Konflikt geraten und daher gebannt worden war.
Man trat erneut zur Wahl zusammen und jetzt geschah das, was sich Albrecht schon von allem Anfang an erhofft hatte: Sechs der sieben Fürsten wählten ihn als Gegenkönig, denn in ihm sah man plötzlich den starken Mann, der das Zeug zum König haben würde.
Dass Adolf von Nassau nicht von heute auf morgen die Flinte ins Korn werfen würde, war den Kurfürsten sehr bald bewusst geworden. Zunächst hatte man zwar geglaubt, dass er sich von einem König Albrecht abschrecken lassen würde, dessen Erfolge im Osten immer mehr Tagesgespräch geworden waren. Aber Adolf dachte nicht daran, klein beizugeben. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Reiterheere der beiden Kontrahenten standen sich eines Tages bei Göllheim in Rheinhessen gegenüber. Es war für Adolf ein Kampf auf Leben und Tod, in dem Albrecht als Sieger hervorging. Obwohl Adolf von Nassau heldenhaft um seine Königsehre kämpfte, konnte er nur noch tot vom Schlachtfeld getragen werden.
Nun galt es für Albrecht, alle Kurstimmen für sich zu gewinnen, um eine sichere solide Rechtsgrundlage für sein Königtum zu haben. Daher legte er seine Königswürde vorübergehend zurück, damit noch einmal eine offizielle Wahl abgehalten werden konnte. Endlich wurde er einstimmig zum deutschen König gewählt und feierlich am 24. August 1298, so wie es die Tradition vorschrieb, in Aachen gekrönt.
Viele neue Probleme stellten sich Albrecht I. in den Weg, unter anderem war seine Position der Kirche gegenüber schon lange sehr umstritten. Es war ihm ein Dorn im Auge gewesen, dass der Papst und die Kirche in der Vergangenheit zu einem derartigen Machtfaktor geworden waren, der über Sein oder Nichtsein der deutschen Kaiser entschied. Daher hatte er schon sehr früh begonnen, die angestammten Rechte der Geistlichkeit in seinen Ländern drastisch einzuengen, was sich natürlich auch bis nach Rom herumgesprochen hatte. Und hier saß zu dieser Zeit Papst Bonifaz VIII., ein unkonzilianter Machtpolitiker auf dem Stuhle Petri, der alles daran setzte, in der Politik des Reiches die erste Geige zu spielen. In Albrecht war ihm ein starker Kontrahent erwachsen, den es im Zaum zu halten galt.
Bonifaz war ein durch und durch gefährlicher Mann, der die Mittel und die Macht dazu hatte, auch einen König Albrecht zu stürzen. Öffentlich bezeichnete der Papst den deutschen König als Rebellen und Thronräuber, als Majestätsverbrecher und Kirchenverfolger und forderte ihn binnen sechs Monaten auf, Rechenschaft über seine Taten abzulegen. Sollte Albrecht diese Frist vorübergehen lassen, so würde Bonifaz nicht zögern, ihn mit dem Kirchenbann zu belegen, was für den König bedeutete, dass keiner seiner Untertanen mehr verpflichtet war, sich an seine Anordnungen zu halten.
Was der Papst in seiner Geiferei nicht bedachte, war, dass Albrecht durchaus in der Lage war, einerseits die Situation realistisch zu erkennen, in die er sich eventuell durch eine offizielle Konfrontation mit Bonifaz begeben würde, andererseits, dass der Habsburger über so viel diplomatisches Geschick verfügte, um sich dem Papst gegenüber demütig und untertänig zu zeigen. Bonifaz hatte daher seine Rechnung ohne Albrecht gemacht. Denn der veränderte seine Taktik von heute auf morgen und ging zum Erstaunen aller auf alles ein, was von ihm von Seiten der Kirche gefordert wurde, denn sein angestrebtes Ziel war es, durch den Papst in Rom zum Kaiser gekrönt zu werden. Er schickte Bonifaz zu seiner allgemeinen Rechtfertigung eine wohl berechnete Darstellung seiner Taten seit dem Tode seines Vaters und wandte sich gegen »unwahre, teuflische Gerüchte«, die überall über ihn kursierten. Um den Papst versöhnlich zu stimmen, löste er auch das Bündnis mit seinem Schwager, dem französischen König Philipp dem Schönen, da dieser mit dem Heiligen Stuhl in einem dauernden Kriegszustand lag.
Eigentlich hätten die Kurfürsten diese politische Loslösung von Frankreich mit Freude entgegennehmen müssen, denn es war das Gerücht gestreut worden, dass Albrecht die linksrheinischen Gebiete an Frankreich abtreten wollte. Als dieser fiktive Plan im Reich die Runde machte, hatten die Kurfürsten sofort laut ihr Veto vernehmen lassen und Albrecht vorgeworfen, familiäre Interessen über jene des Reiches zu stellen. Sicherlich waren diese Anschuldigungen nicht ganz aus der Luft gegriffen. Rudolf, der Sohn Albrechts, hatte nämlich Blanche von Valois geheiratet, eine Halbschwester des französischen Königs. Für Albrecht schien dieses Bündnis mit Frankreich in vielerlei Hinsicht interessant gewesen zu sein, da sich die Schweizer schon einige Zeit lang alles andere als freundlich verhielten. Eine Absicherung im Westen bedeutete für Albrecht eine gewisse Garantie für Stabilität in den nächsten Jahren.
Der Missmut der Kurfürsten dem neuen deutschen König gegenüber wuchs von Monat zu Monat. Denn es war unschwer zu erkennen, welche Hausmachtpolitik Albrecht unter dem Vorwand, das Beste für das Reich zu wollen, betrieb. Um in dieser Situation die Gemüter einigermaßen zu beruhigen, verlagerte Albrecht seine Expansionspolitik auf den Osten.
Zunächst hatte er die Absicht, Thüringen und Meißen für sich zu gewinnen, Gebiete, auf die seinerzeit auch Adolf von Nassau Anspruch erhoben hatte. Als aber der Widerstand allzu heftig wurde, richtete er seine Interessen ganz auf Böhmen und Ungarn. Die Könige dieser Länder waren durch verwandtschaftliche Beziehungen mit ihm verknüpft und er gab sich der Hoffnung hin, dass dadurch beide Länder einmal in den Besitz der Habsburger übergehen würden. Besonders begehrenswert erschien ihm Böhmen, da zu diesem Land auch noch weite Gebiete Polens gehörten. Als König Wenzel III. von Böhmen in ganz jungen Jahren völlig überraschend 1306 von einem Unbekannten in Olmütz ermordet wurde, stand Albrecht knapp vor dem Ziel. Es gelang ihm mit Hilfe seines Sohnes Rudolf, der mittlerweile Witwer geworden war, in Böhmen einzurücken und Rudolf, der die Witwe des Böhmenkönigs Wenzels II. geheiratet hatte, als böhmischen König auf dem Thron zu etablieren. Aber der Erfolg war nur von kurzer Dauer, denn schon im Jahre 1307 raffte der Tod Rudolf hinweg. Obwohl Albrecht alles daran setzte, seinen jüngeren Sohn Friedrich »den Schönen« an Stelle des Bruders als König zu inthronisieren, konnte er diesen Plan nicht mehr verwirklichen. Denn auch innerhalb der eigenen Familie wuchs der Unmut gegen ihn von Monat zu Monat, ohne dass er davon Notiz nahm. Die Verwirklichung der großen Aufgaben, welche er sich vorgenommen hatte, nahmen sein ganzes Denken und seine komplette Kraft in Anspruch, sodass er kaum merkte, wie sich die unzufriedenen Nachkommen seines Bruders gegen ihn formierten.
Das Hauptaugenmerk des Habsburgers galt von Anfang an – und das konnten die Kurfürsten nicht übersehen – in allererster Linie der Vermehrung seiner Macht und seiner Gebiete. Und je mehr Albrecht seine Vorstellungen durchsetzte, umso mehr fühlten sich die sieben Wahlmänner in ihrer Bedeutung eingeschränkt. Allmählich erkannten sie, dass es Zeit war zu handeln, wollten sie nicht gänzlich ins Abseits geschoben werden. Um Albrecht in die Schranken zu weisen, kam für sie nur eine Möglichkeit in Betracht, dieselbe, die sie seinerzeit schon Adolf von Nassau gegenüber angewandt hatten: Sie mussten die Absetzung König Albrechts offiziell bekannt geben.
Gründe für diesen Schritt ließen sich leicht finden, aber den Anlass zu dieser Aktion bot ihnen König Albrecht selbst: Denn völlig überraschend mischte er sich in die Erbstreitigkeiten in Holland, Seeland und Friesland ein. Der Regent dieser Gebiete war unerwartet kinderlos gestorben, und bevor noch andere ihre Hände nach diesen reichen Gebieten ausstrecken konnten, war Albrecht zur Stelle. Er sah die Stunde gekommen, seine Söhne mit diesen wirtschaftlich florierenden Gebieten zu belehnen. Die drei rheinischen Kurfürsten waren über diese Nacht-und-Nebel-Aktion, wie sie dies sahen, empört. Sie waren die Ersten, die im Jahre 1300 einen Bund gegen den König schlossen.
Aber Albrecht war alles andere als ein Mann, der sich durch derlei Maßnahmen einschüchtern ließ. Er hatte es im Laufe der Jahre gelernt, Tag und Nacht wachsam zu sein und rechtzeitig alle Hebel in Bewegung zu setzen, um unvorhergesehene Situationen zu bewältigen. Er wusste, wie er den Nerv dieser drei Kurfürsten treffen konnte. Dazu war es notwendig, die rheinischen Städte, die einen neuen Machtfaktor bildeten, auf seine Seite zu bringen. Er kündigte offiziell an, dass er die Absicht habe, die Rheinzölle aufzuheben, eine Maßnahme, die den Handel der Städte in vielerlei Hinsicht erleichtern würde. Die Städte erwiesen sich, wie es nicht anders zu erwarten gewesen war, als dankbar. In kürzester Zeit hatte er in ihnen nicht nur einen schlagkräftigen Bundesgenossen, sondern mit ihrer tatkräftigen Hilfe gelang es ihm auch, die Kurfürsten in die Schranken zu weisen.
Auch mit dem Papst zeichnete sich endlich eine Gesprächsbasis ab, nachdem Bonifaz lange gezögert hatte, den Versicherungen Albrechts Glauben zu schenken. Aber er hatte dem Heiligen Vater gegenüber durch seine Prokuratoren 1303 den Treue- und Gehorsamseid geleistet, wodurch dem Papst die Hände gebunden waren. Er konnte nicht anders, er musste Albrecht endlich als deutschen König anerkennen, wollte er nicht das Gesicht verlieren. Bonifaz machte – wenn auch sicherlich zähneknirschend – gute Miene zu diesem leicht durchschaubaren Spiel und schickte eine Einladung an Albrecht, zur Kaiserkrönung nach Rom zu ziehen.
Damit hatte Albrecht endlich, so wie es schien, alle Schwierigkeiten überwunden, endlich würde sein Traum in Erfüllung gehen. Er würde der erste Habsburger sein, der vom Papst in Rom gekrönt wurde. Aber bevor er noch den Romzug in allen Einzelheiten planen konnte, wurde Bonifaz, der auch innerhalb des Kardinalskollegiums auf Grund seines aufbrausenden, unberechenbaren Wesens umstritten war, bei einem Attentat so schwer verletzt, dass er innerhalb einer Woche starb.
Es war für Albrecht beinahe schicksalhaft, dass er oft knapp vor Erreichung seiner angestrebten Ziele durch Fügungen des Schicksals um den Erfolg betrogen wurde. Vielleicht trug auch so manches in seinem Wesen dazu bei, dass er nicht die Popularität seines Vaters erreichte. Obwohl Albrecht sich durchaus als umsichtiger König bewährte und vieles zum Wohle der Bevölkerung durchsetzte, ließen seine Gegner nicht davon ab, alle möglichen Gerüchte über ihn zu verbreiten, die ihn in Misskredit bringen sollten. Und da der einfache Mann im Volk den König nur ganz selten leibhaftig zu Gesicht bekam, glaubte er natürlich alle Schauermärchen, die über den König berichtet wurden. Denn Albrecht war in den Augen des Volkes ein »Gezeichneter«, der im Bund mit dem Bösen stand. Die Menschen der damaligen Zeit waren nicht in der Lage, körperliche Gebrechen als etwas Natürliches, Bedauernswertes anzusehen, sondern glaubten darin die Ausgeburt der Hölle zu erkennen.
Der König hatte sich im Jahre 1295 eine schwere Vergiftung zugezogen. Die näheren Umstände waren damals und sind auch heute unbekannt. Es konnte sein, dass die Köche des Königs nicht mehr ganz frische Zutaten verarbeitet hatten, oder aber hatte sich ein gedungener Mörder unter seine Leibköche gemischt und ihm in seine Speisen ein entsprechendes Mittel gemischt. Kurz nachdem Albrecht sein Mittagsmahl zu sich genommen hatte, wurde er von schweren Koliken befallen, deren Heftigkeit immer mehr zunahm, bis Albrecht schließlich das Bewusstsein verlor. Die eilig herbeigerufenen Ärzte waren sich in ihrer Diagnose uneins, als sie aber den beinahe leblos daliegenden König sahen, wandten sie purgierende und abführende Mittel an, um den besinnungslosen König wieder zu sich zu bringen. Als sie erkennen mussten, dass nichts mehr zum Erfolg führen würde, kam man auf die Idee, Albrecht an beiden Füßen verkehrt aufzuhängen, um den Körper zu zwingen das Gift von sich zu geben. Wie lange man den König so hängen ließ, ist nicht bekannt. Er kam wahrscheinlich während dieser unmenschlichen Prozedur zu sich, der übermäßige Druck aber zerstörte eines seiner Augen vollständig.
Der König, von dem die Mär gegangen war, er wäre tot, war ab dieser Zeit einäugig. Eine Tragik, die man ihm als Makel auslegte, und überall, wohin er kam, flüsterte man entsetzt: »Hütet euch vor dem Gezeichneten!«
Während König Albrecht sich mit neuen Plänen für die Festigung seiner Herrschaft im Westen beschäftigte und sich darüber Gedanken machte, wie er die Angehörigen der Eidgenossenschaft, in der sich einzelne Schweizer Orte zusammengeschlossen hatten, im Zaume halten konnte, da er erkannt hatte, dass diese Waldstättischen Schwurgenossen sich ihm gegenüber keineswegs freundschaftlich verhalten würden, traten schon die Männer zusammen, die seinen Tod bestimmt hatten. Rädelsführer war Albrechts eigener Neffe Johann, der Sohn seines früh verstorbenen Bruders Rudolf. Albrecht hatte zu diesem Neffen wahrscheinlich viel zu wenig Kontakt, als dass er erkennen konnte, wie zurückgesetzt sich dieser junge Mann fühlte. Obwohl er mit seiner Mutter aus dem Aargau nach dem Tod des Vaters nach Böhmen gezogen war, da seine Mutter eine Tochter von Přemysl Ottokar II. gewesen war, hatte er keine Chancen auf den böhmischen Königsthron, auf den er sich auf Grund seiner mütterlichen Verwandtschaft Hoffnungen gemacht hatte.
Johann kehrte ins Reich zurück und versuchte über einflussreiche Männer zu erreichen, dass ihm Albrecht wenigstens die seinem Vater in der »Rheinfeldner Hausordnung« zugesagte Entschädigung auszahlte. Aber auch davon wollte Albrecht nichts wissen. Möglicherweise hatte er ganz andere Pläne mit dem Neffen, denn er hatte ihn 1307 in den habsburgischen Stammlanden als Mitregent eingesetzt. Was er nicht ahnen konnte, war, dass diese Position dem erst 17-jährigen Johann, der von Ehrgeiz zerfressen Tag und Nacht darüber sinnierte, wie er zu Macht und Geld kommen konnte, zu wenig war. Die Aufgaben, die er hier im Aargau im Auftrag seines Oheims zu erledigen hatte, befriedigten seinen Ehrgeiz in keiner Weise. Er wollte mehr! Ohne vorherige Ankündigung verlangte er von Albrecht in barscher Form die Herausgabe des Witwengutes seiner Mutter, angestachelt durch die Ratschläge des Straßburger Bischofs Johann I., der das aufbrausende Naturell Johanns schon bald erkannt hatte und sich so vor einem unbeherrschten unmittelbaren Nachbarn schützen wollte.
Über die menschlichen Beziehungen zwischen dem König und seinem Neffen berichten die Chronisten der Zeit nichts. Wahrscheinlich hatte der König keine Ressentiments gegenüber Johann, sonst wäre er ihm nicht arglos begegnet. Denn Albrecht war keineswegs ein vertrauensseliger Mann, dazu hatte er im Laufe der bisherigen Jahre schon zu viel gesehen und erlebt. Aber Johann verstand seine Abneigung dem Oheim gegenüber geschickt zu verbergen und begegnete ihm unterwürfig, wenn man von Zeit zu Zeit zusammenkam, um die notwendigen politischen Maßnahmen für die nächsten Monate zu besprechen. Sicherlich gab Albrecht dem Neffen gute Ratschläge, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten sollte, und dieser heuchelte, alles zur vollsten Zufriedenheit des Königs ausführen zu wollen.
Es war Ende April, als Albrecht wieder einmal beschloss, sich in seine Stammlande zu begeben, um hier nach dem Rechten zu sehen, aber vor allem auch, um seine Gemahlin Elisabeth zu treffen.
Es war ein langer, beschwerlicher Ritt gewesen, den er hinter sich hatte, als er endlich die Stadttürme von Winterthur erblickte. Hier wollte er sich für ein paar Tage ausruhen, in gemütlicher Runde beisammensitzen und einmal das Leben genießen. Am Abend wurde zu seiner Begrüßung ein Festmahl gegeben, zu dem außer anderen alten Freunden auch sein Neffe Johann geladen war. Der König war bester Stimmung, denn er freute sich in der Heimat zu sein und vor allem auf das bevorstehende Wiedersehen mit seiner Gemahlin. Als man genug gespeist und noch mehr getrunken hatte, kam Albrecht auf eine galante Idee: Zur allgemeinen Überraschung ließ er an die Gäste bunte Blumenkränze verteilen. Auch Johann wurde selbstverständlich ein Kranz überreicht. Kaum hatte er diesen in Händen, schleuderte er wutentbrannt das Gebinde von sich und rief zornig aus, dass er zu alt sei, um mit Blumen abgespeist zu werden. Er wolle endlich das bekommen, was ihm zustünde. Albrecht war genauso wie die übrigen Gäste von der Reaktion seines Neffen überrascht und versuchte Johann zu besänftigen. Aber der sprang auf und stürzte voller Zorn aus dem Saal.
Mit einem Schlag war die gute Stimmung tiefer Bestürzung gewichen, wobei man aber noch nicht ahnen konnte, welche Tragödie sich am nächsten Tag abspielen sollte. Und als sich die Gäste verabschiedeten, wusste keiner, dass er den König zum letzten Mal lebend gesehen hatte.
Albrecht zog am 1. Mai 1308 mit seinem Gefolge weiter. Als er aber an den Zusammenfluss von Aare und Reuß kam und sich schon zu Hause fühlte, entließ er seine Getreuen, um die letzte Strecke, die ihm von Kindheit an so vertraut war, ganz allein weiterzureiten. Plötzlich stürmten Reiter auf ihn zu, unter denen er seinen Neffen Johann erkannte. Albrecht ritt nichts Böses ahnend der Gruppe entgegen um sie zu begrüßen. Bevor er aber noch ein Wort sagen konnte, traf ihn schon der erste Hieb, den Johann ausführte und der dem König den Schädel spaltete. Um bei der Ausführung seiner Tat auf Nummer sicher zu gehen, hatte Johann noch Rudolf von Wart, Rudolf von Balm, Walter von Eschenbach und Konrad von Tegerfeld angeheuert, die ebenfalls auf den vom Pferd gestürzten König einstachen. König Albrecht hatte nicht die geringste Chance gehabt, diesem Mordanschlag lebend zu entkommen. Als Johann und seine Mordgesellen den Rossen die Sporen gaben, lag Albrecht tot in seinem Blut.
Die Verwirrung im Reich, die durch die Freveltat Johanns entstanden war, war zunächst riesengroß. Viele empfanden unverhohlene Freude über die Ermordung des unbeliebten Königs, der die Rechte der Adeligen, wo es nur gegangen war, geschmälert hatte. Diese Leute fühlten sich von einem Unterdrücker befreit und konnten Johann nicht genug danken. Andere wiederum weinten bittere Tränen und verurteilten den Königsmord zutiefst als das größte Verbrechen, das Menschen begehen konnten.
Johann, der den Beinamen »Parricida« (Königsmörder) erhielt, hatte es vorgezogen, nicht die politischen Reaktionen abzuwarten, sondern sich durch Flucht einem Gerichtsverfahren zu entziehen. Dabei dauerte es bis September 1309, bis die offizielle Achtung des Königsmörders in Speyer durch den neuen König Heinrich von Luxemburg bekannt gegeben wurde. Zu dieser Zeit weilte Johann jedoch wahrscheinlich schon in einem Kloster in Pisa, wo er wie ein Gefangener gehalten wurde, denn auch hier wurde er als Mörder zutiefst verachtet. Jahre später soll er sich angeblich an König Heinrich von Luxemburg wegen einer Begnadigung gewandt haben.
Die Familientragödie im Hause Habsburg stürzte das Reich erneut in große politische Schwierigkeiten. Das zukunftsweisende Werk, das vor allem zu einer großen Verwaltungsreform geführt hätte, das Albrecht I. begonnen hatte, blieb unvollendet. Persönliche Gier eines ungeduldigen jungen Mannes nach Macht und Besitz hatten die Habsburger über ein Jahrhundert zur Bedeutungslosigkeit im Reich absinken lassen. Es dauerte lange, bis sie sich von diesem schweren Schlag erholten.