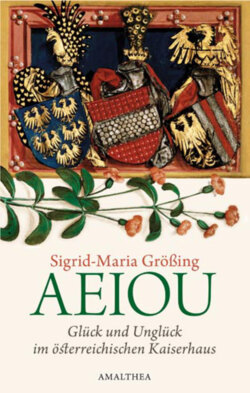Читать книгу AEIOU - Sigrid-Maria Größing - Страница 7
Zum Kaiser nicht geboren FRIEDRICH III.
ОглавлениеEin bildhübsches junges Mädchen war sie, die portugiesische Königstochter Eleonore, verwöhnt, bewundert und geliebt. Ein Mädchen, von dem die europäischen Prinzen nur träumen konnten, denn es brachte außer Schönheit auch noch Geld mit in die Ehe: Eleonores Elternhaus war der Palast König Eduards des Bekenners, eines der reichsten Herrscher von Europa.
Was mag wohl in der kapriziösen Prinzessin vor sich gegangen sein, als sie bei der Nachricht, der Habsburger König Friedrich habe um sie geworben, den folgenschweren Ausspruch tat: »Den will ich und sonst keinen!« Die junge Eleonore hatte damit ihr weiteres Schicksal festgelegt, wohl aus einer augenblicklichen Laune heraus, denn hätte sie gewusst, was eine Ehe mit dem eingefleischten Junggesellen bedeutete, hätte sie wohl nie und nimmer so entschieden.
Eleonore hatte zwar als kleines Kind politische Wirren und Intrigen miterlebt, dann aber unter der Obhut ihres Bruders ein Luxusleben ohne Sorgen und Nöte führen können. Ihr frühes Leben war von düsteren Schatten umwölkt gewesen: ihre Mutter hatte sich in Portugal nie wohl gefühlt und sich auch an ihren Mann nicht gewöhnen können. Nach Eduards überraschendem Tod im Kampf war sie eines Tages spurlos verschwunden. Zurück blieben minderjährige Kinder, die das Glück hatten, dass sich ihr Oheim gewissenhaft und liebevoll um sie kümmerte, nachdem er die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Und nun war die kleine Prinzessin am Hofe ihres Bruders Alphons umschwärmter Mittelpunkt; die Kavaliere machten ihr verliebte Augen, waren charmant und ritterlich und erwiesen ihr jede nur mögliche Aufmerksamkeit. Sie konnte haben, was ihr Herz begehrte, und zu allem Überfluss schien ihr das Schicksal noch eine besondere Gunst zu erweisen: der Mann, der eines Tages die Kaiserkrone tragen sollte, warb um ihre Hand. Mit ihm Kaiserin zu werden – welch verlockende Aussicht! Der Kaiser war der wichtigste Mann in Europa – was war dagegen die Krone Frankreichs? Denn auch der französische Dauphin hatte durch Boten seinen Wunsch übermitteln lassen, die Prinzessin zu ehelichen. Frankreich! Das Land besaß für Eleonore keinen Reiz, es war zu bekannt und zu nahe. Die Ferne lockte sie, in ihren Jungmädchenträumen erschien der fremde Mann in Österreich geheimnisvoll anziehend. Was konnte ihr der spätere französische König schon bieten? Luxus? Den war sie ohnehin gewöhnt, und dass man in Frankreich noch mehr Komfort haben könnte als am heimatlichen Hof, davon machte sie sich keine Vorstellung. Das Land am Atlantik war durch den Überseehandel reich geworden, und die Seefahrer hatten aus den fernen Ländern mitgebracht, was man nur erträumen konnte. Kostbare Teppiche aus dem Orient bedeckten die Marmorböden in den Palästen, Seidentapisserien zierten die Wände, wohlig konnte man sich in den weichen Kissen räkeln und köstliche Süßigkeiten genießen, wie sie dem gemeinen Volk noch lange verwehrt bleiben sollten. Auch in Frankreich sollte es dies alles geben, so war Eleonore berichtet worden, auch die französischen Adeligen wussten zu leben und sorgten durch Turniere und andere Lustbarkeiten für Abwechslung. Aber all das war der Prinzessin bekannt, das barg kein Geheimnis für sie: so wie sie ihr bisheriges Leben geführt hatte, so würde es auch sein, wenn sie dem Dauphin die Hand reichte.
Wie oft mag Eleonore in ihrem späteren Leben an der Seite eines langweiligen, eigenbrötlerischen Mannes ohne Humor und ohne Charme, als sie im düsteren, kalten Palast in Wiener Neustadt die Tage verrinnen sah, an die Entscheidung gedacht haben, die sie so leichtfertig als fünfzehnjähriges halbes Kind getroffen hatte! Oft mag sie ihre Worte unter bitteren Tränen bereut und sich nach dem fröhlichen, abwechslungsreichen französischen Hof gesehnt haben, wenn sie in einsamen Nächten wach lag und die Stunden zählte. Und dabei hatte sie selbst entschieden! Das konnten nicht viele heiratsfähige Königstöchter zu ihrer Zeit. Meist schlossen die Eltern die Eheverträge, und den Töchtern blieb nichts übrig, als sich wohl oder übel zu fügen, mochte der zugedachte Mann noch so alt und hässlich sein. Eleonore hatte selbst gewählt, und der Mann ihrer Wahl war wohl selbst erstaunt darüber, dass seine Werbung sofort ihre Zustimmung gefunden hatte.
Friedrich, zu Königsehren dadurch gekommen, dass sein Neffe, der junge Ladislaus Postumus, nach dem frühen Tod seines Vaters Albrecht V. noch nicht regierungsfähig war, war alles andere als ein attraktiver Mann, der ein junges Mädchen hätte betören können. Für seine Zeit ungewöhnlich groß, überragte er die meisten seiner Zeitgenossen um Haupteslänge und schritt wohl deshalb leicht vorgebeugt durchs Leben. Schon von weitem wirkte er missmutig, ja griesgrämig. Für Freundschaften hatte der misstrauische Mann wenig übrig, und für Liebschaften überhaupt nichts. Man wunderte sich schon am Hof über ihn, dass er sich so gar nicht für die charmanten Frauen erwärmen konnte, von denen so manche versuchte, sein Herz zu gewinnen. Aber keiner war es bisher gelungen, den eisernen Hagestolz aus der Reserve zu locken. Im Gegenteil, er verurteilte das lockere Leben der jungen Adeligen, die vor ihrer offiziellen Verheiratung reichlich Erfahrung in den Betten willfähriger Damen sammelten und auch nach dem heiligen Sakrament ihr Treueversprechen nicht allzu ernst nahmen. Friedrich missbilligte alle Annäherungen und wandte sich entsetzt ab, wenn eine Frau mehr von ihrem Körper zeigte, als die Schicklichkeit erlaubte. Schon als junger Mann galt Friedrich als ungewöhnlich prüde, und man munkelte, er wolle gar nicht wissen, was man mit einem jungen Mädchen alles machen konnte. Da war sein Bruder Albrecht aus anderem Holz geschnitzt, der war ein Kerl aus Fleisch und Blut, der die Frauen nahm, wo er konnte, der sich mit Essen vollstopfte und mit Wein voll laufen ließ, bis er umfiel, der das Geld mit vollen Händen unters Volk warf, um es sich dann mit brutalen Mitteln wieder zurückzuholen. Die Leute nahmen ihm sein ausschweifendes Leben nicht übel, im Gegenteil: Albrecht war immer greifbar, im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, er mischte sich unters Volk, er war ein Herr zum Anfassen. Er hätte herrschen sollen, nicht der verschlossene Spintisierer Friedrich. So dachten nicht nur die Anhänger Albrechts, so empfand auch er selbst und unternahm alles, um seinem Bruder das Leben schwer zu machen und selbst an die Macht zu kommen.
Friedrich war kein Kämpfertyp. Ihn interessierte nicht, was die Leute über ihn flüsterten; er vergrub sich in seine alchimistischen Versuche, ließ sich die Sterne deuten und war überzeugt, selbst einmal Gold machen zu können. Auf diese Weise konnte er natürlich keine Frau finden, und allmählich regte sich der Verdacht, der König würde überhaupt nie heiraten. Dass dies aber im Interesse der Dynastie ausgeschlossen war, das wusste auch Friedrich und ließ sich nach langen Überlegungen doch dazu überreden, auf Brautschau zu gehen. Es war vor allem der Herzog von Tirol, Siegmund (der Münzreiche), der Friedrich von den positiven Seiten einer Ehe zu überzeugen versuchte. Der Tiroler hatte beste Beziehungen zum burgundischen Hof, und Herzog Philipp III. von Burgund wiederum war mit dem portugiesischen Königshaus verwandt. Was lag also näher, als Fäden in diese Richtung zu spannen, noch dazu, wo man wusste, dass in Portugal Geld in Hülle und Fülle vorhanden war. Geld, das konnte den König locken, kämpfte er doch, solange er denken konnte, gegen ein Heer von Schuldnern.
Natürlich wussten sowohl der Herzog von Tirol als auch der Herzog von Burgund, dass sie den Habsburger in eine gewisse Abhängigkeit bringen konnten, sollte diese Heirat zustande kommen. Sie waren schließlich keine bloßen Wohltäter. Eines Tages würde Friedrich Kaiser werden; dann würde er sich erkenntlich zeigen müssen.
Friedrich war mittlerweile 32 Jahre alt geworden, hager, mit fahlem, dünnem Haar, das schlaff herunterhing und wahrscheinlich auch in seiner Jugend nicht üppiger gewesen war. Man sah ihm den Asketen an, das schmale Gesicht zeigte einen leidenden Ausdruck, von Lebhaftigkeit und Weltaufgeschlossenheit war nichts zu bemerken. Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen war er schlank, verabscheute üppiges Essen, Völlerei war ihm in tiefster Seele zuwider, und an den Fress- und Saufgelagen, wie sie so üblich waren, nahm er nicht teil. Sicher war er selbst überrascht, dass sich die hübsche Prinzessin so rasch für ihn entschieden hatte – wahrscheinlich hatte er in seiner misstrauischen Art schon mit einem Korb gerechnet. Die Sache schien verdächtig; gab es vielleicht eine Fußschlinge, in der er gefangen werden sollte? Friedrich wollte keineswegs die Katze im Sack kaufen. Er hielt zwar ein Medaillon mit dem Bildnis Eleonores in Händen, aus dem ihm ein reizendes junges Mädchengesicht entgegenlachte, aber Leinwand war geduldig, wer garantierte ihm schon, dass die Prinzessin nicht verwachsen oder gar verkrüppelt war? Zwar hatte ihm ihr Onkel Pedro, den er in Wien persönlich kennen gelernt hatte, das Gegenteil versichert, aber konnte man ihm trauen, wenn es darum ging, eine Nichte an den zukünftigen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu verheiraten?
Friedrich, der auf Nummer sicher gehen wollte, beauftragte zwei vertrauenswürdige Geistliche mit einer delikaten Mission: Sie sollten sich auf den weiten Weg durch das unsichere Europa machen, um die Braut in Augenschein zu nehmen und dann zu berichten, wie Eleonore wirklich beschaffen war. Der knauserige König gab den Boten allerdings so wenig Geld mit, dass die beiden ganz und gar nicht wie königliche Brautwerber auftreten konnten. Schmutzig und zerlumpt zogen sie ihres Weges, wurden zu allem Überfluss von Strauchdieben überfallen, die nicht wissen konnten, dass bei den beiden wirklich nichts zu holen war, und kamen endlich nach Portugal, wo man sie als verdächtiges Gesindel aufgriff und ins Gefängnis warf. Nur unter größten Mühen gelang es, dem portugiesischen König glaubhaft zu machen, dass diese abgerissenen Gestalten die Abgesandten des Habsburgers seien. Die beiden Geistlichen schworen alle Eide des Himmels, und schließlich erlaubte man dem einen, Jacob Mocz, den Ehevertrag »per procurationem«, als Stellvertreter Friedrichs, zu unterzeichnen.
Über die Prinzessin konnten die beiden nur Gutes berichten. Eleonore war ganz bezaubernd, mit makelloser Haut und glänzendem braunem Haar, allerdings ungewöhnlich klein und grazil, beinahe zerbrechlich, was fast als Fehler gelten konnte. Die Herrscher bevorzugten robuste Frauen, die jedes Jahr ein Kind zur Welt bringen konnten, ohne Schaden zu nehmen. Für den Fortbestand einer Dynastie war es wichtig, eine große Zahl von Erben zur Verfügung zu haben; der Tod raffte viele Nachkommen schon im Kleinkindesalter hinweg.
Nach ihrer Rückkehr waren die beiden Boten voll des Lobes über die Schönheit und Anmut der jungen Prinzessin und versicherten Friedrich, dass er keine bessere Wahl treffen könne. Aber um ganz sicher zu sein, wollte er auch noch die Sterne befragen: Der Hofastrologe musste ein genaues Horoskop erstellen. Was darin stand, erfüllte ihn mit Genugtuung: Eleonore war die richtige Frau für ihn.
Hektisches Leben erfüllte den Hof von Lissabon, als der Tag der Abreise festgesetzt war. Die Vorbereitungen für die große Reise wurden mit aller Sorgfalt getroffen, jedes Stück, das die Prinzessin in ihre neue Heimat mitnehmen sollte, wurde liebevoll ausgewählt, es sollte ihr an nichts mangeln. Ein Dutzend Schneider fertigte kostbare Kleider an, seidene Schuhe und Täschchen, alles passend, sollten die junge Frau schmücken. Auch Teppiche und weiche Kissen wurden auf die Schiffe verladen. Nach dem Auftreten der beiden bettelhaften Brautwerber war man wohl etwas unsicher, ob die Braut in Österreich nicht vieles entbehren würde.
Solange Eleonore noch zu Hause war, folgte ein Fest auf das andere. Die Heimat feierte sie zum letzten Mal; um zu zeigen, wie man sie liebte. Dichter verfassten neue Theaterstücke, in denen Mohren und Drachen die Hauptrollen spielten, wilde Männer kämpften gegen übermächtige Stiere, allegorische Gestalten versinnbildlichten die Zukunft der Prinzessin, bunte Bilder stellten dar, welch hohe Ehre ihr beschieden sei, da sie den zukünftigen Kaiser zum Mann bekommen würde. Eleonore, auf dem Balkon des Palastes stehend, genoss den Jubel und die Hochrufe, die ihr galten. Aber nur zu bald hieß es Abschied nehmen von den Gespielinnen, vom Bruder, von der Heimat. Eine kleine Flotte war ausgerüstet worden, die nun abfahrbereit im Hafen lag. Sie sollte Eleonore nach Italien bringen, wo ihr zukünftiger Gemahl sie erwartete. Die Fahrt ging die Küsten von Portugal, Nordafrika und Spanien entlang, wobei man sich nicht zu weit aufs Meer hinauswagte: nicht nur die Stürme auf offener See waren gefährlich, es war auch ständig mit Überfällen der Seeräuber zu rechnen, die überall im Mittelmeer ihr Unwesen trieben.
Für die junge Frau wurde die Seereise zum Alptraum. Zwar war die Jahreszeit günstig, aber der Wettergott hatte alle Prophezeiungen Lügen gestraft und schwere Stürme geschickt. Wie Nussschalen schaukelten die Schiffe auf den meterhohen Wellen, wurden hin und her geworfen, bis die Segel in Fetzen von den Masten hingen, und Eleonore und ihre Gefährten mussten froh sein, nicht über Bord gespült zu werden. Kaum hatte sich der Wind gelegt, kaum glaubte die Besatzung wieder Mut fassen zu können, als am Horizont schwarze Schiffe auftauchten: Piraten! So gut es ging, wehrte man sich seiner Haut, versteckte die Prinzessin, damit ihr nicht ein Leid geschehe, konnte aber nicht verhindern, dass die Räuber sich der Schätze bemächtigten, die Eleonore ihrem Mann als Mitgift überreichen sollte. Als der Spuk vorüber war, dankten die Reisenden dem Himmel, dass man mit dem nackten Leben davongekommen war. Von der stolzen Flotte war kaum etwas übrig, es fehlte an allem, vor allem an Trinkwasser, denn die meisten Wasserfässer waren schon in den Stürmen über Bord gegangen. Wie sollte man in der glühenden Sonne den quälenden Durst löschen? Allein die Weinfässer waren heil geblieben, und wollte man nicht verdursten, mussten sie angezapft werden, ein harter Schlag für die Prinzessin, die, obwohl sie aus einem Weinland stammte, dieses Getränk verabscheute.
Die Unglücksfälle und Missstände auf der langen Reise hielten die junge Frau so sehr in Atem, dass sie nicht dazu kam, ihr Vorhaben zu verwirklichen und die Sprache ihres Bräutigams zu erlernen. Sie war fest entschlossen gewesen, Friedrich mit deutschen Worten zu begrüßen. Dass der Bräutigam sich die Mühe machte, seine kleine Braut auf portugiesisch willkommen zu heißen, ist eher unwahrscheinlich. So sollten sich zwei grundverschiedene Menschen verbinden, von denen eins nicht die Sprache des anderen verstand, die sich überhaupt nicht miteinander unterhalten konnten, wenn auch später Eleonore die deutsche Sprache erlernt haben soll, die sie freilich zeitlebens mit Akzent sprach.
Endlich landeten die Schiffe doch noch an der italienischen Küste, zwar nicht in dem vorgesehenen Hafen, aber dennoch in Livorno, unweit von Siena, wo der deutsche König unruhig auf seine Braut wartete. Die Tage vor der geplanten Hochzeit waren für Friedrich kein wahres Vergnügen. Die italienische Bevölkerung wollte nichts von ihm wissen und verschloss die Stadttore, weil man Schwierigkeiten mit den Begleittruppen des Habsburgers befürchtete. Es war immer riskant, fremdes Kriegsvolk, auch wenn es in friedlicher Absicht gekommen war, in die Stadt zu lassen, denn man wusste nie, wie es sich aufführen würde. Nur allzu schnell konnte aus einem kleinen Streit eine Welle der Gewalt hervorbrechen, die zu Brandschatzung und Plünderung führte. Die Soldaten vergaßen leicht, dass man eigentlich befreundet war, begannen zu rauben und zu morden und fielen über die Frauen her, und den Herrschern war es dann unmöglich, dem wilden Treiben Einhalt zu gebieten. Es dauerte lange, bis Friedrich die Stadtväter von Siena überzeugen konnte, dass er seine Braut nicht gut auf freiem Feld empfangen könne. Schließlich willigte man – aber nur der Braut zuliebe – ein, die Stadttore zu öffnen, bewachte aber den König und sein Gefolge misstrauisch auf Schritt und Tritt, selbst als Eleonore schon eingetroffen war.
War man also dem Habsburger eher feindlich gesinnt, so eroberte die kindliche Portugiesin die Herzen des Volkes im Sturm. Jubel klang auf, wo sie sich zeigte, ihre Schönheit und ihr Charme bezauberten alle. Hätte Friedrich nur einen Funken Glut in sich verspürt, er hätte sie vor allem Volk an sich gezogen und herzlich geküsst. Nicht nur Eleonore wäre glücklich gewesen, auch die Menschen hätte er für sich gewonnen. Aber er konnte nicht aus seiner Haut, er war viel zu verschlossen, um vor aller Augen menschliche Regungen zu zeigen. Es wird berichtet, er habe am ganzen Körper gezittert, als er Eleonore begrüßte. Er scheute wohl davor zurück, vor den Augen der Menge etwas von seiner Person preiszugeben, sein Privatleben wie in einem Theater zu demonstrieren. Viel lieber hätte er in aller Heimlichkeit geheiratet, wenn es schon unbedingt sein musste. Aber eine solche Zurückhaltung entsprach nicht dem Stil der Zeit und den Anforderungen, die man an einen Herrscher stellte. Damals und auch noch lange Zeit danach galt das Privatleben des Herrschers als öffentlich, und in aller Öffentlichkeit wurden sogar Intimitäten ausgetauscht und auf das Schamgefühl vor allem der Frauen wenig Rücksicht genommen.
Nach dem ersten Treffen zog sich Friedrich, wann immer es möglich war, vor seiner Braut zurück, vermied es, mit ihr allein zu sein und hasste das Spektakel, das man um sie machte. Die Städte Italiens glaubten sich an Festen überbieten zu müssen, die alle der jungen Braut galten; sie hatte die Herzen erobert und fühlte sich unter den warmherzigen, ungestümen Italienern wie zu Hause. Alles erinnerte sie an ihre ferne Heimat, der Gesang, das Temperament der Leute, die glühenden Blicke der Männer und das köstliche Essen. An der Seite des wortlosen, mürrischen Friedrich genoss sie bei herrlichem Wetter all diese Vergnügungen und vermisste seine Unterhaltung gar nicht, hätten sie sich doch ohnehin nicht verstanden.
Die kirchliche Trauung sollte in Rom stattfinden, zusammen mit der Kaiserkrönung (Friedrich, als deutscher König der Vierte, war übrigens der einzige Habsburger und der letzte Kaiser, der nach alter Sitte in Rom vom Papst – es war Nikolaus V. – gekrönt wurde). Es war ein großer Tag für alle, die mit Friedrich nach Rom gekommen waren. Feierlich schritt der Papst die Stufen der Peterskirche hinunter, um den König zum Eintritt aufzufordern. Begleitet von den Würdenträgern des Reiches zogen Friedrich und der Papst langsam in den Dom ein. Laute Gesänge begleiteten ihren Weg, bis sich endlich Nikolaus auf seinem Thron vor dem Altar niederließ, umgeben von Kardinälen und Bischöfen. Eleonore und Friedrich hatten auf außerhalb des Altarraumes errichteten Tribünen Platz genommen. Beide sollten vor dem Mauritiusaltar vom Bischof von Ostia zwischen dem rechten Arm und dem Schulterblatt gesalbt werden, zuerst der König, dann seine Frau.
Nach der Salbung führte man das Paar vor den Petersaltar. Mönche zogen dem König ein weißes Kleid über und warteten, bis der Papst ihm ein Schwert übergab, das Friedrich dreimal aus der Scheide zog und schwenkte. Darauf nahm ihm der Papst die Waffe aus der Hand und gürtete sie ihm um, worauf er ihm Reichsapfel und Szepter reichte. Alle hielten den Atem an, als der Papst nun aus den Händen von Friedrichs Bruder Albrecht die Krone des Reiches nahm und sie dem König aufs Haupt setzte. Krone, Szepter und Reichsapfel hatte Friedrich eigens aus Nürnberg nach Rom bringen lassen und sich außerdem, misstrauisch wie er war, noch extra eigene Insignien anfertigen lassen. Man wusste nie, was auf einem so langen und beschwerlichen Zug alles geschehen konnte.
Unmittelbar nach der Krönung des Kaisers schritt der Papst auf Eleonore zu und krönte auch sie. Die Zeitgenossen berichteten ausführlich über den zauberhaften Anblick, den die liebreizende Prinzessin geboten habe, als sie die Krone aufs Haupt gesetzt bekam. Friedrich und Eleonore knieten nun im Gebet vor dem Altar, während die Gläubigen ein Bitt- und zugleich Dankgebet gen Himmel richteten. Dann erhob sich das Kaiserpaar und küsste dem Papst Hände und Füße. Kirchliche Würdenträger geleiteten die beiden auf ihre Plätze zurück.
Nikolaus V. zelebrierte nun feierlich die Heilige Messe, wobei Friedrich ministrierte. Als der Segen über das Kaiserpaar und die Gläubigen erteilt worden war, verließen Friedrich und Eleonore getrennt den Petersdom. Die Kaiserin wurde in ihren Palast eskortiert, um sich von den Strapazen der Krönung auszuruhen, Friedrich hingegen trat seinen traditionellen Rundritt durch Rom an. Er hielt dem Papst ehrfurchtsvoll die Steigbügel und führte das Ross des Heiligen Vaters noch einige Schritte am Zügel; eine Szene, die den Zuschauern den Eindruck vermitteln musste, die Macht des Papstes triumphiere über die weltliche, und der jahrhundertelange Streit um die Vorherrschaft sei endgültig entschieden.
Die Zeremonien waren damit noch lange nicht beendet. Papst und Kaiser ritten gemeinsam hinauf zur Engelsburg, der Kaiser mit der Krone auf dem Haupt, während das Volk in den Straßen jubelte. In der Engelsburg überreichte Nikolaus V. dem Kaiser die goldene Rose von Jericho, und Friedrich schlug dreihundert Adelige zu Rittern. Dann begab er sich auf den Weg zum Lateran, wobei es zu einer kritischen Situation kam: Zuschauer, die sich zu nahe an den Kaiser herandrängten, um ihn in seinem prächtigen, von Gold und Juwelen strotzenden Königsmantel besser zu sehen, ja vielleicht sogar berühren zu können, umringten sein Pferd. Friedrich fühlte sich bedroht, es kam zu einem Handgemenge zwischen seinem Gefolge und den Römern. Als die Situation gefährlich zu werden schien, gab Friedrich seinem Pferd die Sporen und sprengte durch die zurückweichende Menge davon.
So viel über die Kaiserkrönung berichtet wurde, so wenig ist über die Eheschließung bekannt, die ebenfalls in Rom stattfand. Friedrich berührte diese Feier wenig, er gab sein Jawort, und damit war für ihn der Fall erledigt. Wahrscheinlich fürchtete er sich sogar vor der Hochzeitsnacht, denn nur so ist zu erklären, dass das Ehepaar auch nach der Hochzeit noch in getrennten Palästen wohnte und nicht mehr Kontakt hatte als vorher. Friedrich ging Eleonore nach wie vor aus dem Weg, wo er nur konnte, und die junge Frau wird es wohl auch nicht besonders zu dem griesgrämigen Sonderling hingezogen haben.
Das Paar setzte seine Reise nach Neapel fort, wo ein Onkel Eleonores residierte. Das merkwürdige Verhalten Friedrichs seiner Frau gegenüber war nicht verborgen geblieben, und auch dem König von Neapel waren Gerüchte zu Ohren gekommen, der Kaiser habe die Ehe noch nicht einmal vollzogen. Kurz entschlossen nahm Alphons Friedrich ins Gebet, befragte ihn, wie es um die delikate Sache stehe und versuchte ihn zu überreden, sie wenigstens in Neapel hinter sich zu bringen. Aber der frischgebackene Kaiser hatte große innere Vorbehalte; er war von der Vorstellung beseelt, Eleonore unmöglich auf italienischem Boden zu seiner Frau machen zu können, da er befürchtete, hier einen »welschen Bastard« mit unbändigem Temperament zu zeugen. Der Himmel sollte ihn vor einem solchen Sohn bewahren! Aber Alphons gab nicht auf. Rauschende Feste und opulente Gastereien sollten den spröden Friedrich animieren, das Beilager mit seiner jungen Frau zu halten. Glanzvolle Bankette wechselten mit Schauspielen, Turnieren und Jagden. Aber all dies konnte die Vorurteile Friedrichs nicht zerstreuen, bis es dem König von Neapel schließlich zuviel wurde: Nach langen, eindringlichen Gesprächen erklärte sich Friedrich endlich bereit, am 16. April 1452 das öffentliche Beilager mit Eleonore zu halten. Mitten auf einem weiten Platz stellte man ein breites Bett auf, das Kaiser und Kaiserin in Anwesenheit des Königs von Neapel und des gesamten Hofstaates gemeinsam bestiegen, beide bis an den Hals bekleidet. Dann zog Friedrich kurz die Bettdecke über ihre Köpfe, so dass sie einen Augenblick lang vor der Öffentlichkeit verborgen waren, gab Eleonore einen Kuss – und die Ehe galt als vollzogen.
Was mag in der jungen Kaiserin vor sich gegangen sein, als sie in aller Öffentlichkeit mit ihrem Gemahl das Bett besteigen musste, obwohl er nach wie vor überhaupt kein Interesse an ihrer Person zeigte? Es wird ihr auch nicht verborgen geblieben sein, dass ihr Schicksal alle am Hofe, Gesinde wie Adelige, vor allem aber ihre eigenen Hofdamen über die Maßen beschäftigte. Durch Liebeszauber wollten sie den Kaiser ins Gemach seiner Frau locken, mit Parfüm vermischtes Weihwasser wurde ausgesprengt, schmelzende Liebeslieder erklangen – aber alles war umsonst, ja, Friedrich verdächtigte sogar Eleonores Amme der Hexerei. Um sie aber nicht vor dem ganzen Hof zu brüskieren, befahl er sie schließlich doch zu sich auf sein Zimmer: und dort konnte er nun endlich dem Reiz der jungen Frau nicht mehr widerstehen. Aeneas Silvius Piccolomini, der Vertraute des Kaisers (und spätere Papst Pius II.), berichtet in seinen Aufzeichnungen pikante Details von dieser verspäteten Hochzeitsnacht.
Nach den glanzvollen Monaten in Neapel traten Friedrich und Eleonore getrennt die Weiterreise nach Venedig an. Die Lagunenstadt gab den hohen Gästen zu Ehren ein rauschendes Fest. Wieder flogen der Kaiserin alle Herzen zu, und als die Stunde des Abschieds nahte, schenkten die Stadtväter Eleonore einen kostbaren Ring im Wert von 1750 Dukaten, der sie immer an die Tage in Venedig erinnern sollte.
Im Kaiser wurden in Venedig alte Erinnerungen wach: Als Kaufmann verkleidet war er vor Jahren hier durch die Märkte gezogen und hatte die Waren aus fernen Ländern bestaunt. Von hier war er 1436 nach Jerusalem gezogen und hatte sich dort unter die Händler gemischt. In den engen, winkeligen Gassen voller fremdartiger Gerüche hatte er nach langem Feilschen so manchen Edelstein erworben. Friedrich konnte sich an den kostbaren Steinen nicht satt sehen, er liebte nicht nur ihren Glanz und ihre Farben, sondern beschäftigte sich auch wissenschaftlich mit ihnen. In seiner Alchimistenküche versuchte er ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen, ja sie eventuell sogar selbst künstlich herzustellen. Alles Geld, das er erübrigen konnte, hatte Friedrich im Orient für Juwelen ausgegeben, und er verfügte über eine phantastische Edelsteinsammlung, obwohl er ständig unter Geldsorgen litt. Es gibt heute noch ein Schmuckstück, das aus dieser Zeit stammt, »ain ring gancz von saffir«. Friedrich kaufte die Steine aber nicht für die Schmuckschatulle; obwohl meist schäbig gekleidet, trug er die wertvollsten Pretiosen selber und hatte an seiner Seite immer einen schwer vergoldeten Dolch hängen, von dem er sich nie trennte, den er aber auch nie benutzte.
Jetzt in Venedig war der Kaiser wieder ganz in seinem Element. Er kaufte orientalische Waren, die man in Österreich kaum kannte, gab ein kleines Vermögen für feinsten Damast und schillernden Atlas, aber auch für Teppiche und scharfe Damaszenerklingen aus. Unauffällig gekleidete Diener mussten die von Friedrich selbst ausgesuchten Waren abholen, da der Kaiser befürchtete, man würde ihn sonst übers Ohr hauen.
Für die Kaiserin ging die Zeit in Italien nur allzu rasch vorüber. In der allgemeinen Festesstimmung hatte sie ihren Mann gar nicht vermisst, der schon bald wieder keine Notiz von ihr nahm. Friedrich war nun einmal kein feuriger Liebhaber, und auch eine entzückende Frau wie Eleonore konnte ihn nicht dazu machen. Einzig der Gedanke, einen Sohn zeugen zu müssen, bewog ihn zu intimen Kontakten mit ihr. Dieser Sohn aber sollte, wenn schon hier gezeugt, so doch unter keinen Umständen das Licht der Welt in Italien erblicken. Als man daher raunte, Eleonore sehe Mutterfreuden entgegen, brach er jäh auf. Ein schweres Gewitter stand am Himmel, als der Kaiser mit seiner Frau die Grenze zu seinen Ländern überschritt, und so mancher im Gefolge vermeinte in den zuckenden Blitzen und im Krachen des Donners ein böses Omen für das zukünftige gemeinsame Leben des Kaiserpaares erkennen zu müssen.
Schließlich erreichte man Wiener Neustadt, wo der Kaiser seine Residenz aufgeschlagen hatte. Grau in Grau zeigte sich die neue Heimatstadt der Kaiserin, nichts erinnerte auch nur im geringsten an die Pracht und die Helligkeit des Südens, kalt und feucht schienen die dicken Mauern der Burg. Das Herz zog sich Eleonore bei dem Gedanken zusammen, hier ihr weiteres Leben verbringen zu müssen, an der Seite eines Mannes, den sie nie für sich gewinnen konnte, so sehr sie sich auch bemühte.
Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich das Leben so angenehm wie nur irgend möglich zu machen. Im Laufe der Monate hatte sie Vertraute gefunden, mit denen sie sich gerne umgab und portugiesisch sprechen konnte. Vor allem einer Hofdame, die sie aus der Heimat mitgebracht hatte, konnte sie in ihrer Einsamkeit ihr Herz ausschütten. Die Kaiserin entbehrte so ziemlich alles, was sie gewöhnt war. Der Kaiser ließ sie meist allein, denn eben um diese Zeit hatte er wieder mit vielen Feinden zu kämpfen. Die Anhänger des jungen Ladislaus Postumus machten ihm das Leben schwer, ebenso sein Bruder Albrecht, der es geschickt verstand, die Gegner Friedrichs aufzuwiegeln. Jede noch so kleine Gelegenheit nützten die Feinde, um die ohnehin geringe Macht des Kaisers noch mehr zu untergraben. Wann immer Friedrich nicht in Wiener Neustadt weilte, zogen Söldnerhaufen plündernd und brandschatzend durch die Straßen der kleinen Stadt und versetzten die junge Frau, die gerade ihr erstes Kind erwartete, in Angst und Schrecken.
Drei Jahre waren einstweilen seit der Hochzeit vergangen, und Eleonore hatte noch immer keinem Kind das Leben geschenkt. Die Gerüchte in Venedig hatten sich als falsch erwiesen. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man schon, das sei kein Wunder bei dem Desinteresse Friedrichs an seiner Gemahlin. Und als sich dann doch die ersehnte Schwangerschaft einstellte, munkelten böse Zungen, dann müsse wohl ein anderer der Vater sein als Friedrich.
Im November 1455 jedenfalls brachte Eleonore in einer langen, schweren Entbindung einen Knaben zur Welt, der auf den Namen Christoph getauft wurde. Endlich hatte sie ein Wesen, auf das sie ihre Liebe konzentrieren konnte; aber schon im nächsten Jahr klopfte der Tod an die Tore des Palastes. Christoph starb ganz plötzlich am 25. März 1456. Der Tod des Kindes war für Eleonore ein schwerer Schlag, nicht nur, weil sie das Liebste verloren hatte; Friedrich machte ihr auch noch heftige Vorwürfe, sie hätte den Knaben falsch ernährt.
Zwischen dem Kaiser und seiner Frau gab es häufig Diskrepanzen, und die Frage des Essens wurde beinahe täglich aufs neue zum Zankapfel. Friedrich, der Asket, bevorzugte die schweren heimischen Speisen: Breie, Gemüse und Salate durften auf der kaiserlichen Tafel nicht fehlen. Wein war verpönt; der Kaiser trank nur Wasser. Eleonore dagegen liebte Süßspeisen und Leckereien, die sie durch Boten aus Portugal erhielt. Friedrich sah das mit scheelen Augen; oft hatte er versucht, ihr dieses Vergnügen einfach zu verbieten, aber vergeblich: Wenn Eleonore sich auch mit dem kargen Leben in Wiener Neustadt und später in Wien abfand, in einer Sache ging ihr südländisches Temperament mit ihr durch: Beim Essen ließ sie sich nichts vorschreiben.
Im März 1459 kam der zweite Sohn des Kaiserpaares zur Welt, Maximilian. Sofort nach der Geburt wollte Friedrich seiner Frau das Kind wegnehmen, um es nach österreichischer Sitte erziehen zu lassen, aber Eleonore gelang es doch, ihn zu überzeugen, dass ein Säugling in der Obhut seiner Mutter bleiben sollte. Friedrich willigte, wenn auch widerstrebend, ein; als aber die Tochter Helena, eineinhalb Jahre nach Maximilian geboren, als Kleinkind starb, war er endgültig überzeugt, die von der Mutter verabreichten Leckereien wären der Grund ihres frühen Todes. Friedrich verbot ihr strikt, den Kindern weiterhin Süßigkeiten zu geben, und der kleine Maximilian verstand die Welt nicht mehr, als er nur noch dicken, schweren Haferbrei zu essen bekam. Kunigunde, eine weitere Schwester Maximilians, musste in die Gemächer des Kaisers gebracht werden, wo er sie eigenhändig mit Hirse- und Haferbrei vollstopfte.
Ja älter Friedrich wurde, desto ausgeprägter traten seine eigentümlichen, ja skurrilen Charaktereigenschaften hervor. Die Menschen wichen scheu vor ihm zurück, und alles was er anfasste, schien zu misslingen. Er war kein Politiker, und doch musste er sich ein Leben lang mit politischen Kämpfen und Intrigen herumschlagen. Nach dem überraschenden Tod des jungen Ladislaus Postumus (man munkelte von Gift; jüngste Forschungen haben allerdings bestätigt, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist) im Jahre 1457 stellten sich die Wiener unter der Führung ihres Bürgermeisters Wolfgang Holzer offen gegen den Kaiser und auf die Seite seines Bruders Albrecht und belagerten die Kaiserfamilie in der Hofburg; Friedrich musste Albrecht Österreich unter der Enns abtreten.
Die Zeit in Wien zählte zu den schrecklichsten Monaten im Leben der Kaiserin. Die Belagerer hatten die Familie von allem abgeschlossen, was zum Leben notwendig war. Der spätere Kaiser Maximilian, damals ein dreijähriger Knabe, erinnerte sich ein Leben lang an diese düstere Zeit, in der nur die Mutter nicht verzweifelte und in ihrer heiteren Art die vor Hunger weinenden Kinder tröstete. Wie glücklich hätte ein Mann mit einer solchen Frau sein können! Friedrich aber wusste wahrscheinlich selbst nicht, was er an Eleonore hatte; er zog sich immer mehr in die Einsamkeit seiner vier Wände zurück und gab sich seinen Spintisierereien hin, an denen er niemanden teilhaben ließ. Den misanthropischen Einzelgänger kümmerte es wenig, was man über ihn dachte und redete, er lebte ganz nach seiner Façon. Räte und Gesinde hatten sich nach seinen Vorstellungen zu richten, und nicht selten ließ er sie mitten in der Nacht zusammenholen, um zu konferieren. Nach solchen nächtlichen Intermezzi legte er sich dann noch einmal zur Ruhe und schlief bis in den Vormittag hinein, obwohl damals Langschläfer als Faulpelze galten. Was kümmerte das Friedrich? Weckte ihn jemand zu ihm nicht genehmer Stunde, dann konnte er äußerst unwirsch werden und die Person, die ihn aus seinen Träumen gerissen hatte, kurzerhand hinauswerfen.
Was sollte bei einem solchen Lebenswandel eine junge Frau an seiner Seite? Wenn sie sich schon mit ihm zeigte, behandelte er sie eher als Tochter, als Ehefrau, meist aber sah er bloß über sie hinweg und verbot ihr alles, woran sie Freude gehabt hätte. Wie die meisten jungen Frauen, auch zu dieser Zeit, war sie an Mode und schönen Kleidern interessiert, liebte weichen Samt und knisternde Seide, aber Friedrich fand dies überflüssigen Tand, ja fast Teufelswerk. Näherte sich ihm eine Dame mit allzu offenherzigem Dekollete, schloss er die Augen und befahl, die Versucherin aus dem Saal zu führen. Er hasste auffällige Kleidung, besonders wenn sie die Grenzen der Schicklichkeit überschritt, wie es auch bei den damals modischen enganliegenden Beinkleidern der Männer der Fall war. Solche Kleidung musste ja zu Laster und sittlichem Verfall führen! Aber auch der Tanz galt für ihn als Versuchung des Teufels. Nur zweimal im Leben war es Eleonore gelungen, ihren Mann durch langes Bitten zu einigen Tanzschritten zu bewegen, beileibe kein Vergnügen für die junge Frau, die bald merkte, wie widerwillig er sich bewegte, so dass ihr bald jede Lust verging. Friedrich soll einmal geäußert haben, dass er lieber fieberkrank darniederliegen wolle als noch einmal das Tanzbein zu schwingen.
Die portugiesische Prinzessin lebte am Hof ihres Mannes wie eine Fremde und führte ein Schattendasein, das nur durch die Kinder Lichtblicke erhielt. Die Kleinen liebten ihre Mutter zärtlich, und Eleonore verbrachte jede freie Stunde bei ihnen. Den Vater sahen Maximilian und Kunigunde selten, und sie waren nicht allzu traurig darüber, denn zeigte sich der Kaiser, so fand er nie ein freundliches Wort für die Mutter oder sie; stets wurde nur genörgelt und getadelt. Eleonore durfte die Räume ihres Mannes nicht betreten, die Friedrich als seine Privatsphäre betrachtete. Nie diskutierte der Kaiser mit ihr politische Probleme, bei denen sie mit ihrem gesunden Realitätssinn durchaus eine Stütze hätte sein können. Eleonore verstand die Passivität ihres Mannes nicht; für sie musste ein Herrscher tatkräftig, rege und leutselig sein, wollte er zum Wohl des Volkes regieren. Sie selbst war durch das Desinteresse Friedrichs an ihrer Person zur Macht- und Bedeutungslosigkeit verurteilt. Es ist wie ein Wunder, dass sie an der Seite ihres Mannes nicht innerlich völlig verkümmerte, dass sie trotz der Abgeschiedenheit, in der sie lebte, immer noch Gelegenheiten fand, bedeutende Persönlichkeiten ihrer Zeit um sich zu scharen. Die Feste, die sie – oft gegen den Willen des Kaisers – gab, wurden zu glanzvollen Höhepunkten in ihrem Leben. Hier konnte sie Politik machen, hier verteidigte sie die Machtansprüche der Habsburger auf den böhmischen und ungarischen Thron, hier fand sie offene Ohren gegen die Ungarn, deren ehrgeiziger König Matthias Corvinus Friedrich schwer zu schaffen machte, und hier zeigte sie bedeutenden, namhaften Männern, die es sich zur Ehre anrechneten, bei der Kaiserin geladen zu sein, die Ziele und Wünsche der habsburgischen Politik auf. Charmant, wie sie war, konnte sie ihre Theorien auf unkomplizierte Art so vortragen, dass alle von der schönen Frau hingerissen waren. Und mit diesen Einladungen nützte sie ihrem politisch unklugen Gemahl wahrscheinlich mehr, als er wahrhaben wollte. Eleonore wurde in den wenigen Jahren, in denen sie in Österreich lebte, innerlich mehr ein Mitglied der Familie Habsburg, als es Friedrich jemals gewesen war. Die feste und enge Bindung an das Geschlecht hat sie ihrem Sohn Maximilian mit auf den Lebensweg gegeben. Er vergaß es nie, dass die »Casa d’Austria« die Vorrangstellung in Europa einnehmen sollte. Die Kaiserin hatte sich im Laufe der Jahre zu einer echten Persönlichkeit entwickelt, sie war es, die ihrem Sohn glänzende Eigenschaften vererbte, und letztlich wurde sie zu einer echten Stammmutter der Habsburger. Als sie am 3. September 1467, wenige Tage vor ihrem 31. Geburtstag, starb, weinten am Kaiserhof viele um sie, am wenigsten wohl ihr eigener Mann, mit dem sie sich überworfen haben soll. Er konnte von nun an ganz in seiner eigenen Welt leben, und keiner störte ihn mehr. Nur selten zeigte er sich seinen Kindern, meist verbunden mit lautem Türengeknall, denn der Kaiser hatte die seltsame Angewohnheit, Türen nicht mit der Hand, sondern mit den Füßen zu schließen. Alles hielt den Atem an, wenn er sich näherte, und besonders die Kinder hatten unter seinen ständigen Rügen und Nörgeleien zu leiden. So waren alle froh, wenn er wieder in seinen Gemächern saß und ungefähre Berechnungen über den Lauf der Gestirne anstellte – er hatte nie genau studiert, wie man dies wissenschaftlich durchführen könne. Das überließ er seinen Hofastrologen und -astronomen, die in seinem Auftrag zu arbeiten hatten. Alles, was mit der Zukunft zusammenhing, interessierte ihn brennend, und je mehr er versuchte, durch allerlei Künste Einblick in ferne Zeiten zu gewinnen, desto mehr vergaß er die Gegenwart und überließ sehr bald die Politik seinem jungen Sohn Maximilian. Er aber konnte sich zu kuriosen Experimenten zurückziehen, bei denen ihn die Hoffnung leitete, doch noch blinkendes Gold in den Phiolen zu entdecken oder das »Lebenswasser« ausfindig zu machen, ein Allheilmittel für sämtliche Krankheiten.
Friedrich gilt als der ewige Zauderer auf dem Thron, die »Erzschlafmütze des Reiches«; bedenkt man aber, dass er sich diese Rolle nicht hat aussuchen können, so urteilt man doch verständnisvoller über einen Mann, der lieber Alchimist oder Medicus geworden wäre oder als Einsiedler sich ganz seinen Versuchen hingegeben hätte. Friedrich war ein Sonderling, der nie hätte heiraten dürfen. So war er nicht nur selbst unglücklich in seinem Amt, er vergällte auch seiner Frau und seinen Kindern das Leben.
In seinen letzten Lebensjahren war der seltsame Kaiser beinahe zur Legende geworden. Er lebte nun zurückgezogen in Linz, wo er in seinem Garten Blumen und Gemüse anbaute. »Stolz wie ein König« zeigte er sich, wenn seine Früchte die größten und schönsten in der ganzen Umgebung waren. Die Bauern liebten ihn und zogen ehrerbietig die Mützen, wenn er in der Kutsche vorbeifuhr; die Vertreter des Adels und der Geistlichkeit freilich rümpften die Nase, wenn sie hörten, dass der Kaiser nicht zu Pferd übers Land fahre, sondern sich wie eine Frau kutschieren lasse.Da der alte Mann so anders war als die anderen, konnte es nicht ausbleiben, dass man ihm allerlei Teufelsmagie in die Schuhe schob, dass man behauptete, er fange Fliegen und sammle Mäusekot, sei verblödet und abartig. Niemand wurde zu ihm vorgelassen, der berichten hätte können, wie es um den Kaiser wirklich stand. Längst schon hatte er sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, und erst als er vom Altersbrand befallen wurde und ihm die Ärzte ein Bein amputieren mussten, wurde man wieder auf ihn aufmerksam. Es grenzte an ein Wunder, dass die mit äußerst primitiven Mitteln durchgeführte Amputation glückte. Obwohl sich der Kaiser auch erstaunlich rasch erholte, verschied er aber dennoch kurze Zeit darauf ganz plötzlich: Wie die Ärzte konstatierten, hatte er zuviel Melonen gegessen.
Ein ungeliebter, unbekannter und vielfach auch verkannter Kaiser war tot. Schon zu Lebzeiten hatten hervorragende Künstler in seinem Auftrag ein Hochgrab im Stephansdom zu Wien errichtet; hier wollte Friedrich allein beigesetzt werden. Eleonore ruhte schon seit langem in Wiener Neustadt. Man zögerte, den Leichnam nach Wien zu überführen, in die Stadt, mit der er zu Lebzeiten so große Schwierigkeiten gehabt hatte. Aber die Volksseele ist wandelbar, besonders das Gemüt der Wiener: Jetzt waren alle verstummt, die ständig mit dem Kaiser unzufrieden gewesen waren. Hunderte säumten seinen letzten Weg, und so mancher, der Friedrich zu Lebzeiten gehasst hatte, wischte sich nun heimlich eine Träne aus dem Auge. Der Tod ließ vergessen, dass niemand diesen Kaiser haben wollte, der nicht für dieses Amt geboren war und sich ein Leben lang selber im Weg gestanden hatte.