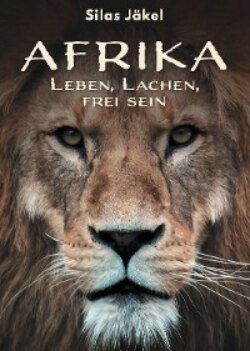Читать книгу Afrika - Leben, Lachen, frei sein - Silas Jäkel - Страница 11
FÜNF ROTE LÖWINNEN (CHAPTER FOUR)
ОглавлениеMit müden Augen schaute ich verschlafen in den Spiegel der Bordtoilette und beobachtete, wie einzelne Wassertropfen langsam über mein Gesicht kullerten. Ich hatte vielleicht zwei Stunden in der Nacht geschlafen und man sah es mir auch an. Darüber täuschte auch das erfrischende kalte Wasser nicht hinweg, das ich mit mehreren Schüben in mein Gesicht geklatscht hatte. Gefühlt alle paar Minuten wachte ich auf, um dann festzustellen, dass wir immer noch nicht am anderen Ende des afrikanischen Kontinents angekommen waren. Jetzt lag der Flughafen von Johannesburg noch gute dreißig Minuten von uns entfernt. Zeit genug, um sich wie die anderen Passagiere im ein Quadratmeter großen WC frisch zu machen und die letzten Erinnerungen an die Nacht im Gesicht verschwinden zu lassen. Frühstück hatte es bereits gegeben. Ich putzte mir die Zähne und sprühte ein wenig Parfüm auf mein frisches T-Shirt. Das andere hatte ich in der Nacht ordentlich nassgeschwitzt. Ich öffnete die schmale Tür, die ich vor ein paar Minuten kaum geöffnet bekam, und zwängte mich vorbei an der wartenden Toilettenschlange. Zurück in der Sitzreihe drehte sich Richie mit seinen Beinen in den Gang, sodass ich mich an ihm vorbei auf meinen Platz quetschen konnte. Unauffällig stopfte ich dort das müffelnde Shirt in eine leere Seitentasche des Rucksacks. Den Kulturbeutel mit den Zahnputzsachen verstaute ich bewusst woanders. Richie hatte sich wieder hingesetzt und studierte interessiert die Wetteraussichten auf seinem Bordcomputer.
„Weather for today looks good …“ Er hatte sich auf der Toilette bereits eine kurze Hose angezogen und seine Füße mit Flip-Flops dekoriert. Ich dagegen trug immer noch meine lange Jeans.
„How much degrees?“
„27“, antwortete Richie euphorisch. Jetzt bereute ich, dass ich keine kurze Hose im Handgepäck hatte. Schon beim Gedanken an siebenundzwanzig Grad sammelte sich Wasser in meiner Kniekehle. Ich schaute wieder aus dem Fenster und dann sah ich sie: die Sonne. Ihre Strahlen trafen auf mein Gesicht und brachten es zum Lächeln. Zum letzten Mal hatte ich sie vor gut einer Woche gesehen, als ich mit ein paar Freunden in Holland am Meer war. Es tat gut, sie zu sehen und von ihr begrüßt zu werden. Während die Sonne am Himmel immer höher kletterte, verringerte sich unsere Flughöhe mehr und mehr. Autos, Häuser und Straßen tauchten am Boden auf. Kontrolliert leitete der Pilot den Sinkflug ein. Wie auf einer Rolltreppe näherten wir uns immer mehr dem Boden, ehe wir auf der Landebahn aufsetzten und landeten. Ich schüttelte beim Gedanken ungläubig den Kopf. Ich war in Afrika gelandet und hatte den langen Flug problemlos überstanden. Es war kein Traum, in dem ich mich befand. Kein Traum, der durch das nervige Geräusch des Weckers hätte beendet werden können. Ich war wach und näherte mich dem großen Gebäude, auf dem Airport Johannesburg stand. Stolz, den Schritt gemacht zu haben, wartete ich darauf, dass wir unseren Stellplatz erreichten und ich meinen Platz verlassen durfte. Ich konnte kaum erwarten, afrikanischen Boden zu betreten. Die lange Hose war mir dabei jetzt erst mal egal …
„Pardon?“ Das Flugzeug hatte mittlerweile seine Gangway erreicht. Die meisten Passagiere wuselten schon wild durcheinander, zogen ihre Handgepäckstücke aus der Ablage und warteten, bis der Vordermann endlich weiterging. Richie und ich saßen noch auf unseren Plätzen. Wir hatten gerade andere Probleme.
„Pardon?“ Verständigungsprobleme. Richie hatte mich schon wieder nicht verstanden. Ich war gerade dabei, ihm meinen Namen zu buchstabieren, bisher jedoch ohne Erfolg. Immer hörte er einen anderen Buchstaben heraus. Ich versuchte es anders:
„Siegfried, Ida, Leon, Anton, Siegfried, Joachim …“
„Wow, wow, wooow. Bro, that is your Instagram name? So many names?“
„Jesus, no.“ Beim Gedanken an so einen Namen und den dazu von den Behörden auszustellenden Personalausweis musste ich lachen. „I’m only trying to spell my name. Silas - S like Siegfried, I like Ida …“ Richie verstand und tippte den Namen in seinen Notizen auf dem Handy ab.
„Alright, I will add you.“ Er stand auf, stellte sich in den Gang und warf sich seinen Rucksack auf den Rücken. Zusammen trotteten wir mit unseren Rucksäcken hinter den anderen aus dem Flugzeug. Auf dem Gang zu der Passkontrolle verabschiedeten wir uns:
„Enjoy your time in Africa. It was really nice to meet you.“
„I will let you know on insta in my story. All the best for you. Bye Richie.“
„Bye Siles.“ Siles? Hatte er gerade Siles gesagt? Ich musste lachen. Klang irgendwie witzig und lässig - Siles. Entspannt und gut gelaunt schlenderte ich mit meiner Herbstjacke hinter den anderen Fluggästen her über den fliesenbedeckten Flughafengang. Neugierig schaute ich mich um. An den Wänden hingen überall große Bilder und Werbeplakate. Banken, SIM-Kartenanbieter und Safariunternehmen warben mit Tierporträts von den Big Five oder lachenden Kindern für ihre Produkte.
„Get Connected. Explore South Africa.“ Ja, eine Safari würde ich auch gerne mal machen, dachte ich mir, als ich vor einem Nashorn stehenblieb, das mich von der Wand anschaute. Irgendwann mal, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt …
Vor der Passkontrolle bildete sich bereits eine lange Schlange. Nur langsam ging es voran. Die Kontrolleure schienen es nicht eilig zu haben und scannten jeden Ausweis mehr als gründlich. Es dauerte bestimmt fünfundvierzig Minuten, bis ich endlich den ersten afrikanischen Stempel in meinem Reisepass begrüßen durfte. Um ehrlich zu sein, war es auch der erste Stempel im gesamten Pass, schließlich war dieser erst wenige Monate alt und noch nie genutzt worden. Es war zwölf Uhr Ortszeit und ich beschloss, erst mal weiter durch den Flughafen zu laufen. Ich hatte ja keinen Zeitdruck. Der Flug nach Windhoek sollte erst in zweieinhalb Stunden gehen. Vielleicht gab es hier ja ein paar Souvenirläden und Restaurants zu entdecken. War ja auch schon Mittag. Erleichtert stellte ich fest, dass die Restaurants geöffnet waren. Langsam bekam ich auch schon wieder Hunger. Ohne wirkliches Ziel lief ich erst mal den anderen Fluggästen nach und ließ mich in ihrem Sog mit durch die Gänge ziehen. Immer wieder starrte ich beim Laufen auf mein Handy und versuchte, mich mit dem Flughafen-WLAN zu verbinden. Schließlich hatte ich meinen Eltern ja versprochen, mich zu melden, sobald ich in Afrika gelandet war. Doch leider scheiterte es jedes Mal bei der Anmeldung. Nachdem fünften Log-in-Versuch stopfte ich es leicht genervt zurück in die Hosentasche und schaute mich um. Von den anderen Passagieren, die gerade noch eilig vor mir hergelaufen waren, fehlte jede Spur. Ich musste in den letzten Minuten echt schneckenartig unterwegs gewesen sein. Irgendwo würde ich schon gleich rauskommen. Mein Blick fiel auf einen dunkelhäutigen Mann, der sich an eine Säule lehnte. Er trug eine orangefarbene Weste und wie ich eine lange Jeanshose. Er grinste mich freundlich an. Ich grinste zurück und machte mit meiner Hand eine grüßende Bewegung. Wahrscheinlich gehörte er zum Flughafenpersonal und half als Servicekraft umherirrenden Fluggästen, die unter Zeitdruck nach dem nächsten Gate suchten und vor lauter Stress komplett den Überblick verloren. Zum Glück gehörte ich denen in beiderlei Hinsicht nicht an. Der Mann hatte mein Winken gesehen und steuerte mit schnellen Schritten auf mich zu. Bestimmt dachte er, dass ich Hilfe brauchte und ihm deswegen zugewunken hatte.
„Hey, welcome in Johannesburg“, begrüßte er mich und reichte mir seine Hand. Ich schlug dankend ein. „Can I help you, my friend?“ Er dachte wirklich, dass ich Hilfe brauchte.
„No, thank you.“ Das mit dem Flughafen-WLAN würde ich schon irgendwie allein hinkriegen. Und Schilder konnte ich auch lesen. Ich setzte mich mit meinen Sachen wieder in Bewegung. Zu meiner Überraschung lief er neben mir her.
„Where are you from, my friend?“
„Germany.“
„Ahh Deutzland. Hallo, wie gehts?“ Er grinste. „I speak a little bit Deutsch, haha.“
„Your German is good. Nice. Why do you speak German?“ Ich wusste, dass viele Einheimische in Namibia deutsch sprachen, doch Südafrika war mir neu. Ich erfuhr von ihm, dass er sich gerne mit deutschen Touristen am Flughafen unterhielt und mit jeder Begegnung neue Wörter lernte. Ich musste mit meinen Augenringen anscheinend ziemlich deutsch ausgesehen haben. Zumindest hatte er mich direkt als Deutscher erkannt. Ich erzählte ihm, dass meine Familie ursprünglich aus Österreich und den Niederlanden kam in der Hoffnung, dass er vielleicht ein paar Brocken Österreichisch auspackte. Das hätte ich mir witzig vorgestellt. Stattdessen bot er an, mich zur Abflughalle zu begleiten
„What is your gate?“ Ich kramte nach meinem Reisepass, in dem ich die Tickets ja deponiert hatte.
„Boarding time 2 pm from Gate A18.“
„Gate A18, alright.“ Wie aus dem Nichts nahm er mir das Ticket aus den Händen.
„Hey, what are you doing?“
„I will show you the way. Follow me.“ Er beschleunigte seinen Gang. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen und wunderte mich, warum er jetzt so aufs Tempo drückte. Ich hatte doch alle Zeit der Welt und wollte noch gar nicht zum Gate. Doch ich wollte nicht unhöflich sein und sein Angebot ablehnen.
„What is your job here at the airport?“
„Helping airport guests is my job“, antwortete er kurz und knapp. Ach echt? Wir steuerten in der Flughalle einen Check-in-Automaten an. Während er sich am Automaten zu schaffen machte, schaute ich mich in der Gegend um. Überall liefen Menschen durch die Gegend, stöberten in Souvenirläden oder blickten gespannt auf die Abflugzeiten auf der Anzeige. Das ganz normale Chaos am Flughafen halt, so wie ich es schon in Düsseldorf erlebt hatte. Nur der Airport Zürich tanzte da aus der Reihe. Insgesamt zählte ich fünf Mitarbeiter mit orangefarbenen Westen, die die Koffer von Passagieren auf Gepäckwagen durch die Gegend rollten. Mein persönlicher Flughafenmitarbeiter tippte derweil noch immer die Flugdaten am Display ein.
„How many colleagues do you have? I can count only five.“ Ich konnte mich echt glücklich schätzen, dass ich einen abbekommen hatte.
„I do not know. We are all self employed. Ah yes.“ Er hielt ein frischgedrucktes Ticket in den Händen und zerriss das alte. „Hey, my ticket. Why do you do that?“, entgegnete ich erschrocken.
„I made the check-in for you. You are welcome.“ Er grinste freundlich und reichte mir das neue Flugticket. Ich nahm es entgegen und steckte es schnell in meine Hosentasche. Sicher ist sicher. „Thank you, but it was not necessary. I already did the check-in in Germany.“
„You have to do that here as well.“
„But …“
„You are welcome. Follow me. I bring you to the gate, my friend.“ Er ergriff meinen Ärmel und zog mich ein Stückchen hinter sich her an den Automaten vorbei. Überrumpelt folgte ich ihm. Wir gingen ein paar Meter und erreichten ein Schild, auf dem mehrere Gates draufstanden.
„Here we are.“ Er deutete auf das Schild mit Gate A18. Ich schaute ihn überfordert an. Wir standen noch immer in der Abflughalle. Das Schild hätte ich locker auch allein gefunden. „Ähm okay.“ Ich nickte und setzte ein gezwungenes Lächeln auf. „Thank you for your help. Have a nice …“ „What is with a tip?“, unterbrach er mich. Er drehte sich hektisch zu allen Seiten um, als sei er gerade auf der Flucht. „Tipp?“ Warum wollte er den jetzt einen Tipp von mir haben? Und vor allem für was? Ich schaute ihn fragend an. Erst als er seinen Daumen und Zeigefinger aneinanderrieb verstand ich, worauf er hinauswollte: Trinkgeld.
„Yes, a tip. For the way to the gate and printing out your ticket, äh, for the check-in.“ Wieder schaute er sich ungeduldig nach allen Seiten um. „Ah, you mean tip. Money. Sag das doch gleich!“ Ich setzte meinen Rucksack ab und holte den weißen Umschlag heraus, in dem ich meine bestellten namibischen Dollar aufbewahrte. Die Scheine schimmerten in allen möglichen Farben. Gelb, grün, lila, blau, rot. Auf den meisten Scheinen waren Springböcke zu sehen, auf manchen waren sogar die Körper von Büffeln und Löwen abgedruckt. Das Geld hier hatte echt seinen Charme. Kein Vergleich zu Euro-Noten, auf denen langweilige Brücken oder Frauen mit Hochsteckfrisuren zu sehen sind.
Ich blätterte durch die Löwen und Büffelköpfe. Ich hatte keine Ahnung, wie viel ich ihm geben sollte. Zumal ich auch gar nicht mehr wusste, wie der Umrechnungskurs von Rand zu Euro war.
„How much do you want?“(-> Fehler Nummer 1 an diesem Tag).
„Five hundred!“ Ohne zu überlegen reichte ich ihm fünf rote Löwinnen. Ein wenig überrascht nahm er die hundert Dollarscheine schnell entgegen und steckte sie in seine Westentasche. „Ähh …“ Ich glaube, er hatte sich mental aufs Handeln und Feilschen eingestellt. „Thank you?“
„You are welcome.“ Ich lächelte und steckte den Briefumschlag mit den restlichen Tieren zurück in die Tasche. Ich hoffte, dass ich ihn und seine aufdringliche Freundlichkeit nun endlich los war. Doch er ging nicht.
„I can bring you to security check.“
„No thank you. I just want to go to the store to buy some …“
„Follow me.“ Er ließ ein Nein meinerseits nicht gelten. Zwanzig Meter hinter dem Gate-Schild blieb er stehen. Wir standen jetzt direkt vor der Sicherheitsschleuse.
„Here we are.“
„Yes, here we are. Thank you. Have a nice day. Bye.“
„Hey, hey, hey. My friend.“ Er grinste. „What is with a second tip? For the way to the security check …“
Es folgt Fehler Nummer 2 an diesem Tag, der ein wenig an Fehler Nummer 1 erinnerte:
„How much?“
„300.“ Er streckte seine Hand grinsend aus. Wieder holte ich den Umschlag aus meinem Rucksack hervor. Ich gab ihm zwei grüne Antilopen und einen lila Büffel.
„Here, but that is the last tip today.“ Er nickte, verabschiedete sich und lief davon. Was ein Typ, dachte ich und setzte meinen spürbar leichter gewordenen Rucksack wieder auf. Wenige Meter später legte ich ihn bei der Sicherheitskontrolle behutsam in eine graue Kiste, mit der er dann auf dem Rollbrett durch den Tunnel zum Scannen geschoben wurde. Auf der anderen Seite des Tunnels durfte ich ihn vor dem Aufsetzen noch mal vor den Augen eines Sicherheitswachmannes ausräumen, ehe es dann mit einer voller Cola-Flasche weniger zum Ausreisestempeln ging.
Fassungslos begutachtete ich meinen Pass. Ich saß auf einer Bank und hatte eigentlich perfekte Sicht auf die Landebahn, doch das interessierte mich jetzt nicht. Dieser eine Stempel auf der zweiten Seite im Reisepass ließ mich nicht los. Gute fünfzig Euro hatte er mich gekostet. Fünfzig Euro oder anders ausgedrückt: Fünf rote Löwen, zwei grüne Antilopen und ein lila Büffel. Achthundert Rand - gut ein Drittel meines Geldes war weg. Dreitausend hatte ich insgesamt mitgenommen. Jetzt waren es nur 2200, und das nach einem Tag. Wie sollte das nur weitergehen? Mit angesäuertem Blick wuschelte ich mit der Hand durch meine Haare in der Hoffnung, eine Erklärung zu finden. Ich war richtig sauer und angepisst. Sauer auf mich selbst, weil ich so naiv war. Wie konnte ich bitte nur so dumm und naiv gewesen sein? Wie konnte ich mich nur so abziehen lassen? Wie? Wie ich es auch drehte und wendete, es ließ sich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Kopfschüttelnd verstaute ich den Pass mit dem teuren Stempel-Souvenir wieder in meinem Rucksack und widmete mich meinem Handy. Ich konnte den Pass nicht mehr sehen. Zumindest funktionierte jetzt das Flughafen-WLAN. Wenigstens eine Sache im Vergleich zu meinem gesunden Menschenverstand. Ich ging auf WhatsApp in die Familiengruppe und las die Nachrichten, die ich seit Zürich zugeschickt bekommen hatte.
„Schlaf schön und melde dich morgen, wenn du gelandet bist. Gute Nacht. :*“ (Mama, um 22:30 Uhr).
„Guten Morgen. Hast du schlafen können? Wie war der Flug? Deine neugierige Mutter, hihi. ;D“ (Mama, um 11 Uhr).
„Hey Silas, bist du schon gelandet? Papa.“ Ich starrte auf den Chatverlauf und überlegte, was ich ihnen schreiben sollte. Sie sollten sich bloß keine Sorgen machen und nicht wissen, dass ich gerade abgezogen worden war. Ich beschloss, ihnen die Geschichte mit dem selbstständigen Flughafentypen erst zu erzählen, wenn ich zurück in Deutschland war. Wenn es dazu überhaupt kommen sollte. Wenn mich schon ein einfacher Mitarbeiter am Flughafen übers Ohr haut, was macht dann erst ein echter Löwe oder Gepard mit mir auf der Farm? Während ich leicht verunsichert war und mein Selbstbewusstsein im Keller suchte, deutete meine Nachricht auf das komplette Gegenteil hin:
„Bin gerade gelandet. Mir geht es super. Alles läuft bisher nach Plan. Außer kurzen Turbulenzen über Tunesien keine Vorfälle. Gehe jetzt was essen und melde mich, wenn ich in Windhoek gelandet bin.“ Ein grinsender, fröhlicher Smiley fehlte in der Nachricht. Was sollte ich auch anders schreiben, um meine Eltern nicht zu beunruhigen?
Fröhlich und mit einem breiten Grinsen schaute ich zwei Stunden später aus dem Fenster. Die vielen Wolkenberge hatten meinen Ärger über die 800 Rand vergessen lassen. Große weiße Wolken, die sich zusammengeschlossen hatten und regungslos am Himmel schwebten. Jede Wolke warf einen dunklen Schatten in die sonnige Landschaft. Ein Phänomen, das ich zum ersten Mal in meinem Leben beobachten konnte. Damals nach Hamburg war es bewölkt und dunkel gewesen. Fasziniert knipste ich von dem Wolkentreiben ein paar Bilder. Alles sah so herrlich aus. Das strahlende Weiß der Wolken, der tiefblaue Himmel und die afrikanische Savanne darunter, die von lauter Bäumen und Büschen übersät war. Nur das Geräusch der Turbinen erinnerte einen daran, dass man sich gerade in einem Flugzeug befand und kein Vogel war.
„Sir, do you want to eat or drink something?“ Der Essenswagen war mittlerweile in unserer Sitzreihe angekommen. Es gab irgendein Fleischgericht, dazu Kartoffeln und Gemüse. „Sir?“ Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass der Mann von South African Airlines mit mir sprach. Gedankenverloren hatte ich seit dem Start die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut.
„Just a water for me. Thank you.“ Dankend nahm ich die kleine Wasserflasche entgegen. Obwohl ich vor gut einer Stunde noch eine ganze Kanne Rooibostee getrunken hatte, hatte ich jetzt schon wieder einen Höllendurst. Der Geschmack vom Mittagessen lag noch immer auf der Zunge. Zusammen mit frischen Strauchtomaten, sämtlichen Kräutern und Knoblauchöl wurden mir leckere Spaghetti im Restaurant serviert. Sie schmeckten herrlich. Noch nie hatte ich in Afrika so gute Pasta gegessen. Selbstverständlich gab ich der Kellnerin Trinkgeld. Diesmal hatte der Tip eine Null weniger. Zufrieden und noch immer gut gesättigt schaute ich zu meiner Sitznachbarin, die sich gerade ein großes Stück Fleisch mit Soße auf die Gabel schob. Sie war recht stämmig und gut gebaut und trug ein großes Kleid mit verschiedenen Mustern und Symbolen drauf. Ein bisschen sah sie wie ein Pfau aus, zumindest präsentierte sie so voller Stolz ihr Gewand.
„Enjoy your meal.“ Ich lächelte ihr zu. Freundlich lächelte sie mit vollen Hamsterbacken zurück. Sie hatte sich für den Gockel mit Reis entschieden und es schien ihr gut zu schmecken.
„No, no thank you, I do not want.“ Sie hatte ihren Teller in meine Richtung geschoben, doch ich lehnte dankend ihr Angebot zum Probieren ab. „I am full, haha. I had pasta at the airport.“ Sie nickte und widmete sich wieder ihrem Teller. Vor dem Start hatten wir uns ein wenig über meine Reise und das Thema Religion unterhalten. Mary arbeitete für die evangelische Kirche und war auf dem Heimweg nach Windhoek. Sie hatte erzählt, dass sie für die Kirche durch die ganze Welt flog, um Gottesdiente abzuhalten und mitzugestalten. Sogar in Wuppertal sei sie schon mal gewesen und mit dem „flying train“ gefahren. Mit ihrer Frage, ob ich religiös sei, hatte sie mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich wusste es nicht so richtig. Ich ging zwar immer Heiligabend mit meiner Familie in die Kirche, doch als wirklich religiös würde ich mich nicht bezeichnen. Zumindest hat mein Glaube nichts mit Religion oder irgendeiner Ideologie zu tun. Meiner Meinung nach ist Religion ein sehr missbrauchtes Wort, dass mehr spaltet als vereint. Es gibt eine Unterteilung in Christen, Juden oder beispielsweise Muslime, jedoch heißt es in jeder Religion „Wir und die anderen.“ Ich finde es gut und schön, wenn Menschen Kraft, Halt oder eine Aufgabe in ihrer Religion/in ihrem Glauben finden, jedoch sehe ich auch eine Gefahr, wenn man sich selbst zu sehr mit der eigenen Religion und deren Auslegung identifiziert. Siehe Glaubenskriege auf der Welt. Dementsprechend war auch meine Antwort auf ihre Frage etwas differenziert:
„I believe, but not in a religious way. I believe in life and I would describe myself as a spiritual person. For me life is energy. Belief is an energy. You are energy. Yes, I am Christian, and I go to church on Christmas, but I am not religious. I am a believer, but not a religious believer. I believe in god, but god is for me life, you know.“ Sie verstand was ich meinte und freute sich über meine Antwort. Für sie war Glaube auch Energie, die Menschen, speziell vielen Menschen in Afrika, Kraft und Hoffnung spendete. Sie fand es schade und traurig, wenn Menschen im Namen ihrer Religion Kriege führten. Für sie hatte das nichts mit Religion zu tun. Glaube sei Liebe und verbinde Menschen, anstatt zu töten, meinte sie.
„Love what you do, my friend“ Sie machte eine kurze Pause und lächelte. „ Be grateful for what life or God has given you. Love your life and love yourself. You are love, life is love.“
Die Klimaanlage in Georgs Auto fühlte sich an wie ein heißer Föhn. Ich glaube, dass es ihm Spaß machte, mir die ganze Zeit heiße Luft ins Gesicht zu pusten. Die letzte Inspektion des Wagens musste schon Jahre zurückgelegen haben. Dank dieser Tatsache floss mir das Wasser wie ein reißender Bach die Schläfe hinunter, um von da auf meine Jeans zu tropfen. Die Jeans. Ich konnte den Moment kaum erwarten, wo ich sie mir von den Beinen reißen, gegen irgendeine Wand feuern und dann wild auf ihr herumtrampeln würde. Sie klebte wie ein Taucheranzug an meinem Körper. Mit jeder Hitzewelle entwickelte ich immer mehr Hass auf sie. Sie fühlte sich so eklig und falsch an meinem Körper an. Ich schwor mir, sie in den nächsten vier Wochen regelrecht zu ignorieren und sie keines Blickes zu würdigen. Was ich nicht ignorieren konnte, war die Temperaturanzeige im Auto. Sie zeigte 28 Grad an, doch das kaufte ich ihr nicht ab. Es waren bestimmt vierzig. Die Nachmittagshitze brannte ohne Pausen auf das Autodach herab und es machte nicht den Anschein, dass sie damit in den nächsten Minuten aufhören würde. Am Himmel war keine einzige Wolke zu sehen, die für einen kurzen Moment hätte Schatten spenden können. Seit gut zwanzig Minuten fuhren wir vorbei an ausgetrockneten und verbrannten Wiesen, auf denen ab und zu abgemagerte Rinder in der prallen Sonne standen und uns hinterherschauten. Georg war Mitarbeiter der Unterkunft, die für die nächste Nacht mein Schlafplatz und Zuhause sein sollte. Mitten in Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Er hatte mich am Hosea Kutako International Airport abgeholt. Dieser lag mitten in der Pampa. Mit einem Schild, auf dem in Sauklaue mein Name stand, hatte er auf sich aufmerksam gemacht und mir zugewunken. Wie seine Schrift war auch sein englischer Akzent. Sein Nuscheln war kaum zu verstehen. Manchmal wusste ich gar nicht, wovon er gerade sprach und was er meinte. So lachte ich dann, wenn er auch lachte, oder nickte einfach nur, wenn ich es für richtig und angebracht hielt. Manchmal redeten wir auch gar nicht und starrten nach vorne auf die asphaltierte Straße, die uns über kleine Hügel und ausgetrocknete Flüsse führte. Oft erschrak ich, wenn ein Auto am Horizont aus der verschwommen Bodenhitze auftauchte und auf uns zufuhr. Nicht selten sah ich schon von Weitem eine Kollision kommen und meine Reise mit einem lauten Knall enden. Erst als wir dann links am entgegenkommenden Auto vorbeifuhren, erinnerte ich mich daran, dass in Namibia ja Linksverkehr herrschte. Der gute, alte Linksverkehr. Neben der unausstehlichen Hitze war der Linksverkehr wirklich die größte Umstellung für mich bisher. Auf dem Parkplatz wollte ich schon rechts ins Auto einsteigen und wunderte mich, als ich plötzlich ein Lenkrad am Beifahrersitz entdeckte. Georg staunte nicht schlecht, als er nach dem Verstauen meines Gepäcks im Kofferraum plötzlich jemandem auf seinem Fahrerplatz sitzen sah.
„Do you want to drive?“, sagte er lachend in meine Richtung und wartete geduldig, bis ich die Situation verstand und den Platz mit ihm tauschte.
Rums. Wieder ein Lkw, der mit vollem Tempo an uns vorbeirauschte und eine große Sandwolke aufwirbelte. Ich hatte ihn so schnell gar nicht kommen sehen.
„It‘s so dry.“ Georg betätigte den Scheibenwischer, um die vielen aufgewirbelten Sandkörner von der Frontscheibe zu entfernen.
„We had rain five weeks ago. This year is very dry.“ Er lachte. Die Scheibenwischer funktionierten nicht. Nach der defekten Klimaanlage wunderte mich das nicht.
„Five weeks“, entgegnete ich ihm ungläubig. Der Lkw und die Staubwolke wurden im Rückspiegel immer kleiner. „Why do I need a rain-jacket?“ Ich dachte an meine Sieben-Euro-Regenjacke von Decathlon, die ich auf den letzten Drücker noch gekauft hatte. Bis vor drei Tagen war ich noch davon ausgegangen, dass ich eine Jacke besaß, ehe ich beim Kofferpacken eines Besseren belehrt wurde. Ich fragte mich echt, warum sie mit auf der Packliste stand.
„It does not often rain here. Especially in Windhoek or in this area“, erklärte mir Georg, während er einen langsameren Transporter auf der Spur überholte. „But it is rain season in Namibia. Sounds strange, but it is true. I think you will experience a lot of rain when you live on the farm or you go to Etosha.“
„Seriously?“ Beim Blick auf den wolkenlosen Himmel klangen seine Worte wirklich strange. Ich hatte zwar keine Ahnung, was er mit Etosha meinte, konnte mir aber nur schwer vorstellen, dass es in den nächsten Wochen irgendwo mal ein Regentröpfchen geben sollte.
„Difficult to imagine. In Germany we have a lot of rain. Especially in Wuppertal.“
„Wuppertal. What is that?“ Ich erzählte ihm von der Schwebebahn und meiner Heimat. Zu meiner Überraschung gab es zwischen Windhoek und meiner Heimatstadt viele Gemeinsamkeiten. Windhoek war vom Profil ähnlich hügelig. Es ging rauf und runter. Viele Häuser waren in den Berg gebaut, ähnlich wie zu Hause im Bergischen Land. Neugierig schaute ich aus dem Fenster und beobachtete das bunte Treiben auf den Straßen. Es war viel los in Windhoek. Die meisten Menschen hatten jetzt wahrscheinlich Feierabend und machten sich auf zu ihren Wohnungen und Familien. Ich erinnerte mich an die Worte meines Nachbarn, der mir von den vielen deutschsprachigen Straßennamen erzählt hatte. Es war unglaublich: Auf jedem zweiten Straßenschild war ein deutscher Name zu lesen: Bismarckstraße, Gartenstraße oder Schusterstraße, um nur wenige zu nennen. Auch die vielen deutsch benannten Schulen und Universitäten erinnerten an die deutsche Kolonialzeit vor hunderten Jahren. Alles wirkte sehr deutsch, bis auf die brüllende Hitze vielleicht. Erleichtert stieg ich vor einem quietschgelben Haus aus Georgs aufgewärmtem Auto. Per Knopfdruck öffnete er das grüne Einfahrtstor und begrüßte im Vorbeigehen einen neugierigen Papagei, der uns in seinem grünen Federkleid und mit lautem Gekreische hallo sagte. An der Rezeption stellte mir Georg seinen Sohn vor. Dieser war wie sein Vater braungebrannt, sprach zum Glück aber besser Englisch als er. Ich füllte einen Zettel mit meinen Daten aus und bezahlte meine Übernachtung mit Kreditkarte.
Mein Zimmer lag in der ersten Etage. Georgs Sohn half mir beim Tragen des Koffers und wünschte mir einen schönen Aufenthalt und viel Spaß auf der Farm, ehe er sich zum Rugby-Training verabschiedete. Jetzt wusste ich auch, warum er meinen schweren Koffer mühelos mit einer Hand die schmale Treppe hatte hochtragen können. Er hatte Pranken wie ein Bär, Waden wie die eines ausgewachsenen Stieres und Muskeln an Stellen, an denen ich noch nicht mal Stellen hatte. Ich wollte gar nicht wissen, welche Gewichte er beim Bankdrücken stemmte. Auch wenn meine Oberschenkel von der Größe her zusammen einen seiner Oberschenkel ausmachten, tat ich mir schwer, sie aus der nassgeschwitzten Jeans zu bekommen. Ich hüpfte fast eine halbe Minute auf meinem rechten Bein durchs Zimmer, ehe ich mein linkes befreien konnte. Schnell hopste ich ins Badezimmer in der Hoffnung auf eine erfrischende kalte Dusche. Auch wenn das lauwarme, nach Chlor riechende Wasser aus dem Duschkopf nicht ganz meine Erwartungen erfüllen konnte, fühlte ich mich danach wie neugeboren. Erfrischt und gut gelaunt legte ich mich in kurzen Shorts aufs Bett, streckte alle Beine und Arme von mir und atmete einmal durch.
21 Stunden, nachdem ich zum ersten Mal die Stimme von Franz Huber gehört hatte, war ich endlich da. 21 aufregende und intensive Stunden voller neuen Erfahrungen. Viele neue Menschen hatte ich bereits kennenlernen dürfen. Viele Sachen und Dinge sehen und erleben können. Ich setzte mich in den Schneidersitz und tippte eine Nachricht für zu Hause ab: „Bin jetzt in der Unterkunft und gehe gleich noch Pizza essen. Melde mich morgen.“
Ich legte das Handy auf den Nachttisch und stöpselte es, verbunden mit dem Aufladekabel, in die Steckdose dahinter. Die Batterie am Bildschirm leuchtete grün auf. Ich schnappte meine Wasserflasche, zog meine Flip-Flops an und die Zimmertür hinter mir zu. Mit Sonnenmilch und Brille bewaffnet ging ich nach draußen zur Treppe und setzte mich auf die oberste Stufe. Dort beobachte ich in aller Ruhe, wie die Sonne mit ihren warmen Strahlen hinter den Hügeln Windhoeks verschwand und den Abend einläutete.