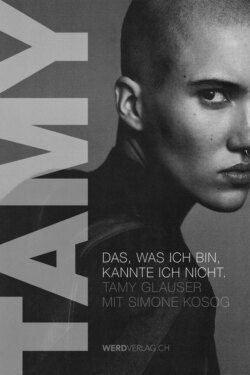Читать книгу Tamy - Simone Kosog - Страница 7
Оглавление«DU BIST EBEN ANDERS!»
Manchmal sagte Charlotte diesen Satz zu mir. Ich wusste nie genau, was sie damit meinte.
Meistens fiel der Satz an einem der Tage, an denen ich aufgelöst nach Hause kam, entweder, weil ich den Viertklässlern, die mich gejagt hatten, gerade so entkommen war, oder weil sie mich dieses Mal tatsächlich verprügelt hatten. Beides kam regelmässig vor.
Mal waren es die Mädchen, mal die Jungs. Klar war, dass sie sich aus all den Erstklässlern genau mich herausgepickt hatten, kein Versehen. Ich kannte das schon aus dem Kindergarten. Bereits am allerersten Tag war es losgegangen. Ich hatte für dieses besondere Ereignis ein rosa Röckchen ausgewählt, das ich in einem Geschäft gesehen hatte und unbedingt haben wollte. Abgesehen von einem Tutu, ebenfalls in Rosa und ebenfalls heiss begehrt, war das der einzige Rock, den ich je freiwillig angezogen habe. Ich fand ihn wunderschön – die anderen Kinder fanden das ganz offensichtlich nicht. Sie nutzten die erstbeste Gelegenheit, mich draussen, als kein Erwachsener zusah, hin- und herzuschubsen und in den Matsch zu werfen. Als ich nach Hause kam, weinte ich. Das rosa Röckchen war dreckig und zerrissen, ich zog es nie wieder an.
Auch jetzt, während der Schulzeit, kamen sie immer zu mehreren, mal warfen sie mich in einen Dorfbrunnen, mal klauten sie mein Fahrrad und warfen es in eine Mülltonne, mal traten, schubsten oder schlugen sie mich.
Auf meinem Schulweg lag ein grosses Feld, über das ich meist nach Hause ging. Eine Abkürzung, denn gleich dahinter begann unser Grundstück. Für meine Widersacher war das der perfekte Ort, mir klarzumachen, was sie von mir hielten. Ich weiss noch, wie ich einmal an einem Wintertag dort entlang ging, als ich sie schon von weitem kommen sah. Ich rannte so schnell ich konnte, nicht zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, um mein Leben zu rennen. Aber die anderen, dieses Mal waren es zwei Mädchen, waren doppelt so gross und doppelt so schnell. Doppelt so stark waren sie auch: Sie warfen mich in den Schnee, drückten mich nach unten und schaufelten mir mit den Händen Schnee ins Gesicht, immer wieder, bis mein Gesicht vollständig bedeckt war. Ich konnte nichts mehr sehen und bekam keine Luft mehr. Zum Glück hatte unser Gärtner gerade draussen gearbeitet, er rannte los und schrie. Die beiden liefen weg. Nochmal davongekommen.
Zuhause sprach ich wenig von den Übergriffen, aber dennoch liess es sich nicht vermeiden, dass meine Pflegeeltern etwas davon mitbekamen. «Du bist eben anders!», sagte Charlotte, meine Pflegemutter. Der Satz sollte mich trösten, so viel verstand ich immerhin. Anders zu sein war in ihren Augen nichts Negatives, sondern hob mich hervor aus dem Gewöhnlichen und machte mich für sie zu einem sehr speziellen, liebenswerten Menschen. Ich vermutete damals, dass ihre Worte auf meine besondere Lebenssituation anspielten. Meine leibliche Mutter lebte weit weg in den USA und arbeitete mit lauter berühmten Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihr zusammenleben, sondern war bei Charlotte und Heinz zuhause.
Aber je älter ich wurde, desto deutlicher offenbarte sich mir, dass Charlotte neben all dem und wahrscheinlich sogar in erster Linie mein Aussehen meinte, oder besser: meine ganze Art zu sein.
Ich hatte eine dieser dicken Brillen, die die Augen riesig machen, und nicht nur das: Sie hatte kreisrunde Gläser und der Rahmen war Weiss, Lila und Rosa gemustert. Meine Hautfarbe war viel dunkler als die der anderen Kinder, viel dunkler auch, als sie heute ist. Mein Grossvater mütterlicherseits stammt aus Nigeria, und damals sah man deutlich, dass es da irgendeinen Einschlag gab, wenngleich er nicht wirklich zuzuordnen war. Die Kinder riefen mir «Brillenschlange» hinterher und: «Wasch dich mal, deine Haut ist dreckig!»
Ausserdem war ich jungenhaft, hatte kurze Haare, trug Hosen, nie Röcke, nach dem Kindergarten-Debakel erst recht nicht mehr, bewegte mich auch wie ein Junge. Manchmal beglückwünschten die Leute meine Pflegeeltern oder, in den seltenen Momenten, wo wir zusammen waren, auch meine Mama zu ihrem «hübschen Sohn», was sowohl meine Pflegeeltern als auch meine Mama schnell korrigierten, während es mich nie störte. Eigentlich fand ich es sogar ganz cool.
Meistens zog ich morgens irgendwelche Klamotten aus dem Schrank. Am wichtigsten war es mir, dass ich mich wohlfühlte. Es gab ein paar Anziehsachen, die ich besonders gerne mochte, aber die gefielen den anderen Kindern selten, was sie regelmässig mit Spott und fiesen Bemerkungen kommentierten.
Ich fand mich nicht besonders schön. Ehrlich gesagt, fand ich mich sogar hässlich, aber es machte mir nicht viel aus. Mein Aussehen war keine wichtige Kategorie für mich, es war nichts, worüber ich mir besonders viele Gedanken machte.
Kein Kind bei uns im Dorf war so.
In meiner Klasse kam ich noch halbwegs klar. Ich war nicht wirklich eine Aussenseiterin und zum Beispiel immer gut im Sport, sodass ich nie in die erniedrigende Situation kam, als letzte gewählt zu werden. Aber man fand mich definitiv nicht cool und wollte ganz sicher nicht mit mir befreundet sein.
Ausserhalb der Klasse reizte allein meine Anwesenheit die Kinder offenbar so sehr und entfachte ihre Wut und Ablehnung dermassen, dass sie regelmässig alle ihre Hemmungen vergassen. Ich glaube nicht, dass sie mit dieser Haltung auf die Welt gekommen waren. Ganz früh, als ich noch die Krippe besuchte, waren die Kinder unbekümmert auf mich zugekommen, hatten mich selbstverständlich akzeptiert. Sie hatten damals weder ihre eigene Persönlichkeit noch die der anderen mit vorherrschenden Rollenbildern abgeglichen. Aber bald schon begannen Eltern, Nachbarn, Freunde, Werbeplakate und Medien damit, ihre Botschaften zu hinterlassen. Meine Mitschüler wussten bereits sehr genau, was die Gesellschaft für ein Mädchen vorgesehen hatte, wie es sich anzuziehen, zu bewegen, zu verhalten, und wofür es sich zu interessieren hatte. Davon abzuweichen, war nicht vorgesehen.
Doch egal wie bedrohlich die Situation war, egal wie erdrückend die Übermacht: Mich unterzuordnen und die Schläge über mich ergehen zu lassen war nie eine Option. Vielmehr hatte ich das Gefühl, die Stellung halten zu müssen. Ich wehrte mich, so gut ich konnte, schlug und trat zurück. Das war keine Haltung, die ich mir angeeignet hatte, sondern einfach meine Art zu reagieren. Ich habe keine Ahnung, wem meiner Vorfahren ich diese Stärke zu verdanken habe oder woher diese Energie sonst kommt, aber ich bin sehr dankbar dafür. Es war wohl diese Art zu reagieren, die mich davor bewahrte, ein trauriges Kind zu werden. Denn abgesehen von diesen unberechenbaren Überfällen, die sich durch meine gesamte Grundschulzeit zogen, ging es mir gut in meiner Welt, so verdreht sie für andere auch ausgesehen haben mag.
Dass mein Leben nicht unbedingt gradlinig verlaufen sollte, zeichnete sich schon bei meiner Geburt ab. Es war Ende Dezember 1984, als sich meine Mama und ihre Freunde in einen alten Fiat Panda quetschten, um nach Paris zu fahren und dort Silvester zu feiern. Meine Mama war damals 21 Jahre alt und neugierig auf das Leben. Mit 18 hatte sie angefangen zu modeln und war das erste farbige Model überhaupt, dass von der Agentur Elite unter Vertrag genommen wurde, ohne dass sie allerdings viel Aufhebens darum gemacht hätte. Das war für sie einfach kein Thema. Sie arbeitete unter anderem für Jean Paul Gaultier und Givenchy, Labels, für die auch ich später modeln sollte.
Im Gegensatz zu mir hatte meine Mutter durch ihr Aussehen nie Probleme und wurde wegen ihrer Herkunft nicht infrage gestellt. Zwar war ihre Haut dunkler als die der anderen Schweizer Kinder, aber sie war ein Mädchen, das von allen als süss und exotisch wahrgenommen wurde, und wenn doch mal jemand komisch guckte, waren drei enge Freunde zur Stelle, um sie zu verteidigen. Später, als junge Frau, zog meine Mutter dann ganz andere Blicke auf sich mit ihren schwarzen Haaren, den vollen roten Lippen und ihrem hellen Teint. Sie erzählte mir oft, dass sie eine Prinzessin sei, da ihr Vater in Nigeria den Status eines Königs habe. Meine Oma hatte ihn während des Studiums in Oxford kennengelernt, wo er aber, so geht die Geschichte weiter, nicht bleiben konnte, weil er zurück nach Nigeria musste, um über sein Volk zu regieren. Ich war mir nie sicher, ob das alles stimmte, bis ich viele Jahre später bei meiner Mutter eine edle, aufwendig geschnitzte und verzierte Holzkiste entdeckte, in der sich eine Urkunde befand, auf der sie tatsächlich als Prinzessin bezeichnet wurde. Damals jedenfalls sah meine Mutter aus wie die Sängerin Sade, die ja auch einen nigerianischen Vater hat.
Als sie mit den anderen auf dem Weg zu der Silvesterparty war, wohnte sie bereits wieder in Bern. Das Modeln hatte sie mehr oder weniger aufgegeben. Dass sie hochschwanger war, wusste keiner, auch nicht der junge Mann, von dem sich später rausstellen würde, dass er mein Vater ist, und der ebenfalls mit dabei war.
Meine Mama war eine schlanke Frau und ihr Bauch wohl auch nicht riesig, sie hatte gerade mal 2,5 Kilo zugenommen. Es war ihr gut gelungen, das zu kaschieren.
Über die Silvesterfeier sprach später niemand mehr, dafür umso mehr über die Bauchschmerzen, die meine Mutter am 2. Januar plötzlich bekam. Es mag an der holprigen Fahrt über viele Stunden im Fiat gelegen haben, dass die Wehen früher einsetzten als errechnet. Ihre Freunde, immer noch ahnungslos, brachten sie ins nächste Spital, das vor allem aus einer Unfallchirurgie bestand. Eine Geburtsstation gab es nicht, umso mehr freuten sich die Ärzte und Schwestern, dass sie dieses Mal keinen Verletzten zu versorgen hatten, sondern ein kleines Mädchen zur Welt bringen durften. Leiter der Abteilung war ein schwarzafrikanischer Arzt, was damals noch äusserst selten war. Ich finde das im Nachhinein irgendwie magisch.
Wie alle anderen mitgereisten Freunde besuchte auch mein Vater meine Mutter im Krankenhaus, allerdings ohne mich zu sehen. Dazu würde es erst später in der Schweiz kommen. Es sollten viele Jahre vergehen, bis wir beide uns wirklich kennenlernen würden.
Die Mannschaft bepackte den Fiat Panda und machte sich bereit für die Rückfahrt nach Bern, allerdings ohne meine Mama. Sie würde noch ein paar Tage im Spital bleiben, damit ich gut versorgt wäre, und später mit mir im Zug hinterherfahren.
Wir wohnten zunächst in der Berner Altstadt, anschliessend zogen wir 40 Kilometer weiter in die Stadt Biel, so viel kann ich sagen. Wie es dann genau mit meinem Leben weiterging, erzählt meine Mutter anders, als es meine Pflegeeltern erzählen. Die Geschichten gehen auseinander und später würde mein Vater eine weitere Variante in den Topf werfen. Man weiss ja, dass jede Erinnerung stark persönlich gefärbt ist und bereits kurz nach einem Ereignis entscheidend von der Realität abweichen kann. Wer was glauben möchte, ist in meinem Fall durchaus entscheidend: Laut meiner Mama habe ich erst mit sechs Jahren dauerhaft bei meinen Pflegeeltern gelebt, in der Version meiner Pflegeeltern dagegen war ich bereits viel früher bei ihnen. Es gibt tatsächlich Fotos von mir als Baby, die mich in ihrem Haus zeigen, aber das sagt noch nicht viel: Dass sie schon, als ich klein war, regelmässig auf mich aufgepasst hatten, bestätigte auch meine Mama. Damals gehörte der Sohn meines Pflegevaters zu ihrem Freundeskreis und begeistert hatten sein Vater Heinz und dessen Frau Charlotte Unterstützung angeboten: «Ihr seid jung, zieht ruhig los, wir passen auf die kleine Tamy auf.»
Immer öfter blieb ich abends bei ihnen, bald auch über Nacht und irgendwann dann noch viel länger. Auch mein damals noch potenzieller Vater war für meinen Pflegevater kein Fremder. Die Familien kannten sich schon lange, und als kleiner Junge hatte mein Vater sogar hin und wieder in dem Haus gespielt, in dem ich später aufwachsen sollte.
Aber noch war sein Status nicht geklärt. Der Vater einer Freundin meiner Mutter, Professor im Inselspital in Bern, bot an, einen Vaterschaftstest durchzuführen. Da es damals noch nicht möglich war, die DNA abzugleichen, wurde unser beider Blut untersucht. Das Ergebnis war vor allem für meinen Vater immer noch nicht eindeutig genug: Es lag irgendwo bei 90, aber eben nicht bei 100 Prozent.
Dann ging meine Mutter nach Köln, um dort eine Ausbildung zur Maskenbildnerin zu machen. Übereinstimmend sagen die Geschichten, dass ich ab diesem Zeitpunkt bereits unter der Woche bei meinen Pflegeeltern lebte. Meine Mutter sah ich an den Wochenenden. Für mich war das in Ordnung. Ich jammerte nicht, vermisste sie nur selten. Als Kind nahm ich meine Welt so selbstverständlich hin, wie sie sich mir bot, und meine Pflegeeltern waren grossartige Menschen, bei denen es mir gut ging.
Auch nach meinem Vater fragte ich nicht. Als ich zwei Jahre alt war, führten die ersten Labore in London DNA-Analysen durch und mein Pflegevater unternahm einen weiteren Anlauf und schickte Genmaterial von mir und meinem Vater dorthin. Mein Vater würde später erzählen, wie er kurz darauf in die Kanzlei seines Anwalts kam und dieser eine Flasche Champagner auf dem Schreibtisch stehen hatte. Mein Vater habe sich gesetzt und gesagt: «Okay, entweder stossen wir darauf an, dass ich nicht Vater bin, oder darauf, dass ich Vater bin.» Diesmal war das Ergebnis eindeutig: Stefan Hofer, Student aus gutem Hause, 27 Jahre alt, war zu 99,98% mein Vater.
Seine Gefühle waren wohl eher gemischt. Vor allem war da Freude, erzählte er mir später. Andererseits war er mitten im Studium, hatte Karrierepläne und ansonsten selbst noch keinen festen Stand im Leben. Wie sollte das gehen?
Mein Pflegevater wusste eine Lösung. Er schlug ihm einen Deal vor: Er, Dr. Heinz Winzenried, würde die Verantwortung übernehmen und für mich sorgen. Es würde mir an nichts fehlen, dafür garantiere er. Die teuflische Seite des Pakts: Im Gegenzug sollte sich mein Vater dazu verpflichten, sich aus meinem Leben rauszuhalten. Er dürfte keinerlei Kontakt zu mir aufnehmen, solange ich nicht selbst danach fragen würde. Heinz hatte mit seiner ersten Frau drei Kinder gehabt, von denen zwei an einer Nervenkrankheit gestorben waren, und auch um ihren dritten Sohn hatten sie lange gebangt, bevor sie daran zu glauben wagten, dass er überleben würde. Jetzt wollte Heinz sichergehen, dass er dieses weitere Kind, das so unerwartet zu ihm und Charlotte gekommen war, nicht ebenfalls wieder verlieren würde. Wie Heinz hatte auch Charlotte bereits einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe, und für beide war die Möglichkeit, gemeinsam für mich sorgen zu dürfen, ein Wunder.
Mein Vater willigte ein.
Natürlich war das der bequemste aller Wege für ihn, aber ich glaube nicht, dass es ihm nur darum ging. Er sah auch, dass ich bei Heinz und Charlotte ein Leben haben würde, dass er mir in seiner aktuellen Situation nie hätte bieten können. Bereits nach kurzer Zeit habe er seine Entscheidung bereut, erzählte er mir später. Aber er war schon damals jemand, dem Prinzipien wichtig waren. So eine Abmachung ging man nicht leichtfertig ein, sondern hielt sich auch gefälligst daran. Ein Mann – ein Wort.
Ich war noch klein, vielleicht vier Jahre alt, als Heinz und Charlotte mit mir in den Schweizerhof zum Essen gingen. Mit uns am Tisch sassen mehrere ältere Herren, darunter auch der Politiker Adolf Ogi. Einer der Männer sah mich ständig an und küsste mich dann auch noch auf den Kopf. Ich fand das merkwürdig, höchst irritierend. Auf dem Rückweg erzählte mir Charlotte, dass dies mein Grossvater gewesen sei. Jetzt war ich erst recht entsetzt: Warum hatten sie mir das nicht vorher gesagt?
Er war in dieser Zeit der einzige Anknüpfungspunkt zu meinem Vater, aber vor allem war er einer der ganz wenigen Blutsverwandten in meinem Leben. Sonst gab es da nur noch meine Mutter und ihre Tante. Allein schon deshalb waren die Treffen mit ihm, von denen es im Abstand von einigen Jahren mehrere gab, auch für mich besonders. Ich fand es spannend, war neugierig, und, wie er mich, musterte ich ihn. Er erzählte mir auch von meinem Vater: Was er so machte, wie er war, wie er wohnte. Über ein mögliches Treffen sprachen wir nie. Er fragte mich nicht danach und ich ihn nicht. Inzwischen weiss ich, dass mein Grossvater meinem Vater nach diesen gemeinsamen Essen jedes Mal von mir erzählte.
Dann, als ich sechs Jahre alt war, fuhr meine Mama nach Los Angeles, zunächst für drei Monate. Als sie zurückkam, war sie voller Begeisterung, wollte dort leben, die Chancen ergreifen, die sich ihr dort in Fülle boten – aber mit einem kleinen Kind?
Meine Pflegeeltern und meine Mama fanden, dass es das Beste für mich wäre, wenn ich bei Charlotte und Heinz bliebe. Es wäre nicht gut für mich, im amerikanischen Schulsystem gross zu werden, hier in der Schweiz hätte ich viel bessere Voraussetzungen. Und wie sollte meine Mutter sich um mich kümmern und sich gleichzeitig ein Leben aufbauen? «Du weisst, dass ich dich mehr lieb hab als alles andere auf der Welt», beteuerte meine Mama.
Ich glaubte ihr und bin mir auch heute noch sicher, dass sie das wirklich so meinte, und ich wollte eine gute Tochter sein, also nickte ich und war tapfer. Ich kannte das ja auch schon, dass meine Mama oft nicht da war. Gemeinschaftlich lobten sie mich für mein Verständnis; betonten, wie vernünftig ich doch schon sei. Meine Mutter muss damals das Gefühl gehabt haben, ihr Leben, das durch meine ungeplante Ankunft plötzlich so limitiert gewesen war, doch noch ausleben zu können. Gleichzeitig sah sie, dass Heinz, Charlotte und ich mehr als ein gutes Team waren. Die beiden liebten mich und ich fühlte mich wohl bei ihnen, wir passten zusammen. Im Laufe der Jahre war viel Verbundenheit und Vertrauen entstanden. Ohne diese Basis hätte meine Mutter einen solchen Schritt niemals gemacht.
So wurde eine weisse Villa mit Pool, Garten und eigenem Wald endgültig mein Zuhause. Heinz und Charlotte wurden auch offiziell meine Pflegeeltern – das war schon deshalb wichtig, damit sie entscheidungsbefugt waren, zum Beispiel, wenn ich mal zum Arzt musste oder sonst etwas war. Wir wohnten im Dorf Stettlen im Worblental, Kanton Bern, umgeben von Feldern, Hügeln und Bergen. Aus unseren Fenstern sahen wir Wiesen, Apfel- und Kirschbäume und die Kühe unseres Nachbarn. Im Garten lagen unsere beiden Neufundländer. Unter den 1800 Einwohnern nahm mein Pflegevater eine bedeutende Rolle ein. Ihm gehörte die Kartonfabrik Deisswil, die grösste Europas, die das Dorf schon allein durch das riesige Fabrikgelände prägte. Heinz Winzenried war ein charismatischer Mann, Politiker und ein Fabrikant alter Schule mit autoritärem Führungsstil, aber auch grossem Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Arbeitern. In Stettlen und den Dörfern der Umgebung hatte er Häuser für Firmenangehörige bauen lassen. Er hat viel dazu beigetragen, dass der kleine Ort weitaus mehr zu bieten hat als alle anderen Dörfer dieser Grösse. Damals schon hatten wir einen Kindergarten, zwei Schulen, zwei Turnhallen und eine Schwimmhalle. Auch einen Kinderhort und einen Jugendtreff hat Heinz bauen lassen. Ich kenne kein anderes Dorf in dieser Grösse mit so einer Ausstattung.
Während jeder in Stettlen meinen Pflegevater kannte, wussten nur diejenigen, mit denen wir direkt zu tun hatten, wer ich war und dass ich bei ihm wohnte, und so kam es vor, dass die Leute über «den Winzenried» redeten, während ich daneben stand. Ich hörte, wie sie mit Respekt darüber sprachen, was er alles für seine Arbeiter getan hatte, wie menschennah er sei oder wie einfach und bescheiden er sich kleide. Seine Manchesterhosen überstanden viele Jahrzehnte und er zog sie auch dann noch an, wenn der Stoff an einigen Stellen schon sichtlich abgetragen war.
Und ich hörte, wie sie über die Motive seiner Wohltaten argwöhnten – Kritik, Misstrauen und Neid klangen mit – und darüber fantasierten, wie diese Reichen denn wohl wohnen würden.
Was Letzteres angeht, hätten sie ziemlich viele ihrer Vorstellungen bestätigt gefunden. Die Villa, in der mein Pflegevater bereits seit 1942 lebte, bestand aus vier Stockwerken. Unten waren unser Wohnzimmer, die Küche, das Büro von Heinz, mein Spielzimmer, die Bibliothek, das Sitzungszimmer, das kleine Esszimmer und das grosse Esszimmer, in dem Banketts abgehalten wurden. Über eine breite Treppe mit rotem Teppich, ziemlich oldschool, kam man nach oben, zu unseren Schlafzimmern. Meines war riesig, das grösste Zimmer, in dem ich je gewohnt habe. Ich hatte ein eigenes Bad, an das gleich das Bad der Angestelltenwohnung grenzte. Hier lebte ein älteres Paar aus Italien, Michele und Guiseppina, das sich um das Haus kümmerte. Micheles Arbeitskleidung bestand aus einem weissen Hemd, einem schwarzen Smoking und weissen Handschuhen. Er hätte eins zu eins den Buttler in einem englischen Film spielen können. Guiseppina war nicht weniger formvollendet angezogen, sie trug täglich ein schwarzes Kleid mit weisser Schürze. Auf unserem Esstisch hatten wir ein goldenes Glöckli stehen, mit dem wir immer klingelten, wenn wir mit einem Gang fertig waren, sodass Michele und Guiseppina kamen, abräumten und den nächsten Gang servierten. Ich stellte immer sicher, dass ich diejenige war, die klingeln durfte.
Oft passten die beiden auch auf mich auf; es gibt Videos, auf denen ich mit ihnen fliessend Italienisch spreche. Wenn ich mir das heute anschaue, verstehe ich kein Wort mehr von dem, was ich sage.
Heinz, Charlotte und ich mochten Michele und Guiseppa sehr und fühlten uns mit ihnen verbunden. Oft begleiteten sie uns auf Reisen oder wir besuchten ihre Familie in Norditalien, wo Heinz ihnen ein Haus gekauft hatte, das gross genug war, um drei Generationen zu beherbergen. Solche Dinge tat er immer wieder für die Menschen in seinem Umfeld. Er schlug Michele und Guiseppina auch vor, normale, bequeme Kleidung zu tragen, aber das lehnten sie freundlich ab.
Wir hatten einen Gärtner, einen Chauffeur, wir reisten First Class um die ganze Welt, Bali, Seychellen, Mauritius, Kenia. Oft waren wir auch auf Sardinien, wo wir ein grosses Haus an der Costa Smeralda hatten, und wenn es irgendwie ging, waren wir einmal im Jahr in den USA. Meine Mutter hatte keine offizielle Aufenthaltsgenehmigung, sodass sie, wenn sie ausgereist wäre, kaum wieder hineingelassen worden wäre, und so war die einzige Möglichkeit, sie zu sehen, zu ihr zu gehen. Mal trafen wir uns in Florida, mal auf Hawaii. In den Wochen davor hielt ich es kaum aus. Wir blieben dann meist so zwischen fünf Tagen und zwei Wochen und fuhren dann zurück. Es konnte auch mal vorkommen, dass wir ein Jahr aussetzen mussten, weil Heinz zu beschäftigt war, dann sah ich meine Mama erst im nächsten Jahr wieder.
L.A. hatte für sie all das gehalten, was es versprochen hatte. Sie hatte damit begonnen, ihre Träume tatsächlich umzusetzen, Musik zu studieren und gleichzeitig eine Ausbildung zur Pilotin zu machen. Das klang auch für mich als Kind fantastisch. Und obwohl sie, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen hatte, nie als Musikerin arbeitete und nach der bestandenen theoretischen Pilotenprüfung die praktische nicht mehr machen konnte, weil ihr das Geld dafür fehlte, ging es ihr blendend und sie fand dennoch ihren Platz auf der grossen Bühne. Bald schon arbeitete sie wieder als Maskenbildnerin, aber diesmal mit den besten Teams und grössten Stars.
Natürlich hätte ich meine Mutter gerne öfter gesehen und es gab Phasen, da vermisste ich sie sehr, aber ich nahm ihr das nie übel. Was hätte sie denn tun sollen? Wir telefonierten jeden Sonntag um 18 Uhr und erzählten uns aus unserem Leben. Manchmal fragte sie mich dann, ob sie lieber nach Hause kommen solle. «Nein, Mama, ist schon okay!», antwortete ich jedes Mal. Ich wollte nicht, dass sie für mich etwas aufgeben müsste. Ob sie zurückgekommen wäre, wenn ich ja gesagt hätte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Die Telefonate bedeuteten uns beiden viel, wir waren uns trotz allem sehr nah – das machte es nicht unbedingt einfacher. Meistens brauchten wir ewig, um uns zu verabschieden, und sie wollte immer, dass ich diejenige war, die auflegte. Also ging das hin und her: «Hab dich lieb.» – «Ich dich auch.» – «Tschüss, bis nächste Woche.» – «Tschüss, machs gut…» Tausend Küsschen hin und her, Tausend mal ich vermiss dich, ich vermiss dich auch. Das konnte locker eine halbe Stunde dauern. Lustigerweise sollten wir dieses Ritual auch später beibehalten. Auch heute noch verabschieden wir uns überschwänglich mit vielen Liebesbeteuerungen – meine Freunde finden das sehr amüsant.
Im Gegensatz zu meiner Mutter waren Heinz und Charlotte immer da. Die Seite des grossen Mäzens, Fabrikbesitzers und Politikers, die mein Pflegevater in der Öffentlichkeit zeigte, war für mich als Kind bedeutungslos, aber ich spürte sehr wohl, wie sich die Stimmung änderte, sobald er einen Raum betrat und wie die Menschen auf ihn reagierten. Mich nannte er «ein Geschenk des Himmels», er war glücklich, dass ich bei ihnen gelandet war, und tat alles für mich. Charlotte war zwanzig Jahre jünger als er und natürlich erzählten sich die Leute ganz eifrig, dass sie nur seines Geldes wegen bei Heinz war – aber wie viel Wahrheit liegt in solchen selbstgefälligen Behauptungen?
Die beiden gingen sehr achtsam miteinander um, stritten nur selten, liebten sich. Von Zuhause aus lenkten sie die Firmengeschäfte, wie Heinz hatte auch Charlotte ihr Büro bei uns im Haus. Oft begleitete ich Charlotte, wenn sie zur Firma rüberfuhr, um etwas abzuholen, oder es kamen Geschäftsleute zu Sitzungen in die Villa.
Sobald wir wieder unter uns waren, war Charlotte eindeutig die Chefin, oder besser: Sie und ich waren das. Wir waren die einzigen Menschen in Heinz’ Leben, von denen er ein Nein akzeptierte. Zwar versuchte er manchmal zu protestieren, aber doch eher halbherzig und im Wissen, ohnehin nicht gegen uns anzukommen.
Für mich waren die beiden Familie; wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an Heinz und Charlotte. Bis ich 13 war, kroch ich nachts in ihr Bett, legte mich zu Charlotte an die Seite. Sie war mütterlich und verständnisvoll. Ich fühlte mich geborgen.
Als ich in der 2. Klasse war, gingen unsere italienischen Angestellten in Rente und zogen in ihr Haus in Norditalien. Ich vermisste sie und war traurig und auch, wenn das spanische Paar, das sie nach kurzer Zeit ersetzte, ebenfalls freundlich und sympathisch war, entwickelte ich zu ihnen nie so eine Nähe wie zu Michele und Guiseppina. Dennoch brachte ihr Einzug einen entscheidenden Vorteil für mich: Ich wurde in der Schule nicht mehr ganz so oft geärgert, denn das spanische Paar hatte zwei Kinder, die mit in unser Haus zogen, allerdings schon deutlich älter waren als ich. Der Sohn war 12, die Tochter 16, und die beiden bekamen den Auftrag, auf mich aufzupassen und darauf zu achten, dass niemand gemein zu mir war. Zwar besuchten sie schon die höhere Schule, die fünf Gehminuten entfernt war, sodass ich meine Schulwege weiterhin alleine meistern musste, aber hin und wieder sah man uns zusammen und es sprach sich herum, dass sie nach mir guckten. Ohne dass ich darüber reden musste, war dies ein wirkungsvolles Druckmittel und tatsächlich kam es zu der einen oder anderen Situation, in der sie für mich eintraten, woraufhin mich die anderen Schüler einigermassen in Ruhe liessen, was sehr erleichternd war.
Gleichwohl zeigten mir die anderen Kinder weiterhin deutlich, dass ich nicht dazugehörte, nach wie vor verstummten ihre Gespräche, wenn ich kam, zogen ihre Blicke Grenzen und manchmal war es ihnen egal, dass es da jetzt die beiden spanischen Aufpasser gab, sodass sie sich trotzdem wieder auf mich stürzten.
Ich hielt das zwei, drei weitere Jahre aus, dann reichte es mir!
Es war nicht einmal so, dass ich unbedingt dazugehören wollte oder einsam gewesen wäre. Seit ich klein war, war ich gerne allein gewesen, lebte unbeschwert in meiner eigenen Welt. Während der Kindergartenzeit hatte ich oft ewig für meinen Heimweg gebraucht, statt fünf Minuten war ich locker eineinhalb Stunden unterwegs, sodass mir oft schon meine Pflegemutter oder jemand vom Personal entgegenkamen, weil sie sich Sorgen machten. Meist fanden sie mich irgendwo auf dem Weg, im Zeitlupentempo nach Hause schleichend, selbstvergessen über Blümchen, Schmetterlinge oder sonst was staunend.
In der Schule war das noch genauso, auch, wenn sich das Umfeld geändert hatte und die Lehrer nicht begeistert waren. Im Unterricht schaute ich ewig aus dem Fenster, unterwegs in meinen eigenen Märchen. «Tamy – wo ist sie?», schrieben sie in mein Zeugnis. In ihren Kommentaren war ich «eine Tagträumerin», «nicht anwesend». Dabei beliessen sie es, da ich immer gute Noten hatte, sodass sie nicht wirklich etwas sagen konnten.
Nachmittags ging ich oft in unseren Wald, kletterte in den Bäumen herum und beobachtete von dort oben die Leute, die vorübergingen. Oder ich dachte mir Geschichten aus, in denen der Wald mein Zuhause war und die Blättchen, die ich sammelte und in meiner Waldküche kochte, mein Abendessen waren. Oder ich sass bei den Enten, die hier ein grosses Gehege hatten oder verbrachte Zeit mit unseren Hunden. Kreierte meine eigene Welt.
Manchmal spielte ich auch mit Laura, der Enkelin meines Pflegevaters, die oft bei uns vorbeikam und die, weil alles andere zu umständlich gewesen wäre, meine Cousine genannt wurde. Und es gab Nadine. Sie hatte irgendwann in der vierten Klasse entschieden, dass sie mit mir befreundet sein wollte. Ich hatte sie immer doof gefunden, vor allem wegen ihrer Frisur – so gesehen, war ich auch nicht weniger von Äusserlichkeiten beeinflusst als die anderen Kinder. Nadine hatte bereits in der Kindergartenzeit einen vollendeten Vokuhila getragen, vorne Igel, hinten lang, der damals ziemlich angesagt gewesen war und den ausser ihr bestimmt weitere vier, fünf Mädchen verpasst bekommen hatten. Ich war nur froh, dass ich davon verschont geblieben war. Auch Nadine hatte ihre Frisur schrecklich gefunden, aber sie war nicht gefragt worden und musste wohl oder übel damit herumlaufen.
Obwohl wir uns also eigentlich gar nicht mochten, freundeten wir uns jetzt, in der 4. Klasse, an und wurden bald unzertrennlich. Auch Nadine gehörte nicht gerade zu den beliebtesten Kindern der Klasse, aber sie war viel mehr connected als ich; kein Vergleich mit meinem Status, mit den ewigen Schikanen und den Anfeindungen, die weiterhin regelmässig stattfanden und auf einer Skala von 1 – mir fiese Sachen zurufen – bis 10 – Auflauern und Verprügeln – reichten. Auch, wenn es nicht jeden Tag zu 10 kam – schon bei 1 sah ich es persönlich als zwingend erforderlich an, mich zu verteidigen – und ich war es nach dieser ganzen Zeit müde, wollte nicht mehr.
So traf ich am Ende der 4. Klasse eine bewusste, folgenreiche Entscheidung: Ab dem nächsten Schuljahr würde ich anders aussehen! Ich hatte fünf Wochen Zeit. Über die Sommerferien liess ich mir die Haare wachsen und setzte meine Brille nicht mehr auf. Wenn ich mich genügend konzentrierte, konnte ich auch ohne Brille gut sehen, das ist bis heute noch so. Nur, wenn ich müde werde, fällt mir das Sehen schwer, dann wird alles ganz verschwommen, aber ich hatte meine Methoden: Ein Auge zuhalten half, Schielen auch, was ich allerdings nur tat, wenn mich keiner beobachtete. Von damals ist mir geblieben, dass ich meine Brille praktisch nie in der Öffentlichkeit aufsetze.
Ausserdem kleidete ich mich anders. Es war nicht so, dass ich in Minirock und High Heels zur Schule ging, aber während mir bisher ziemlich egal gewesen war, wie ich aussah – es hatte mich einfach nicht interessiert –, wählte ich meine Kleidung jetzt ganz bewusst nach den aktuellen Trends aus. Vorzugsweise orientierte ich mich an dem, was die Neuntklässler trugen: Statt Jogginghosen oder irgendeine No-Name-Jeans zog ich nun dieselben angesagten Klamotten wie die anderen an. Wenn die Mädchen Miss Sixties gut fanden, fand ich das jetzt eben auch. Oder es kam ein Typ mit Buffalo-Schuhen in die Schule, die so ziemlich jeder cool fand und gerne gehabt hätte, und kurz darauf trug ich ebenfalls solche Schuhe. Die finanzielle Situation bei uns zu Hause machte meine Verwandlung natürlich erheblich leichter. Es war für mich nie ein Problem, bestimmte Klamotten zu bekommen; wenn die anderen Kinder noch dabei waren, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie dringend ein bestimmtes Kleidungsstück bräuchten, kam ich schon am nächsten Morgen damit ins Klassenzimmer. Auch von unseren Amerikareisen brachte ich nun jedes Mal die angesagten Jeans und T-Shirts mit.
Wenn es jetzt vorkam, dass ich mal danebengriff, spürte ich das schnell und korrigierte sofort. Zum Beispiel hatte ich mal so einen Zweiteiler, der aus einer Art Radlerhose und einer Jacke mit Knöpfen bestand. Beides war schwarz mit weissen Nähten und hatte noch irgendwelche Muster – ein wildes Teil. Ich fand es mega toll, aber es kam überhaupt nicht gut an. Also musterte ich den Zweiteiler sofort wieder aus.
Ich kam mir nach meiner Verwandlung nicht verkleidet vor und ich fühlte mich auch nicht wirklich unwohl, aber trotzdem war das nicht mehr mein selbstverständliches Ich, sondern eine Rolle, in die ich schlüpfte. Mir war nicht mal im Ansatz klar, was ich da tat, und dass ich soeben einen entscheidenden Teil von mir aufgab. Ich weiss nicht, ob ich genauso gehandelt hätte, wenn mir das bewusst gewesen wäre. Für Heinz und Charlotte war mein veränderter Look nicht mehr als eine neue Mode, die mir halt jetzt gefiel. Ich hatte zuhause nur von den wenigsten Beschimpfungen und Bedrohungen erzählt, eigentlich nur von denjenigen, bei denen ich wirklich Angst gehabt hatte – die Geschichte mit dem rosa Röckchen, die Schnee-Attacke –, alles andere hatte ich für mich behalten, weil ich einfach kein Gewicht darauf legte. Das war es nicht wert. Meine Pflegeeltern sollten nicht wissen, wie häufig ich attackiert wurde. Ich zog das erfolgreich durch.
Entsprechend unspektakulär muss meine jetzige Veränderung auf sie gewirkt haben. Eine neue Hosenmarke und längere Haare eben, ein anderer Look, aber sonst?
Ein Verstecken, Zurückziehen, Vortäuschen. Ich gab meinen eigenen Ausdruck auf.
Das Erschreckende ist, wie gut es funktionierte! Innerhalb kurzer Zeit war ich akzeptiert, war bald sogar richtig beliebt. Ich stand in den Mädchenrunden auf dem Schulhof und beteiligte mich an ihren Gesprächen über welche Themen auch immer – mir war das egal. Ich hatte neben Nadine, mit der ich weiterhin in engem Kontakt war und durch die gesamte Schulzeit befreundet bleiben sollte, plötzlich auch andere Freundinnen. Zusammen mit Nadine richtete ich in unserem Haus einen Discoraum ein, direkt neben dem Weinkeller und der Garage. Heinz und Charlotte hatten die Idee dazu gehabt. Wir besprühten die Wände mit dem, was wir unter Graffiti verstanden, hängten eine Discokugel an die Decke und bunte Lichter an die Wände. Dann lud ich zur Party ein. Es kamen all die Fünftklässler, die ich eingeladen hatte, und ausserdem Schüler aus der siebten, achten, sogar aus der neunten Klasse, und zwar ausnahmslos die «cool kids», die ich nie im Leben zu fragen gewagt hätte und die sich wohl die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten, die weisse Villa von innen zu sehen. Für meinen Status war ihr Auftreten der grosse Durchbruch. In meiner Klasse gehörte ich nun definitiv zu den Beliebtesten, mit denen alle abhängen wollten.
Sehr schnell wurde mein neues Image so normal für mich, dass ich gar nicht mehr darüber nachdachte und über viele Jahre komplett vergass, dass ich da mal eine Entscheidung getroffen hatte und wie ich eigentlich vorher gewesen war. Ich entwickelte mich zur Teenagerin und war eklig zu meinen Pflegeeltern. Ich stritt mit ihnen und weigerte mich beleidigt, mit ihnen zusammen am Tisch zu sitzen. Mit dem Teller in der Hand stapfte ich wütend nach oben, ass alleine in meinem Zimmer.
Bei Charlotte beklagte ich mich darüber, dass wir nicht in einer normalen Wohnung lebten. Schloss ich neue Freundschaften, war es mir jetzt peinlich, die Freunde mit nach Hause zu nehmen. Jedes Mal, wenn ich es doch tat, wurde ich damit konfrontiert, wie sie staunend umherschauten, abcheckten, verglichen. Mir machten ihre Ehrfurcht und Bewunderung noch mehr bewusst, wie sehr sich meine Situation von der ihren unterschied. Ich folgte ihren Blicken und fand es beklemmend, mir vorzustellen, was sie wohl dachten und was sie wohl zu Hause erzählen würden. Es war mir auch unangenehm, vom Chauffeur zur Schule oder zum Schwimmunterricht gebracht zu werden, weshalb ich immer eine Strasse eher ausstieg, sodass mich keiner sah – heute hätte ich definitiv nichts mehr dagegen, von einem Chauffeur gefahren zu werden. Und ich regte mich darüber auf, dass Heinz und Charlotte nicht verheiratet waren! Als ich jünger gewesen war, hatte ich es noch lustig gefunden, dass wir alle drei verschiedene Nachnamen hatten. Auf Reisen hatte das immer wieder zu Verwirrung und kritische Blicken am Schalter geführt. Ich fand, dass die beiden einfach zusammengehörten – einerseits. Andererseits suchte ich auch hier möglichst viel Normalität. Alle anderen hatten auch verheiratete Eltern; warum konnte nicht wenigstens das bei mir genauso sein? Tatsächlich taten sie mir den Gefallen, was mir bis heute sehr leidtut, denn Charlotte sollte später, nach dem dramatischen Firmenscheitern und dem Tod von Heinz, dadurch ziemliche Schwierigkeiten bekommen.
Bei all den Konflikten, die wir damals hatten, stellte ich die Autorität meiner Pflegeeltern nie infrage. Sätze wie «Ihr seid nicht meine richtigen Eltern!», habe ich nie gesagt und auch nie gefühlt. Unser Grundgerüst war stabil und tragfähig.
Mit meiner Mutter stritt ich nie. Wenn man sich nur fünf Tage am Stück sieht und dazwischen höchstens telefoniert, gibt es keinen Alltag, in dem der eine genervt vom anderen sein könnte. Es gibt immer nur Ausnahmesituationen. Meine Mutter war für mich die coolste von allen; ich fand sensationell, wen sie kannte, wie sie lebte, mit wem sie arbeitete; so wollte ich auch mal sein. Ich weiss noch, wie wir damals in der Schule ein Bild malen sollten, das uns selbst im Alter von 30 Jahren zeigt. Ich malte mich auf dem Laufsteg. In meinem Bild war Claudia Schiffer krank geworden, weshalb ich spontan für sie einspringen musste. Jeder Schüler präsentierte sein Bild vor der Klasse. Als ich meines vorstellte, erntete ich grosses Gelächter und ich wusste auf der Stelle, dass ich meinen Traum in Zukunft für mich behalten würde. Die Träume der anderen waren so handfest und real wie die Schweizer Berge.
Im Gegensatz zu heute wollte damals niemand Model werden, schon gar nicht in unserem kleinen Dorf. Es gab hier nicht die geringsten Berührungspunkte. Für mich gab es meine Mama, die zwar aktuell nicht mehr modelte, aber deren Leben nach wie vor funkelte und glitzerte. Ich durfte das selbst ein kleines fantastisches bisschen miterleben, als ich 2001 zum allerersten Mal zu ihr nach L.A. flog. Mit 16 alleine in den Flieger und ich würde fünf ganze Wochen bleiben. Damals arbeitete meine Mama gerade bei einem Videodreh der R&B-Sängerin Aaliyah mit. Aaliyah war 23 Jahre alt und gerade durch den Film «Romeo Must Die» zum Star geworden. Sie spielte darin nicht nur die weibliche Hauptrolle, sondern sang auch den Song «Try Again». «Romeo Must Die» wurde zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres und Aaliyahs Song schnellte hoch auf Platz eins der amerikanischen Singlecharts. Menschen auf der ganzen Welt wurden ihre Fans und ich war definitiv einer davon.
An vielen Tagen waren meine Mama und ich zusammen unterwegs, an anderen, an denen sie arbeiten musste, kümmerten sich meistens Freunde von ihr um mich oder meine Mutter setzte mich in der Mall ab, wo ich mir die Zeit vertrieb, auch mal ein paar Jungs kennenlernte, bevor sie mich abends wieder abholte. Eines Abends erzählte sie mir, dass sie mich am nächsten Tag mit ans Set nehmen würde. Es würde eine Szene gedreht, bei der ich sogar mitspielen könnte. Wow!
So gross wie meine Aufregung und Begeisterung gewesen war, war am nächsten Tag mein Frust, als wir mitten in L.A. im Stau standen und irgendwann klar wurde, dass wir den Termin definitiv nicht schaffen würden. Tatsächlich war die Szene schon abgedreht, als wir am Set ankamen, aber immerhin lernte ich Aaliyah persönlich kennen. Sie begrüsste mich, wir machten zusammen Fotos und sie wünschte mir noch viel Spass beim Zuschauen des Videodrehs. Das war mindestens genauso gut.
Ich war schon wieder zurück in der Schweiz, als Aaliyah mit einem Teil ihres Teams auf die Bahamas flog, um ein neues Video zu drehen: «Rock the Boat». Auf dem Rückflug, nur wenige hundert Meter nach dem Start, stürzte die Cessna ab, später hiess es, das Flugzeug sei überladen gewesen, ausserdem habe der Pilot Alkohol und Kokain im Blut gehabt. Drei Wochen, nachdem mir Aaliyah in L.A. die Hand gegeben hatte, war sie tot, genauso wie ihre Crewmitglieder, die mit im Flugzeug gesessen hatten. Danach verkauften sich ihre Platten kolossal. Für mich war das ein Schock. Es war so unwirklich, und obwohl wir uns ja nicht wirklich gekannt hatten, war ich traurig.
Auch mit den Rolling Stones, Britney Spears, Justin Timberlake oder Gwen Stefani arbeitete meine Mama zusammen, die Liste ist lang, alle Namen sind gross und bedeutungsvoll. Darunter auch genau die Rapper, deren Musik ich hörte. Zu meinem siebzehnten Geburtstag schickte sie mir eine kleine Filmkamera, eines der ersten Modelle mit Memory-Karte, die, wie ich feststellte, bereits einen Clip enthielt: Es strahlte mich Snoop Dogg an. «Hi Tamy my nizzy from Swizzy…» 50 Cent: «Hi Tamy your Mom is great, if you need anything my friends are your friends you heard me!» Dr. Dre: «Hi Tamy this is Dr. Dre sending you love all the way to Switzerland.»
Es kam damals immer wieder vor, dass Freunde mich fragten, ob ich denn nicht wütend auf meine Mutter sei und sich darüber aufregten, wie sie das denn machen könne, aber das liess ich nie gelten. Was wussten die schon. Ich verteidigte meine Mama vehement, erklärte, dass das voll okay für mich sei und ihre Entscheidung absolut richtig wäre. Das war meine Sicht auf mein Leben, die ich mir von niemandem nehmen liess. Und an Tagen wie diesen, als meine Mama dafür gesorgt hatte, dass all die angesagten Rapper meinen Namen sagten und mich persönlich grüssten, war ich mir sicher, dass ich es mehr als gut getroffen hatte. Mir reichte das völlig zum Glück!
In Zürich sprach ich bei einer Model-Agentur vor. Es wäre einfach genial, wenn das klappte, was würde wohl meine Mama sagen? Aber sie wollten mich dort nicht und das war es dann für mich mit dem Modeln für eine lange Zeit. Was solls – es gab noch viele andere Sachen, die mich interessierten.
Heinz und Charlotte taten weiterhin alles dafür, dass es mir gut ging. Sie hatten ihre klaren Vorstellungen von unserem Zusammenleben, aber waren nie streng, übten nie Druck aus und zeigten mir immer wieder, wie glücklich es sie machte, dass ich bei ihnen war, ohne die geringsten Zweifel – auch in diesen verstockten Teenager-Zeiten. In den wenigen Fällen, in denen Charlotte mir mal einen Wunsch nicht erfüllte, ging ich zu Heinz, der mir ganz sicher nichts abschlug. Das ging so weit, dass er seine BMWs weggab, weil ich die Autos nicht mochte, und stattdessen zwei neue Mercedes kaufte, wie er sie vorher auch schon gehabt hatte. Und auf unseren Reisen wohnten wir in den Hotels, die ich zuvor ausgesucht hatte. Dass Heinz auch die Sanierung der Schwimmhalle unseres Dorfes finanzierte, weil ich im Schwimmclub war, hatte er sich allerdings selbst überlegt. Eigentlich hätte die Halle aus Kostengründen in eine Turnhalle umgewandelt werden sollen – das wäre dann die dritte gewesen. Heinz sorgte dafür, dass es nicht so weit kam.
Seit ich als Kleinkind vergnügt in unserem Pool geplanscht hatte, liebte ich das Wasser. Mit zwei konnte ich schon gut schwimmen. Weil es mir soviel Spass machte, meldeten mich meine Pflegeeltern bald darauf erst zum Schwimmkurs und dann, ich war vier oder fünf Jahre alt, im Verein an.
Ich ging einmal die Woche hin, später zweimal und dann noch öfter. Das entwickelte sich fast automatisch: Das Schwimmen fiel mir leicht und ich war offensichtlich begabt. Wäre ich mittelmässig gewesen, hätte ich vermutlich bald wieder aufgehört, ganz sicher hätte ich schnell die Lust verloren. Wenn, dann wollte ich schon die beste sein. Meine Anatomie kam mir zugute: Ich war gross und hatte vor allem relativ grosse Handflächen, was beim Schwimmen ein entscheidender Vorteil ist. Auch meine Technik passte, sodass ich nicht gross kämpfen musste.
Die Trainer bestärkten und förderten mich und schlugen vor, das Training weiter zu intensivieren, was ich dann auch tat. Während sich meine Freundinnen aus der Schule für den Nachmittag verabredeten, zog ich meine Bahnen. Am Ende trainierte ich an fünf Tagen pro Woche acht Mal, davon sechs Mal nass und zwei Mal trocken, wie wir sagten. In meinen Spitzenzeiten schaffte ich 78 Liegestütze. Wenn meine Schulkameradinnen am Wochenende zusammen ausgingen, setzte ich mich in den Mannschaftsbus und fuhr mit den Jungen und Mädchen aus dem Club zu Wettkämpfen, und selbst einen Teil meiner Ferien verbrachte ich in Trainingslagern.
Keine Frage: Das Schwimmen machte mir Spass, es war mein Leben. Ich wollte das so. Wir waren der beste Club in der Schweiz, und es fühlte sich gut an, als Team aufzulaufen, alle in den gleichen Shorts und T-Shirts mit Vereinslogo. Schaut her, das sind wir. Aber das Training war auch hart. Manchmal, wenn wir im Trainingslager waren und das Schwimmbad im Freien lag, führten wir in unserem Schlafraum gemeinsame Rituale aus, um Regen und Sturm heraufzubeschwören, damit wir am nächsten Tag bloss nicht ins Wasser mussten. Einmal hat es danach tatsächlich so ein heftiges Gewitter gegeben, dass das Training abgesagt wurde. Wir jubelten über unseren wirkungsvollen Zauber.
Dazu kam, dass ich im Wasser völlig von der Welt abgeschlossen war. Du kommunizierst nur, wenn der Trainer dir sagt, was du als Nächstes tun sollst, dann tauchst du wieder ein und bist völlig mit dir und deinen Gedanken alleine. Nicht gerade unterhaltsam. Ich lebte auch während der vielen Stunden im Wasser in meiner Fantasiewelt, dachte mir Geschichten aus – und war weiter erfolgreich: Drei Mal wurde ich Schweizer Meisterin, wurde in das Kader der Schweizer Nationalmannschaft aufgenommen und im Jahr 2000 als jüngstes Teammitglied für die Olympiade in Sydney nominiert.
Stopp!
Für mich war das der Wendepunkt. Ich hatte den Grossteil der letzten zwölf Jahre im Wasser verbracht und auf eine Art verstanden, wie das lief. Eigentlich wurde mir erst jetzt wirklich bewusst, wie professionell ich diesen Sport inzwischen ausübte. Jetzt stellte ich mir die Frage, ob das wirklich meine Zukunft sein sollte und die Antwort war ganz klar: Nein! Ich wollte auch noch andere Sachen erleben, wollte montags in die Schule kommen und bei dem, was am Wochenende losgewesen war, mitreden können oder in den Ferien Zeit mit meinen Freundinnen verbringen. Und es gab noch einen Grund: Im Training hatte ich mir immer wieder die Mädchen angeschaut, die ein paar Jahre älter waren als ich. Sie waren riesig, hatten einen dreieckigen Oberkörper mit breiten Schultern und einem grossen Brustkorb. So wollte ich nicht aussehen. Ich hatte damals ohnehin schon recht breite Schultern und auch heute ist es so, dass ich manche Kleider nicht zukriege, weil mein Brustkorb und meine Schultern zu breit sind.
Ich besprach mich mit meiner Pflegemutter, die damals sogar Präsidentin des Schwimmvereins war. «Bist du sicher?», wollte sie wissen. Das war ich. Also rief Charlotte bei meinen Trainern an: «Tamy will nicht mehr…»
Für mich war das eigentlich kein grosses Ding, für meine Trainer schon. Es war schrecklich! Sie waren überrascht, enttäuscht, hatten auf mich gesetzt und versuchten nun, mich umzustimmen – aber mein Entschluss stand fest und ich habe ihn nie bereut.
Ich ging noch weiter zum Schwimmen, aber jetzt nur noch zweimal die Woche zum Spass und um meinen Körper nicht von einem Tag auf den anderen zu entwöhnen. Zwei Jahre lang versuchten meine Trainer noch, mich zurückzuholen.