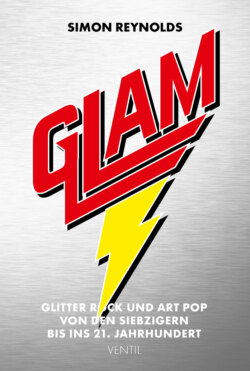Читать книгу Glam - Simon Reynolds - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
THE LONDON BOY: BOWIES ANFÄNGE
ОглавлениеDavid Bowie Anthony Newley Lindsay Kemp Oscar Wilde
Jahre vor seinem Durchbruch stand David Bowie bereits einmal kurz im Rampenlicht. Im November 1964 war der damals Siebzehnjährige in der BBC-Sendung Tonight zu Gast – als Sprecher der Society for the Prevention of Cruelty to Longhaired Men. Von jungen Männern mit ähnlich mädchenhaftem Aussehen wie dem seinen umgeben, verurteilte Bowie – damals noch unter seinem bürgerlichen Namen David Jones – die Vorurteile und Demütigungen, denen sie ausgesetzt waren: »Seit zwei Jahren müssen wir uns Kommentare wie ›Schätzchen!‹ und ›Kann ich deine Handtasche tragen?‹ anhören. Und ich glaube, das muss aufhören … Es gibt keinen Grund, uns zu schikanieren.«
Vieles an dem Fernsehausschnitt ist bemerkenswert, unter anderem Bowies atemberaubendes Aussehen: Seine Haut ist blass, sein Körper zart, seine schulterlangen blonden Locken umwerfend. Und dann seine Art: höflich, gesittet, ein Grinsen im Gesicht, das seiner Schüchternheit geschuldet sein mag, auf jeden Fall aber die angebliche Militanz der SPCLM widerlegt. Auffällig auch, dass bereits hier – noch bevor seine Karriere wirklich begonnen hatte – der berühmteste aller die Geschlechtergrenzen verwischenden Rockmusiker Androgynie und sexuelle Unbestimmtheit in das Zentrum seiner öffentlichen Selbstdarstellung rückte. Es war gerade ein oder zwei Jahre her, dass die langen Haare der Beatles die ganze Aufregung ausgelöst hatten: »Bist du ein Junge oder ein Mädchen?«
Was aber wirklich hervorsticht – und es ist verzeihbar, dass das den Zuschauern 1964 entging –, ist, dass die ganze Sache offenkundig eine Farce ist: Die Society for the Prevention of Cruelty to Longhaired Men existierte gar nicht. Als ein Mitarbeiter der BBC Bowie in einem Café in der Denmark Street (damals das Zentrum von Londons Musikindustrie) ansprach und den angehenden Popstar fragte, ob er jemals wegen seiner langen Haare belästigt worden sei, kam dem die Idee für die Pressure Group als Werbegag. Die BBC fiel darauf rein, oder entschied sich vielleicht auch einfach nur dafür, nicht zu sehr nachzuhaken. Schließlich hatte die Geschichte alles, was so einen fetzigen, zeitgemäßen Tonight-Beitrag ausmachte.
Nach dem Fernsehauftritt schlachtete Bowie seine Non-Story aus, wo es nur ging. Gegenüber der Evening News verkündete er, es sei Zeit, »dass wir uns vereinigen und uns für unsere Locken stark machen«, und beklagte: »Jeder im Bus macht Witze und wenn man an den Arbeitern in den Straßen vorbeigeht, bringt das einen förmlich um.«
Sein Manager Les Conn heizte die Kontroverse weiter an, als Bowie und seine Band The Manish Boys in der Pop-Sendung Gadzooks! auftreten sollten. Conn – dessen Slogan passenderweise »Conn’s the name, con’s the game« lautete* – verbreitete das Gerücht, die BBC würde darauf bestehen, dass Bowie sich die Haare schneidet. Er inszenierte sogar eine Demonstration, bei der Fans vor dem Studio mit Plakaten gegen den unfairen Umgang mit langhaarigen Männern protestierten. Die Publicity, die der fadenscheinige Konflikt generierte, war so groß, dass die Daily Mail, der Evening Standard, der Mirror und der Daily Telegraph darüber berichteten. »Lass dir die Haare schneiden, sagt die BBC einem Popper« oder »Langes Leiden« waren die Schlagzeilen, ein Bowie-Zitat lautete: »Ich würde lieber sterben, als mir die Haare zu schneiden.« Dem folgten weitere, ebenso frei erfundene Geschichten wie die, dass das Verbot zwar aufgehoben worden wäre, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Gage der Manish Boys, sollten sich die Zuschauer beschweren, für einen wohltätigen Zweck gespendet werden müsse.
Bowie lebte in keiner Fantasiewelt wie Marc Bolan, mit dem ihn eine unstete Freundschaft verband. Doch die Kunst der Täuschung würde später an wichtigen Stationen seiner Karriere eine wesentliche Rolle spielen. Für jemanden aus der Generation der 1960er fühlte er sich ungewöhnlich wohl mit dem strategischen Einsatz von Unwahrheiten, den Mechanismen von Hypes und damit, sich selbst zu verkaufen – im theoretischen Konzept wie in der Praxis.
Vielleicht lag das auch in der Familie: Sein Vater, Haywood Jones, arbeitete als PR-Beauftragter für die Wohltätigkeitsorganisation Barnado’s und war davor im Showbiz, wo er mit Geld, das er geerbt hatte, zuerst eine Theatertruppe kaufte und dann – als das fehlschlug – in einen Nachtclub im West End investierte (ebenfalls erfolglos). Bei Barnado’s nutzte Jones Senior seine Verbindungen, um angesagte Entertainer für Wohltätigkeitsveranstaltungen zu gewinnen. Seine Fertigkeiten im Feld der PR kamen auch in den frühen Tagen der Karriere seines Sohnes zum Einsatz. Zusammen schrieben sie dem erfolgreichen Unternehmer John Bloom einen Brief, in dem sie argumentierten: »Wenn Sie meine Band so gut verkaufen wie ihre Waschmaschinen, sind Sie einem großen Geschäft auf der Spur!« Bloom war amüsiert von der Dreistigkeit, hatte aber kein Interesse daran, ins Pop-Management einzusteigen. Stattdessen gab er den Brief einem aufstrebenden Showbiz-Svengali, den er kannte: Les Conn.
Bowie lernte schnell, die Presse um den Finger zu wickeln und nahm dabei heutzutage gängige politische Praktiken wie den spin*, optics** und das Kontrollieren der Narrative vorweg. Kenneth Pitt, der Conn als Manager ablöste und Bowies wichtigster Mentor während der 1960er wurde, erklärte dem Sänger, »was genau die Interessen der Interviewer waren … Ich sagte ihm, er müsse dem Interviewer immer einen Schritt voraus sein, ihm oder ihr erzählen, was er oder sie hören will, und sich dem jeweiligen Medium entsprechend unterschiedliche Stile aneignen.«
Dass Bowie schon früh der Werbeindustrie ausgesetzt war, hatte ebenfalls Einfluss auf sein dehnbares Verhältnis zur Wahrheit. Nachdem er die Schule mit sechzehn verlassen hatte, bekam er einen Job als Paste-up-Künstler bei der Londoner Abteilung der Nevin D. Hirst-Agentur aus Yorkshire. Deren wichtigster Kunde war eine Firma, die Diätkekse mit dem Namen Ayds verkaufte (ein Name, der sicherlich hätte geändert werden müssen, hätte dieses Produkt bis in die 1980er überlebt). Etwas später in den 1960ern verdienten sich Bowie und der Gitarrist einer seiner vielen Bands nebenher Geld, indem sie Musik für Werbung schrieben, etwa für Youthquake Clothing***.
Werbung hatte in den 1960ern einen zwiespältigen Ruf. Einerseits war sie Teil des neuerwachten Konsumverhaltens der Nachkriegszeit, andererseits stand sie für alles Falsche im Leben der westlichen Welt, denn im Wesentlichen betrieb sie Propaganda für Firmen statt für den Staat. In Großbritannien stand Werbung auch für Amerika: Kommerzielles Fernsehen – also Fernsehen mit Werbeunterbrechungen – gab es erst seit dem Start von ITV (Independent Television) 1955 und wurde von dogmatischen Linken genauso sehr verachtet wie von versnobten Konservativen. Für sie war Werbung nichts anderes als ein neuer, zu verdammender US-Import, nach Supermärkten und Rock ’n’ Roll. 1960 veröffentlichte Penguin Books im Vereinigten Königreich Vance Packards Die geheimen Verführer. Packards Buch – ein Enthüllungsbericht, in dem der amerikanische Konsumkritiker über die psychologischen Manipulationen und Tricksereien der Werbeindustrie aufklärte – fand eine breite Leserschaft und wurde kontrovers diskutiert. Einer seiner Leser war der junge Bowie.
Trotz all dieser Kritik ging von der Werbeindustrie eine zunehmende Faszination aus: als glamouröses Happening, als kreativer Raum. Und dann erschienen noch Werbetexter mit Kultstatus auf der Bildfläche. Der britischstämmige David Ogilvy etwa, der Autor von Geständnisse eines Werbemannes, der als mögliche Inspiration für Don Draper aus Mad Men gilt. Werbung brachte Schwung und Farbe in den Alltag (besonders in einem Britannien, das gerade erst begonnen hatte, sich von den Entbehrungen der Nachkriegszeit loszulösen) und beeinflusste mit ihren grafischen Innovationen und ihrer optimistischen Ausstrahlung darüber hinaus Richard Hamiltons und Andy Warhols Pop Art. Selbst die Piratensender, die die britische Jugend in den 1960ern mit der Popmusik versorgten, nach der sie sich sehnte – und die das BBC Light Programme nach und nach ausdünnte –, waren kommerziell. Sie finanzierten sich durch Werbepausen, deren überdrehte pseudo-amerikanische Energie der pseudo-amerikanischen Flapsigkeit der Sprüche der DJs in nichts nachstand.
Später würde Bowie mit Stolz zurückblicken auf sein kurzes Engagement in der Werbung, einer Industrie, die, so Bowie, das 20. Jahrhundert so geprägt habe wie die Rockmusik. In den 1960ern selbst jedoch war dieses Verhältnis eher gespalten. Das Authentizitätsstreben der damaligen Bohème ging auch an ihm nicht spurlos vorbei, die Suche nach dem wahren Ich führte ihn und seine Zeitgenossen zu Black Music (Blues, Soul, Jazz), zu den Schriftstellern der Beat-Generation, zum Ruhm Bob Dylans als Poet wie Prophet und zur Spiritualität des Orients. Aber er war ebenso konsequent anpassungsfähig und unglaublich ehrgeizig, etwa wenn er die Marke Bowie den neuesten Entwicklungen der Modewelt anpasste. Letzten Endes wurden alle Ausverkaufsvorwürfe seitens der Beatniks durch Bowies eisernen Willen, zu verkaufen und verkauft zu werden, in den Schatten gestellt.
Bowies 1960er waren einerseits eine Zeit der Selbstfindung und spirituellen Suche. Andererseits probierte er sich in dieser Zeit aber auch darin aus, sich selbst zu konstruieren und zu vermarkten, durch Interviews, Aufnahmen, Auftritte und Imagewechsel ein Produkt nach dem nächsten einzuführen. Die drei Alben und 13 Singles, die Bowie zwischen 1964 und 1970 veröffentlichte, waren weniger »Werbung für mich selbst« als Versuche, ein Ich zu erschaffen, das die Öffentlichkeit würde kaufen wollen.
Es war eine Art magische Motivation, die Bowie durch diese sieben Jahre voller Flops, Fehlstarts und Unschlüssigkeit brachte. Wie auch bei Bolan brannte unter der Oberfläche eines Chamäleons pure Willenskraft.
David Bowie wurde am 8. Januar 1947 geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er in Brixton, einem Südlondoner Stadtteil, in dem Theater und Showbiz traditionell stark vertreten sind. Mit dem Erfolg seines Vaters in seinem Job für Barnado’s zog die Familie schließlich weiter Richtung Süden in den Vorort Bromley.
Im Lauf seiner Karriere machte Bowie unterschiedliche Angaben über seine soziale Herkunft. Mal bezog er sich auf die Mittelschicht, ein anderes Mal auf die Arbeiterklasse. Das hatte er gemein mit anderen zentralen Figuren der britischen Popgeschichte von Pete Townshend bis Paul Weller. Sie alle kamen aus einer schwer greifbaren Schicht innerhalb der britischen Gesellschaft, die die gebildete Arbeiterklasse ebenso umfasste wie das sozial unsicher gestellte Bürgertum und das, was man die nicht wohlhabende Mittelschicht nennen könnte, also Fach- oder Bürokräfte, deren Einkommen sich nicht mit ihren Ambitionen deckte.
Bowies Eltern verbanden sozialen Aufstieg und Fall. Sein im Norden aufgewachsener Vater Haywood verlor sein Erbe von der Schuhfirma seiner Familie durch Showbiz-Spekulationen nahezu vollständig. Seine Mutter Peggy war vormals Kellnerin und hatte einen außerehelich geborenen Sohn, der viel älter war als sein Halbbruder David. Sie war eine Ex-Arbeiterklassen-Tory, deren verbitterte Lebenseinstellung von den Entbehrungen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt war, wie auch von einer sich durch ihre Familie ziehenden Geschichte psychischer Erkrankungen.
»In meiner Familie gibt es eine große Menge an emotionaler Erniedrigung«, beschrieb Bowie seine Erziehung. Zwar verehrte er seinen Vater, doch die Beziehung zur Mutter war kühl. Die Spannungen in seinem häuslichen Umfeld dürften genauso zu seinem Gefühl, »außerhalb von allem« aufzuwachsen, beigetragen haben wie die unsichere soziale Situation seiner Familie und Bromleys Randlage im Vergleich zu Greater London. In seiner Kindheit war er meistens der klassische Träumer – ein Einzelgänger, der sich »in mein Zimmer zurückzog«.
Wie bei so vielen britischen Kids Mitte der 1950er kam Bowies erster Vorstoß in musikalische Gefilde während des Skiffle-Booms. Skiffle war die britische Neuinterpretation eines rauen Blues-Folk-Sounds, der ursprünglich im Amerika der 1920er populär war. Hits wie »Rock Island Line« von Lonnie Donegan führten zu einer Do-It-Yourself-Welle tausender Jugendlicher, die zu einfachen Instrumenten (einer Akustikgitarre oder, in Bowies Fall, einer Ukulele) und Haushaltswaren (dem im Rhythmus geschlagenen Waschbrett) griffen. Ergänzt wurde das um notdürftig zusammengebaute Ersatzinstrumente, etwa einen Kontrabass aus einem Besenstil, einer Schnur und einer als Resonator fungierenden Teekiste. Aus diesen Skiffle-Combos wurden schnell Rock-’n’-Roll-Bands, als Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly und andere im Vereinigten Königreich weite Kreise zogen. Bowie allerdings trat erst im Sommer 1962 seiner ersten Band The Kon-Rads bei. Zu diesem Zeitpunkt spielte er bereits Saxophon.
Gegen Ende desselben Jahres brach die Beatlemania los. Als Resultat löste die Beat-Band den Solokünstler plus Backing-Band (Vince Taylor and the Playboys, Johnny Kidd and the Pirates usw.) als dominierende Strömung im britischen Pop ab. Backing-Bands standen für gesichtslose Professionalität, Flexibilität und taten, was man von ihnen verlangte. Beat-Bands hingegen waren »organischer«, was bedeutet, dass sie Entwicklungsspielraum hatten. Meistens entstanden sie durch Freundschaften und Zufälle. Das brachte mit sich, dass die Mitglieder nicht alle gleich gut an ihren Instrumenten waren und auch ihre Einflüsse und Vorlieben sich unterschieden. Aus dem recht kleinen Feld, in dem sich all das überschnitt, entstand dann der charakteristische Sound, von dem aus eine Band sich weiterentwickeln würde.
Von außen wirkte so eine Gruppe fast wie eine Gang, im Inneren funktionierte sie quasi wie eine Familie. Die Band als explosive, kreative Maschine, die sich auf ein musikalisches Abenteuer begibt: Darauf basieren die Erfolgsgeschichten der britischen Rock-Szene der 1960er. Fast all die Größen, die neue Richtungen vorgaben – The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Yardbirds, Pink Floyd – hatten feste, dennoch flexible Bandstrukturen, die ihnen Kollaborationen (mit Produzenten, Gastmusikern) genauso ermöglichten wie den Austausch wichtiger Mitglieder, wenn diese ein psychisches oder ein Drogenproblem entwickelten (wie im Fall von Brian Jones und Syd Barrett). Ihr Kern, ihre musikalische Chemie und ihre Loyalität untereinander blieb dabei intakt.
Eine lange Zeit spielte David Bowie in den 1960ern ebenfalls in Bands, dennoch hatte er kaum etwas mit der britischen Beat-Revolution zu tun. Stattdessen ging er wie ein Solokünstler vor, ließ Bandmitglieder hinter sich, wann immer seine Karriere Gefahr lief, stillzustehen, und erschuf sich ein neues Umfeld. Von 1963 bis 1968 war er flüchtiges Mitglied einiger Bands: The Kon-Rads, The Hooker Brothers (die sich dann mit The King Bees zusammentaten), The Manish Boys, The Lower Third, The Buzz, The Riot Squad, Feathers. Als Solokünstler schließlich versammelte er immer wieder wechselnde Line-ups von Begleitbands und Kollaborateuren um sich.
Es gibt kaum andere große Künstler, deren Karrieren in den 1960ern – ja, sogar in den 1970ern – von solch einer Mobilität und dieser geradezu chronischen Verweigerung, bei einem Stil oder einem künstlerischen Umfeld zu bleiben, gekennzeichnet war. Klar, andere wichtige Künstler der Ära passten sich neuen Trends an: Steve Winwood etwa wandte sich, als er von der Spencer Davis Group zu Traffic wechselte, vom R&B der Mod-Ära ab und der Psychedelia zu, später spielte er folkig-jazzig angehauchten Progressive Rock. Bowie jedoch verwarf seinen Stil abrupt und vollständig. Es wurde zu seinem Markenzeichen, etwas, für das er später gelobt und bewundert werden sollte. In den 1960ern wirkte er damit allerdings noch wie ein Wannabe von vielen, der von einem Fehlversuch in den nächsten tappte. Ebenso tappte er von Vorbild zu Vorbild: Keith Relf von den Yardbirds, Bob Dylan, Anthony Newley und einige mehr.
Von den Genannten hatte Anthony Newley, den man nahezu als das Fundament von Bowies frühem Stil bezeichnen könnte, den größten Einfluss. »Ich war der schlechteste Imitator der Welt … ein Jahr lang war ich Anthony Newley«, erinnerte sich Bowie 1973 dem NME gegenüber, als er darüber sprach, wie junge Künstler ihre Eindrücke notwendigerweise zuerst durch das Imitieren der Künstler, die sie beeindruckten, verarbeiteten. »[Newley] war einer der talentiertesten Künstler, die England je hervorgebracht hat«, schwärmte Bowie, immer noch ganz Fan. Newley mag inzwischen größtenteils vergessen sein, in den späten 1950ern und 1960ern jedoch war er eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren im Showbiz. Bowie wurde wohl teils von dessen großer künstlerischen Vielseitigkeit angezogen: Newley war Sänger und Recording Artist, Songwriter für andere Interpreten, Schauspieler in Theater, Film und Fernsehen, und komponierte Musicals. Bowie fand darin Vorbild und Ideal.
Bowies Biografen, Kritiker und Fans beschäftigen sich meist kaum damit, wie viel er Newley verdankt, sei es aus Verwirrung oder Scham. Sie geben zu, was nicht abzustreiten ist: die unverkennbaren Gemeinsamkeiten im Gesangsstil, wie exakt Bowie Newleys Vokale im Cockney-Akzent nachahmte, seine dem Rock ’n’ Roll so ferne Klarheit in Aussprache und theatralischer Umsetzung. Aber sie tauchen nie tiefer darin ein, warum sich der junge Sänger so sehr auf den älteren Star einschoss oder was er, abgesehen von Gesangseigenarten, noch so von ihm entlehnte. Bolan erinnerte sich daran, Bowie einmal in seiner Südlondoner Wohnung besucht zu haben, wo »er immer Anthony-Newley-Platten auflegte«, die dann ihren Weg in Bowies frühe Soloaufnahmen fanden, mit ihrem »sehr theatralischen Beigeschmack« und den »sehr spießigen Backings«.
Dabei war Newley gar nicht so spießig wie sein Ruf als mittelmäßiger Sänger für ältere Leute. Tatsächlich gehörten seine künstlerischen Visionen zu den sonderbareren der Branche. Nachdem ihn während des Zweiten Weltkriegs ein Varieté-Veteran unter die Fittiche genommen hatte, wurde er Kinderstar, spielte Artful Dodger in einer Verfilmung von Oliver Twist und hatte Auftritte im Fernsehen sowie einige Hit-Singles im Zuge des Rock-’n’-Roll-Hypes. Dennoch fehlte ihm das Gefühl für die neue Jugendmusik. In den frühen 1960ern trat er in Musicals auf, die er mit seinem Partner Leslie Bricusse geschrieben hatte, darunter Stop the World – I Want to Get Off und The Roar of the Greasepaint, the Smell of the Crowd. Seine Musical-Erfolge in den USA machten aus ihm schließlich einen extrem beliebten Entertainer, sei es auf der Bühne oder im Fernsehen.
Typisch für Newleys Werk war die Kombination eines Bildes von Englishness (überkorrekte, über sich selbst lustig machende Gesten) und Elementen aus der Pantomime, die oft mit Marcel Marceau verglichen wurden (wie der Pierrot-ähnliche tragische Clown Littlechap in der Zirkus-Allegorie Stop the World). Dazu kamen ein mit Fatalismus gekoppelter absurd-existentialistischer Humor und eine selbstreferentielle Performance, bei der Schauspieler aus ihren Charakteren heraus- und wieder hineinschlüpften und Handlungen die vierte Wand durchbrachen. Newleys Song »The Man Who Makes You Laugh« etwa ist ein Blues-Song, in dem ein Komiker »das Monster mit tausend Augen« füttert. Gemeint ist das unersättliche, launische Publikum. In einer britischen Talkshow treibt Newley den Song auf die Spitze, tut so, als wäre das Publikum der Spiegel, vor dem er sich Make-up aufträgt.
All das – Pantomime, Meta-Ebenen, Varieté, Overacting – war ein großer Teil der außergewöhnlichen TV-Serie The Strange World of Gurney Slade, die im Herbst 1960 lief. Newley, der die Hauptrolle spielte, hatte die Show auch selbst entwickelt; geschrieben worden war sie von Dick Hills und Sid Green. »Erinnert ihr euch an Gurney Slade? Das war großartig«, sagte Bowie 1973. »Ein Freund von mir hat alle Folgen, da steckt eine Menge Monty Python drin.«
Die erste Folge beginnt damit, dass Newley als Gurney Slade – ein Schauspieler in einer Soap – zum Entsetzen von Crew und Darstellern das Set verlässt, draußen jegliches Spiel fallen lässt und manisch die Straße entlangspringt. Gurney Slade lässt seinen Realismus unentwegt einbrechen: Newley spricht den Zuschauer direkt an, unterhält sich aber auch mit einem Stein, einem Mülleimer, einer Kuh und einem Hund. Letzterer erzählt ihm, er sei ein Fan von Lassie, nicht aber von Rin Tin Tin. Der sei »zu überzeichnet … nicht lebensecht«, weil er an zu vielen Bäumen vorbeilaufe, ohne zu pinkeln. Die Serie parodiert das Fernsehen und liefert dabei einen Kommentar über die Gepflogenheiten dessen, was Slade bissig »das goldene Zeitalter des britischen Entertainments« nennt.
Ihren Höhepunkt fand diese Tendenz zur Selbstreflexion in zwei äußerst witzig-subversiven Folgen irgendwo zwischen Luigi Pirandellos Theaterstück Sechs Personen suchen einen Autor (1921) und Tom Stoppards Film Rosenkranz & Güldenstern (1990, zeigt das Leiden zweier Nebenfiguren aus Hamlet abseits des Plots). In der vorletzten Folge muss sich Slade vor Gericht dafür verantworten, vor »7 Millionen Zuschauern […] zur Erheiterung dieser Zuschauer […] auf einem Fernsehbildschirm« erschienen zu sein, dabei aber niemandem »auch nur ein Schmunzeln« entlockt zu haben. Sein Verteidiger wirkt eher wie ein Clown: Es handelt sich um Archie Rice, den heruntergekommenen Varieté-Künstler, den Laurence Olivier in John Osbornes The Entertainer (1960) spielte. Die letzte Folge treibt das Spiel des Fernsehens über Fernsehen schließlich auf die Spitze: Slade wird von den Charakteren konfrontiert, die er in vorigen Folgen geschaffen hat. Sie sorgen sich darum, was mit ihnen passieren wird, wenn die Show einmal vorbei ist. Schließlich taucht ein Mitarbeiter des »Amtes für Charaktere« auf und bietet ihnen Rollen in anderen Serien an. Für Gurney Slade hingegen nimmt alles ein Ende: Nach und nach verwandelt er sich in eine Bauchrednerpuppe, bis Anthony Newley auf die Bühne schreitet, um sein neues, hölzernes Alter Ego davonzutragen.
Hier werden die Wurzeln der LP The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars von 1972 sichtbar, und in Gurney Slades ambivalenter Haltung gegenüber dem Showbiz liegt auch eine Vorahnung von Bowies eigenem schaurigen Enthüllungsbericht über Paranoia und Oberflächlichkeit des Ruhmes, den Song »Fame« aus dem Jahr 1975. In einer Szene wird der Geschäftsführung des Senders ein brandneues Modell eines Allzweckperformers vorgestellt, der »praktisch alles kann […] Gesang, Comedy […] Tonaufnahme«. Doch es ist Gurney Slade, der bitter in sich rein nuschelt: »Sie denken, ich wäre eine Maschine […] Denen werde ich’s zeigen […] Ich werde hier einfach sitzen und jede Bewegung verweigern.«
In den 1960ern, als Frontmann einer Reihe von Rockbands, strebte Bowie selbst danach, »ein Allzweck-Modell« zu sein – der anpassungsfähige All-round-Entertainer in Varieté- und Vaudeville-Tradition, der »ein Lied, einen Tanz, ein Lachen« in einer Anzeige der Entertainment-Zeitung The Stage anbietet. Schulen für darstellende Künste unterrichteten ihre Schüler stets in allen Theaterkünsten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern: Stepptanz, Pantomime, Gesang, Schauspiel. Auf ähnliche Weise sah Kenneth Pitt – eine zweite Vaterfigur, mit der der junge Sänger einige Jahre zusammenwohnte – in seinem Schützling einen vielseitigen Star, dessen Potential nicht nur auf die Pop-Arena beschränkt ist, sondern auch Cabaret und Film miteinschließt. (Zum Beispiel sicherte ihm Kenneth Pitt eine Rolle in dem Film The Virgin Soldiers.)
»Wer ihn und mich beurteilt und dabei Rock ’n’ Roll als seinen Maßstab nimmt, hat nicht verstanden, dass David niemals ein Verehrer oder Vertreter des Rock ’n’ Roll war«, schrieb der Manager in seinen Memoiren Bowie: The Pitt Report. »Wann immer er sich dem Rock ’n’ Roll hingab, tat er das im Kontext des Theaters, als Schauspieler«, fuhr er fort und zitierte dabei Bowies eigene Behauptung, dass Rock in seinem Leben keine wichtige Rolle spiele. Bolan erkannte diese mangelnde emotionale Bindung, als er beobachtete, dass Bowie »damals sehr Cockney« gewesen sei. »Wir alle waren auf der Suche nach etwas, das uns begeisterte […] Ich wollte Bob Dylan sein, aber ich glaube, David orientierte sich mehr am Humor des Varieté. Es war nicht die Zeit dafür, aber alle seine Songs erzählten Geschichten.«
1966 – im Jahr von Revolver, Blonde on Blonde, Pet Sounds und einem halben Dutzend anderer Meisterwerke; dem Jahr also, als Rockmusik unbestreitbar zur prägenden Popkultur ihrer Zeit wurde – erzählte Bowie dem Melody Maker von seinen Plänen, zusammen mit dem mittelmäßigen Arrangeur und Songwriter Tony Hatch ein Musical (namens Kids on the Roof) zu schreiben und dass sein eigentlicher Ehrgeiz in der Schauspielerei liege. »Ich übernehme gerne Charakterrollen. Um jemand anderes werden zu können, muss man viel von sich abverlangen.«
Ein paar Songs aus dem niemals verwirklichten Musical fanden ihren Weg auf Bowies selbstbetiteltes Debütalbum für Deram, das »progressive« Tochterunternehmen des großen Majorlabels Decca. Ende 1966 und Anfang 1967 aufgenommen, tauschte Bowie für das Album seine damals aktuelle Band The Buzz (mit Ausnahme von Bassist Dek Fearnley, der sich um die Arrangements kümmerte) gegen professionelle Session-Musiker aus. Lebhafte Basslines, verspielte Drums, tutende Trompeten, schnaufende und keuchende Tubas, schrill zwitschernde Piccolo- oder Blockflöten, vielleicht etwas Ukulelengeschrammel oder das schäbige Klimpern eines Pianos: Der Sound war in einem originell ausgeschmückten Stil gehalten, wie er sich sonst auf den Comedy-Alben dieser Zeit finden lässt. Bei Ken Dodd and the Diddymen etwa, oder bei The Bonzo Dog Doo-Dah Band. Die Non-Album-Single »The Laughing Gnome«, ein albernes Liedchen über ein koboldähnliches Wesen, weist Ähnlichkeit mit »Puckwudgie« auf, einer späteren Hit-Single des Komikers Charlie Drake. Mit seinen peinlichen, wenn auch originellen Wortspielen und den stark beschleunigten Stimmen von Toningenieur Gus Dudgeon und Bowie selbst in den Rollen des Koboldes wurde »The Laughing Gnome« 1967 ein Flop sondergleichen.
»The Laughing Gnome« und das selbstbetitelte Debüt gehören in die Tradition des Comedy-Pop, wo Musik eindeutig Hintergrundmusik ist. Sie wird in ihre Schranken verwiesen, dient als Unterstützung oder höchstens als dramatisches Gegenstück zum Sänger. Priorität hat die Verständlichkeit der Texte, die klar ausgesprochen und im Sinne der Dramatik überdeutlich betont werden. In seiner Betrachtung der Varieté-Tradition des character songs schreibt Simon Frith, dass »der Sänger eine Rolle [spielt]«. Diese umfasst »weder Selbstausdruck […] noch kritischen Kommentar«. Stattdessen ist alles »eine Frage des Schauspiels«.
Auf das Album David Bowie trifft das uneingeschränkt zu. Die Single »Love You Till Tuesday« etwa ist eine vergnügliche Rangelei zwischen übertrieben englischer Aussprache (»hoping for a little romance« wird zum nasalen »romarnnnce« an Stelle des amerikanischen »romaaanse«) und komödiantischer Schauspielkunst – Bowie scheint darauf Kenneth Connor oder Jim Dale aus den Slapstick-Komödien der Carry On-Reihe zu imitieren. »We Are Hungry Men« – eine nur scheinbar ernsthafte, dystopische Warnung vor einer bevorstehenden Überbevölkerungskrise – steckt voller komischer Twists: eine nobel klingende Stimme, ähnlich der des Schauspielers Peter Sellers, liest astronomisch hohe Bevölkerungszahlen bekannter Städte in der Zukunft vor (New York zum Beispiel hat 80 Millionen Einwohner), später schlägt eine deutsche Nazi-Karikatur Massenabtreibungen und legalen Kindsmord vor und droht damit, jeden niederzumetzeln, der »schuldig befunden wird, mehr als die ihm zugewiesene Luft eingeatmet zu haben«.
Gewöhnlich findet Rock ’n’ Roll in erster oder zweiter Person statt: Er spricht als ein »I« oder manchmal als ein »we« und richtet sich an ein »you«. Zwischen 1966 und 1967 jedoch waren im Vereinigten Königreich Vignetten in dritter Person und satirische Darstellungen bestimmter »Typen« in Mode: Mit »Eleanor Rigby« und »Dedicated Follower of Fashion« gaben die Beatles und die Kinks den Weg vor, bald folgten ihnen große Hits wie Cat Stevens’ »Matthew and Son« und Keith Wests »Grocer Jack«. Bowies Debüt-LP lag mit seiner Dominanz an Porträts in dritter Person also voll im Trend. Der erste Track »Uncle Arthur« erzählt von einem emotional zurückgebliebenen, unverheirateten Ladenbesitzer, der bei seiner Mutter wohnt, während »Little Bombardier« von einem verbitterten Kriegsveteran handelt, dessen Freundschaft zu kleinen Kindern unfairerweise von der feindseligen, verständnislosen Welt mit Argwohn betrachtet wird. »Join the Gang« ist eine Satire auf die Swinging Sixties, die deren Standardcharaktere abarbeitet, zum Beispiel den Sitar-spielenden Existentialisten Johnny, das ehemalige Model Molly, oder Arthur, den Sänger einer »heavy« Band, der den Blues krächzt und gierig säuft.
Selbst wenn er in erster Person singt, spielt Bowie auf dem Album eine Rolle, etwa in »Please Mr Gravedigger«, dem letzten Song der Platte. Dieser wird weniger gesungen, sondern vielmehr rezitiert und mit Soundeffekten (Kirchenglocken, entferntem Donner, strömendem Regen und fließendem Wasser, lautem Niesen und, natürlich, dem Buddeln einer Schaufel) ausgeschmückt, sodass er mehr einem kleinen Radiohörspiel ähnelt als einem Song. Der Plot macht nicht wirklich Sinn – der Erzähler ermordet ein kleines Mädchen, beichtet seine Tat dem Totengräber und hebt dann ein Grab für diesen aus, damit keiner von seinem Geheimnis erfährt –, aber mit seiner schrullig-makaberen Atmosphäre ist es das erstaunlichste und originellste Stück auf David Bowie.
Das seinerzeit erfolglose Album und einige bei Deram erschienene Singles und B-Seiten dieser frühen Phase wurden 1973, nachdem Bowie zum Star geworden war, als die Doppel-LP Images 1966–1967 wiederveröffentlicht. (Deram veröffentlichte – ohne Bowies Zustimmung – »The Laughing Gnome« erneut als Single. Diesmal schaffte es der Song zum Entsetzen des Künstlers in die Top 10.) Die Liner Notes beschreiben die Zusammenstellung als »Album von Showtunes, die keiner Show angehören«. Obwohl Characters dem Inhalt des Albums angemessenerer gewesen wäre, ist Images ein vielsagender Titel, der etwas Essentielles an den 1960ern einfängt, die Bowie prägten und ihm später ermöglichen würden, die britischen 1970er zu dominieren.
Wie Bolan war auch Bowie den Mods verfallen, einer Jugendbewegung, die so viel Wert auf ihr Image legte wie keine zuvor. Seine frühen Bands, wie The Lower Third und The Manish Boys, passten alle in die Mod-/Brit-R&B-Sparte. Der Subkulturanalytiker Dick Hebdige hat über eine Mod-spezifische Art zu stehen geschrieben, eine Körperhaltung, die Blicke auf sich lenken sollte (ob die dann beeindruckt oder empört waren, war ziemlich egal). Diese steife Pose – die Hebdige in seinem Essay »Posing … Threats, Striking … Poses: Youth, Surveillance, and Display« als »autoerotisch« bezeichnet – verwandelte »die Tatsache, unter Kontrolle zu stehen in das Vergnügen, beobachtet zu werden […]. Manche Jugendliche streben die Eintönigkeit und Stille von Fotografien an. Nur durch die bewundernden Blicke von Fremden werden sie komplettiert.«
Das verstärkte Gefallen junger Männer am eigenen Erscheinungsbild während der 1960er – bei altmodischen Männern als »weibisch« und »tuntig« verschrien – war zu einem großen Anteil dem Aufstieg von Fotografen zu Stars geschuldet. »Der Pop-Fotograf […] hat diese Eigenschaften, die bis in die 1960er wesentlich als homosexuell galten, gewandelt und sie denjenigen geöffnet, die vormals als ›red-blooded males‹* bekannt waren«, schrieb George Melly in Revolt into Style. Nicht nur zelebrierten Starfotografen wie David Bailey die klassenlose Aristokratie im Swinging England, wo die Hierarchie durch Stil und Aussehen bestimmt war. In gewisser Weise war sie ihre Kreation.
Nachdem das neue Dandytum durch die Mods losgetreten und durch die Modeseiten von Qualitätsmagazinen und Werbeanzeigen von Starfotografen verbreitet worden war, erreichte es auch den Mainstream. Waren Fernsehmoderatoren zuvor seriös, aber ohne jeden Schick gekleidet, gab es nun etwa Simon Dee, der von einem Piratensender ins Fernsehen wechselte, wo er eine Talkshow moderierte. Dee war ganz bewusst »up to date«. 1968 schwärmte er in seinem Simon Dee Book vom damaligen Gesinnungswandel:
»Vor zwanzig Jahren galt es noch als weibisch, sich als Mann für Mode zu interessieren und niemand nahm einen ernst. Stattdessen bestand Ausgehkleidung aus einem formlosen, grauen oder blauen Anzug mit Hosenaufschlag, einem weißen Hemd und einer Krawatte, wie man sie von seiner Tante immer zu Weihnachten bekam. […] Nachdem die Carnaby Street auf der Bildfläche erschienen war, störte sich niemand mehr an lila Gehröcken, pinken Hemden und Stiefeln aus Wildleder. Auf einmal galt es als smart, auf das eigene Erscheinungsbild zu achten. Deine Kumpels hielten dich überhaupt nicht mehr für verweichlicht – sie waren ohnehin zu sehr damit beschäftigt, selbst in den Boutiquen auf Jagd zu gehen. […] Hoch die Revolution – verbannt all die trostlosen Grautöne und Nadelstreifen der Regenschirm-Fraktion! Lasst die Pastellfarben, Voile- und Mohairstoffe der whiz kids die Kontrolle übernehmen!«
Bowie war ebenso Produkt wie Vermittler dieses Wandels. »Ich habe ihm mal Fragen über seine Mod-Phase gestellt«, erinnert sich Michael Watts vom Melody Maker. »Ich fragte: ›Wie warst du so drauf?‹ Und Bowie sagte: ›Nun, ich habe Eyeliner und Cossack-Haarspray getragen, was jeder tat. […] Ich denke, man könnte sagen, ich war camp mit Eiern.‹«
Bowies androgyne Qualitäten waren es auch, die seine verschiedenen Manager und Mentoren während seiner »Ausbildung« zum Star so faszinierten. Noch bevor er den entsprechenden Sound gefunden hatte, hatte er den Look einer potentiellen Ikone.
Marc Bolan glaubte, dass Bowies Interesse an Pantomime durch Anthony Newleys Stop the World – I Want to Get Off geweckt worden war. Doch als Bowie 1968 auf das Werk Lindsay Kemps und seiner kleinen Theatertruppe stieß, entdeckte er eine Art der Pantomime, die deutlich experimenteller und grenzüberschreitender war. Kemp war beeinflusst von Jean Genet und Oscar Wilde sowie japanischer Theaterkunst wie Kabuki.
Es war allerdings Kemp, der zuerst auf Bowie zukam. Dessen Debütalbum war in Kemps Besitz geraten. Die Songs – und ihr Sänger – entzückten ihn so sehr, dass er »When I Live My Dream« (eine von Bowies süßlicheren Nummern im Newley-Stil) in sein aktuelles Programm aufnahm. Dann lud er Bowie ein, sich die Performance in einem winzigen Dachgeschoss in einer Gasse im Herzen von Londons Theaterviertel anzusehen. Kemps Act, der auf die Kunstfigur des Pierrot zurückging, begeisterte Bowie, der nach der Show in Kemps Wohnung in Soho auch mit dessen Freunden in Kontakt kam. Bald darauf nahm er Tanzstunden bei Kemp, außerdem wurde er Teil seiner Truppe und arbeitete mit ihm an dem Stück Pierrot in Turquoise. Und sie wurden ein Liebespaar.
»Alles, was ich für die Bohème hielt, lebte [Kemp] aus«, erinnerte sich Bowie Jahre später. »Alles an seinem Leben war theatralisch. […] Was auf der Bühne geschah, war nur eine Erweiterung seiner selbst […], seines Alltags.« Im Internat hatte Kemp »die Kunst des Mesmerismus« erlernt, als Überlebenstaktik: »Es reichte nie aus, sie zu unterhalten«, blickte er zurück. »Ich musste sie verzaubern.«
Durch Kemp kam Bowie in Kontakt mit vielen Dingen, die sich später in seiner Musik und seinen Auftritten wiederfinden würden, von Kabuki bis Genet. Flowers, die 1968 aufgeführte Interpretation der Kemp-Truppe von Genets Notre Dame des Fleurs – laut dem Journalisten Rupert Smith eine »halluzinogene Erzählung über Drag Queens, Zuhälter, Mörder und Matrosen« –, wurde eine der berühmtesten Darbietungen der Truppe: »gewalttätig, einer Orgie ähnelnd, konstant an der Grenze zum Bathos* und ganz und gar homosexuell«. Kemp vervollständigte Bowies Schulung in schwulem Ästhetizismus, die Kenneth Pitt angefangen hatte, als er den Sänger mit Oscar Wilde, Aubrey Beardsley und den Romanen Christopher Isherwoods aus dessen Zeit im Berlin der Weimarer Republik in Kontakt brachte.
Unter Kemps Anleitung lernte Bowie, seine körperliche Präsenz zu nutzen, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen. »Ich habe David beigebracht, seinen Körper zu befreien«, erzählte Kemp dem Magazin Crawdaddy 1974. »Ich habe ihm beigebracht, sowohl seinen Körper als auch seine Stimme zu überbetonen … Seitdem er mit mir zusammengearbeitet hat, macht er das. Mit jedem Auftritt […] werden seine Bewegungen erlesener. […] Ein Pantomime nutzt Gestik, um seine innere Schönheit zu offenbaren. […] Bowie tut das mit seiner Stimme.«
Kemp half auch, die äußere Schönheit des immer noch schüchternen Sängers aufzupolieren. Nova Magazine erzählte er: »Ich wusste, wie wunderschön er war, doch ich wollte, dass es auch andere Leute erkannten. Ich musste ihn dazu drängen. Ich bemalte sein Gesicht und färbte seine Haare, damit er auffallen würde, […] damit die Leute sehen würden, wie sexy und schön er war.«
Kemps Erzählungen sind vermutlich etwas übertrieben – Bowie war sich der Wirkung seines Aussehens sehr wohl bereits bewusst. Sie hegen auch eine gewisse Ähnlichkeit zu »I’ll Be Your Mirror«, dem Velvet-Underground-Song aus der Feder Lou Reeds, gesungen von Nico. Das gilt vor allem für die Zeilen, nicht glauben zu können, dass sich das Gegenüber seiner Schönheit nicht bewusst ist (»you don’t know the beauty you are«) und das Versprechen, nur die Wahrheit zu spiegeln. Bowie war dank Kenneth Pitt einer der ersten Briten, die diesen Song und das Debütalbum, auf dem er erschien (The Velvet Underground & Nico, 1967), gehört hatten. Pitt hatte Andy Warhols Factory auf einer Geschäftsreise nach New York im November 1966 besucht und dort eine Promo-Pressung der Velvet-Underground-LP bekommen. Songs und Musik dieser Band würden – gemeinsam mit dem dekadenten Camp-Milieu, das sich um Bandmentor Warhol formiert hatte – großen Einfluss auf Bowies Musik und Image in den 1970ern ausüben. 1968 jedoch spielte er mit dem Gedanken, das Musikbusiness hinter sich zu lassen und Tänzer zu werden.
»The Mirror« war dann auch der Titel eines neuen Songs, den Bowie für Pierrot in Turquoise geschrieben hatte, als es Anfang 1970 unter dem Titel Pierrot in Turquoise, or, the Looking Glass Murders für das schottische Fernsehen adaptiert wurde. Eigentlich hatte Bowie zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr zu Kemp, den er mit einer der Tänzerinnen seiner Truppe betrogen hatte. Doch für das halbstündige TV-Special schlüpfte er wieder in die Rolle des Erzählers. In »The Mirror« werden Bowies Zeilen über den »fröhlichen Harlekin«*, einen »Feen-Troubadour« und einen Spiegel, der »von dir besessen« ist, von einem surrealen Spektakel untermalt, in dem der Harlekin in einem Balztanz mit Columbine durch ein traumähnliches Set voller nackter, armloser Schaufensterpuppen und Stehleitern umherspringt. Der Harlekin hat eine Glatze, ist schwarz und nackt – mit Ausnahme seiner goldenen Ohrringe, seinen glitterverkrusteten Augen und dem bizarr anmutenden Unterteil eines Gymnastikanzugs, das aussieht, als trage er Hosenträger an einer Badehose. Columbine hat manische Augen, eine entsprechende Frisur und trägt ein grünes Kleid mit zerzausten Ärmeln. Bowie als Erzähler ist kurz über einer der Stehleitern zu sehen, sein Gesicht schneeweiß, seine Haare wuschelig und mit Puder bestreut. Schließlich zoomt die Kamera hinaus, der Harlekin und Columbine sind durch das Bühnenportal eingerahmt. Der Vorhang schließt und öffnet sich, dazu wird Applaus eingespielt und das Gemälde eines viktorianischen Theaterpublikums gezeigt.
Die Maske ist ein zentrales Element der Pantomime: Die weiße Theaterschminke entpersonalisiert und ersetzt individuelle Gesichtsmerkmale durch eine leere Leinwand, auf der sich stilisierte Emotionen abbilden lassen, deren Darstellung universellen, zeitlosen Regeln folgt. In der Pantomime geht es darum, seinem eigentlichen Selbst zu entfliehen und dafür in das Kostüm einer fiktiven Persona zu schlüpfen. Ihre Vorfahren sind das mittelalterliche stumme Spiel, Maskenspiele und Mummenschanz, weitere Parallelen gibt es zu den japanischen Formen Noh und Kabuki. Auch in die Popkultur des 20. Jahrhunderts sickerte sie mit tragikomischen Stummfilmstars wie Buster Keaton durch. Pantomime ist die reinste und essentiellste Form des Theaters. Im Deutschen gibt es ein Wort dafür: Maskenfreiheit. Diese Befreiung von der Last, sein wahres Ich auf der Bühne darstellen zu müssen – würde für Bowies weitere Karriere von entscheidender Bedeutung sein.
Gegen Ende seiner Zeit mit Kemp schrieb Bowie ein Pantomime-Stück mit dem Titel »The Mask«, das später als Segment in einem Promofilm verwendet wurde, den Kenneth Pitt Anfang 1969 finanzierte, um die stagnierende Karriere seines Schützlings voranzubringen. Darin spielt Bowie in einer Aufmachung, die der Marcel Marceaus ähnelt, einen jungen Mann, der eine Maske in einem Trödelladen entdeckt. Ursprünglich ist sie nur zur Unterhaltung von Familie und Freunden gedacht, doch bald findet der Junge heraus, dass es eine Karriere ist, die er da in den Händen hält. Auf dem Höhepunkt seiner folgenden Laufbahn – einem Konzert im Londoner Palladium – stellt er zu seinem Grauen fest, dass er das steife Grinsen seiner Bühnenpersona nicht mehr abnehmen kann. Elendig dreht und windet er sich im Scheinwerferlicht, bis ihn schließlich der Tod erlöst. Aus dem Off kommentiert Bowie trocken: »Die Zeitungen machten eine große Sache aus dem Vorfall. […] ›Auf der Bühne erwürgt‹, hieß es. […] Seltsamerweise […] erwähnten sie die Maske mit keinem Wort.« Zwar wirken Bowies marionettenartige Bewegungen ungeschickt, dennoch ist »The Mask« ein bemerkenswert selbstkritischer Vorblick auf den Preis von Ruhm und den entwurzelnden Effekt, den ein öffentliches Image mit sich bringt.
»Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er für sich selbst spricht. Gib ihm eine Maske und er wird dir die Wahrheit sagen«, verkündete Oscar Wilde in »Der Kritiker als Künstler«, neben »Der Verfall des Lügens« und »Die Wahrheit der Masken« eines seiner berühmtesten ästhetischen Manifeste. Wilde ist der erste Philosoph des Glam, dessen Grundsätze er achtzig Jahre vorher postulierte. Nicht nur mit seinen Essays, sondern vor allem mit Das Bildnis des Dorian Gray, das weniger ein Roman ist als vielmehr ein Gerüst, das Wilde mit seinen Theorien und Standpunkten zur Ästhetik in Form exzellent ausgearbeiteter, beißend schlagfertiger Epigramme und Aphorismen füllt. Hauptsächlich geschieht das durch Lord Henry, eine Figur, die Wilde nutzt, um seine Abscheu vor Authentizität und Natürlichkeit zu formulieren, die für ihn ermüdender Humbug sind: »Natürlich zu sein, ist nichts als Pose, die irritierendste Pose, die ich kenne«; »der Wert einer Idee hat absolut nichts mit der Aufrichtigkeit des Mannes zu tun, der ihr Ausdruck gibt«. Theatralität und Fassaden des gesellschaftlichen Lebens hingegen zelebriert er: »Nur geistlose Leute beurteilen Andere nicht nach deren Auftreten«; »Ich liebe das Schauspiel. Es ist so viel echter als das Leben.«
Bowies komplette Karriere – und das misstrauische Nörgeln seiner Kritiker – nimmt Wilde mit einer rhetorischen Frage vorweg: »Ist Unaufrichtigkeit denn so etwas Schreckliches? Ich denke, nicht. Sie ist nichts weiter als eine Methode, mit der wir unsere Persönlichkeiten vervielfachen können.« Doch was Wilde wirklich zum Propheten des Glam macht, sind nicht einmal so sehr seine stichfest geschlussfolgerten Paradoxe und schelmischen Umkehrungen dessen, was als gesunder Menschenverstand gilt, als vielmehr der Irrationalismus, der unter der Oberfläche hervortritt wie berauschende Dämpfe. Das Bildnis des Dorian Gray ist ein heidnischer Lobgesang auf den Kult um Jugend und Schönheit, seine blasphemische Note kaum zu übersehen. »Du wurdest erschaffen, um verehrt zu werden«, sagt Basil, der Künstler, dem zarten Dorian. Der Text ist voll von Wörtern wie »Gift« (im Sinne von »Rauschmittel«) und »Einfluss« (als etwas Hinterhältiges, Korrumpierendes). Er lebt von Faszination und Charme, benutzt Wörter wie »Glanz«, »Charisma« und »Prestige«, die einen magischen Beiklang besitzen und dabei sinisteren Kräften Ausdruck geben, die vom rechten Weg ablenken und in die Irre führen. Die ständige Wiederholung ähnlicher Phrasen – »erlesenes Gift in der Luft«, »ein sonderbarer Einfluss über mir«, »sein seltsamer und gefährlicher Charme« – verleiht der Prosa eine beschwörende Nachdrücklichkeit.
Wer charmant ist, dem ist damit eine Lizenz gegeben: »Ich mische mich nie in die Angelegenheiten von charmanten Menschen ein«, witzelt Lord Henry. Oft nutzt Wilde auch Musik als Analogie, schließlich ist auch sie eine Kraft, die losgelöst von Rationalität und praktischer Notwendigkeit funktioniert, die überwältigt und verzaubert. »Schönheit ist eine Form von Genie«, eine Macht, die durch »göttliches Recht« regiert, so Wilde. »Die, die sie haben, werden durch sie zu Prinzen.« Schönheit ist primitiv und antimodern, eine Enklave aristokratischer Unnachgiebigkeit angesichts des hässlichen Antlitzes Englands im 19. Jahrhundert, das die industrielle Revolution und die kaufmännische Mittelklasse hervorgebracht haben – diese »dumpfe, geistlose Faktenhölle«.
Diese moderne Welt brachte wiederum ihre eigene Herangehensweise an Literatur und Drama hervor: den Realismus. In »Der Verfall des Lügens« wettert Wilde gegen die »Gefangenenanstalt Realismus«. Kunst, fordert er, müsse »vielmehr ein Schleier sein als ein Spiegel« und Fakten »in der ihnen angemessenen untergeordneten Rolle gehalten« oder gleich komplett verbannt werden aufgrund ihrer Stumpfsinnigkeit. Kunst brauche sich nur mit »schönen und unmöglichen Dingen« zu beschäftigen, mit Wundern und Monstern statt mit Alltag und gesellschaftlichen Zuständen. »Wir müssen die verlorene Kunst des Lügens kultivieren«, betont Wilde.
1967 tastete sich Bowie näher an seinen Traum heran, in anderen Unterhaltungsformen als Popmusik Fuß zu fassen und spielte in The Image mit, einem Kurzfilm, der einer Hammer-Film-Interpretation* von Das Bildnis des Dorian Gray gleicht. Regisseur Michael Armstrong bezeichnete den Film als »Studie der illusionären Wirklichkeit innerhalb des schizophrenen Geistes des Künstlers zum Zeitpunkt seiner Kreativität«, gedreht wurde er mit so gut wie keinem Budget. Der Film ist ein vierzehnminütiges Stück makabren Camps in schwarz-weiß, in dem ein Künstler das Porträt eines schönen jungen Mannes zeichnet, der dann lebendig (beziehungsweise untot) wird. Der Maler muss den Bowie-Zombie darauf wieder und wieder töten, mit zunehmend blutrünstigeren Methoden. Verkrampft sticht er zu, seine Angriffe werden dabei sexuell stilisiert, bis sich der Junge schließlich selbst in erotischer Pose mit der Klinge des Künstlers aufspießt. Der Film endet damit, wie der Künstler wie wild auf die Leinwand einsticht und schluchzend zusammenbricht, während die Kamera auf ein eingerahmtes Foto schwenkt, das – wie sollte es anders sein – den Jungen zeigt. Damit wird klar, dass er das Objekt einer zum Scheitern verurteilten Liebesaffäre war. Nun beharrt der Geist seiner Erinnerung darauf, immer wieder neu gemalt zu werden.
1968 war Bowie infolge des Flops seines Debütalbums weiterhin nicht auf einer Höhe mit den entscheidenden popkulturellen Strömungen der späten 1960er. Rock war 1968/1969 so wenig camp wie nie zuvor: heavy und bluesig, wurzelverhaftet und hinterwäldlerisch. Bowie hingegen orientierte sich immer noch am musikalischen Theater und der Pantomime.
Für eine Weile hatte er auch gar keine Orientierung. Als sein Vater sich besorgt über Bowies nicht vorhandenes Einkommen äußerte, antwortete der sofort: »Okay, dann geh ich eben ins Cabaret. Wann fangen wir an?« Mithilfe Kenneth Pitts erarbeitete er eine Show mit eigenen Nummern und Beatles-Covern, das Bühnenbild beinhaltete dabei sogar Pappaufsteller der Fab Four aus dem Zeichentrickfilm Yellow Submarine. Das Ergebnis wurde mehreren Vertretern der Branche vorgestellt, von denen einer voll des Lobes war (»besser als Cliff Richard!«), doch am Ende wurde es abgelehnt: Es sei zu clever für die Cabaret-Szene.
Also wechselte Bowie den Kurs – es war die erste von vielen großen Umorientierungen – und gab nun mit ganzem Herzen den Hippie. (Okay, nicht mit ganzem Herzen, einen Bart ließ er sich nicht wachsen.) Newley und Comedy Pop warf er über Bord, stattdessen wandte er sich dem Folk und den Singer-Songwritern zu, seine Texte wurden nun wortreicher und stützten sich auf Allegorien. Wie in Bolans Tyrannosaurus-Rex-Phase, sprach er in Interviews nun mit der in gegenkulturellen Kreisen üblichen Frömmigkeit. Und er versuchte das Undergroundpublikum zu erreichen, indem er auf kostenlosen Festivals spielte.
Festivals waren die totemistischen Events der Gegenkultur, vor allem wenn sie draußen in der Natur stattfanden. Bowie spielte auf einigen der wichtigsten Festivals dieser Ära, etwa dem Atomic Sunrise im Londoner Roundhouse Anfang 1970, wo er mit Undergroundbands wie Fat Mattress und Hawkwind auftrat, während Mitglieder des Living Theatre sich unters Publikum mischten, um die Grenze zwischen Bühne und Zuschauern aufzubrechen.
1971 spielte Bowie am frühen Morgen auf dem zweiten Glastonbury Festival (das sich damals noch Glastonbury Fair nannte). Wie man in Nicolas Roegs Dokumentarfilm sehen kann, war das Glastonbury damals ein Fest, das zu spiritueller Selbstfindung einlud und Skurrilitäten inspirierte, die oft ins Groteske umschlugen. Das vegetarische Essen hatte die gleiche Farbe wie der Schlamm, in dem nackte Hippies umhersprangen. Massen an ungepflegten haarigen Gestalten trommelten, spielten Flöte, musizierten spontan im Kollektiv. Ein verrückter Typ aus der Ladbroke Grove namens Mighty Michael grölte unten ohne auf der Bühne, während seine Genitalien mit jedem Schrei um sich schlugen. Glastonbury war vollkommen Anti-Glam, das exakte Gegenteil von allem, wofür Bowie später einmal stehen würde. Aber selbst so spät wie 1971 passte er dort noch hinein, neben Progressive-Schwergewichten wie Family, Gong und Quintessence und Folk-Künstlern wie Melanie und Fairport Convention.
Bowie hatte sich der Revolution so sehr verschrieben, dass er sogar sein eigenes Kunstlabor in Beckenham eröffnete. Kunstlabore waren – wie das Wort »Labor« nahelegt – experimentelle Freiräume für künstlerische Aktivitäten, die die Grenzen zwischen Disziplinen und Formen verwischten, Orte, an denen künstlerische Happenings stattfanden. Gründer des ersten Kunstlabors war Jim Haynes, der auch an der Gründung des experimentellen Theaters The Traverse beteiligt war und der Undergroundzeitung International Times vorstand. Im Sommer 1967 mietete Haynes ein Gebäude in der Londoner Drury Lane. Im Keller richtete er ein Nachtkino, eine Galerie im Erdgeschoss, einen Filmworkshop im Obergeschoss (der später in ein Restaurant umgebaut werden sollte) und ein Theater in einer angrenzenden Lagerhalle ein. Im ersten Arts Lab Newsletter definierte Haynes das Konzept folgendermaßen: »Ein Labor ist keine normale öffentliche Institution. Wir wissen alle, mit was für Beschränkungen ein Krankenhaus, ein Theater, eine Polizeistation und andere Einrichtungen arbeiten müssen. Aber ein Labor sollte keine Grenzen kennen.«
Haynes’ Erfindung fand zahlreiche Nachahmer im ganzen Land. Um 1969 waren es um die 50, das Beckenham Arts Lab miteingeschlossen, das im Frühling 1969 eröffnete und seinen Sitz im Three Tuns Club hatte. Dahinter steckten Bowie (der in der Drury Lane geprobt hatte und dort auch aufgetreten war) und ein paar ortsansässige Gleichgesinnte, darunter Mary Finnigan, eine junge Frau, mit der er zusammenwohnte. Mit ihr gründete er eine Organisation namens Growth, die den Slogan »Growth* sind die Menschen, Growth ist Revolution« hatte.
Bowie beteiligte sich weniger an der Verwaltung, stattdessen wurde er zum öffentlichen Sprecher des Arts Lab. Der International Times erzählte er, es sei Ziel, ein breiteres Publikum anzusprechen und auch Eltern und Spießer zu erreichen, also nicht nur die bereits eingeweihte, hippe Klientel. »Kunstlabore sollten allen offenstehen, nicht nur einer Minderheit von Insidern. Wir brauchen Energie aus allen Richtungen, von Potheads wie von Skinheads**.« Im Gegensatz zu anderen »Pseudo-Freiräumen« zog das Beckenham Arts Lab auch »echte« Leute wie »Arbeiter oder Bankangestellte« an, so Bowie gegenüber dem Melody Maker. Bowie vermittelte den Eindruck, vollkommen hinter der »Arts-Lab-Bewegung« zu stehen, die er als »extrem wichtig« beschrieb: »[Das Konzept] sollte das des Jugendzentrums ersetzen.«
Ein eigenes kostenloses Festival auf die Beine zu stellen, war der nächste logische Schritt. »The Growth Summer Festival and Free Concert in Beckenham« fand am 16. August 1969 auf dem Freizeitgelände der Stadt statt. Es fiel mit dem historischen Woodstock Festival zusammen, hatte aber das bessere Wetter. Das Angebot – wahrgenommen von etwa 3.000 Menschen – umfasste unter anderem Stände mit exotischen Teesorten, Kräutern, Schmuck, Töpferkunst, Postern und eigenen Kunstwerken. Außerdem gab es Straßentheater, ein tibetisches Geschäft, ein traditionelles Dorffest und Karnevalsattraktionen wie Zuckerwatte, einen Hindernisparcours und eine Wurfbude. Das Brian Cole Puppet Theatre präsentierte, was Puppenspieler David Bebbington als »ziemlich drogenbeeinflusste Version eines Puppenspiels für Kinder« bezeichnete. Live-Musik kam von Folk-Acts wie Bridget St. John oder The Strawbs, und auch Bowie selbst spielte auf der alten viktorianischen Bühne. Einzig Bowies schlechte Laune warf einen Schatten auf die idyllische Atmosphäre des Festivals – sein Vater war kürzlich verstorben. Als seine Growth-Mitstreiter die Einnahmen zusammenzählten, beschimpfte er sie als »geldgierige Schweine«.
Während seiner Hippiephase orientierte sich Bowie auch an der damals angesagten Musik. Mithilfe einer Anzeige in der International Times engagierte er Tony Hill, Gitarrist von The Misunderstood, einer Psychedelic-Band, der John Peel in seiner Piratensendung The Perfumed Garden viel Platz einräumte. Zusammen mit Hermione Farthingale – Bowies Freundin vor Mary Finnigan – gründeten sie das Multimedia-Trio Turquoise, das sie allerdings bereits nach dem ersten Gig in Feathers umbenannten. Als Hill die Gruppe verließ, um die Acid-Rock-Band High Tide ins Leben zu rufen, ersetzte Bowie ihn mit einem seiner alten Bandkollegen von The Buzz. Mit einer nervösen Mischung aus Pantomime, Ballett, Poesie und Songs machte das neue Trio weiter. Das Ergebnis wirkte wie eine Cabaret-Aufführung der LSD-Ära, mit Covern von Jacques-Brel-Songs sowie Bowie-Originalen wie dem exzentrischen aber schwachen »Ching-a-Ling«.
Feathers verliefen schließlich im Sand. Bowie trieb weiter ziellos dahin, schrieb Songs im Stil von Hippiebarden wie Shawn Phillips und Tom Rapp. Kenneth Pitt missbilligte diese Entwicklung. In seinen Memoiren beschreibt er Bowie als »vergleichsweise orientierungslos« während dieser Zeit: »Seine Richtung war immer diejenige, der er in der jeweiligen Woche gerade gegenüberstand.« Im April 1969 schrieb Bowie seinem Manager einen Brief, der zeigt, wie verwirrt der Sänger war. Er streift einige vage, widersprüchliche Zukunftspläne. Bowie schreibt davon, ein Country-Pop-Album aufnehmen zu wollen und gleichzeitig seine aktuelle traditionelle Folk-Ausrichtung beizubehalten. Parallel dazu wollte er an einer Contemporary-Folk-Reihe im Sir-Christopher-Wren-Pub teilnehmen. Auch die Möglichkeit, ein Musical zu schreiben und Fernsehwerbung zu machen, spricht er an. Außerdem spielte er zu dieser Zeit mit dem Gedanken, eine Songwriting-Kollaboration à la Simon & Garfunkel mit einem Gitarristen namens John Hutchinson einzugehen.
Auch wenn diese Phase scheinbar ziellos und halbherzig war, ertraglos war sie nicht. Denn zu dieser Zeit entstand der Song, der Bowies Durchbruch bedeuten sollte: »Space Oddity«. Nachdem er Kubricks 2001: Odysee im Weltraum unter dem Einfluss chemischer Drogen gesehen hatte, schrieb er »Space Oddity« für den gleichen Promofilm, in dem »The Mask« vorkam.
»Space Oddity« ist pure Sixties-Quintessenz. Die Single nutzte den riesigen Erfolg von Kubricks Film (der besonders populär war, um ihn bekifft oder während eines Trips zu schauen) und profitierte von der Aufregung um die Missionen der NASA 1968, die bereits auf die Mondlandung im darauffolgenden Jahr verwiesen. Der Weltraum war eine der wichtigsten Inspirationsquellen für die Bildsprache des Acid Rock, sei es in »Mr. Spaceman« (The Byrds), »Third Stone from the Sun« (Jimi Hendrix) oder »Astronomy Domine« (Pink Floyd). Auch musikalisch traf »Space Oddity« voll ins Schwarze, weil es zwar im Post-Sgt. Pepper’s-Stil filmisch orchestriert ist, mit einem Fuß aber noch im Folk steht (Bowies einsame Stimme und die Akustikgitarre im Zentrum des Songs). Bowies Demo war düster und karg, aber nachdem es von Produzent Gus Dudgeon und einem Team von Sessionmusikern ausgeschmückt worden war, erinnerte die fertige Aufnahme an den psychedelischen Easy Listening von The Moody Blues (die ebenfalls 1969 To Our Children’s Children’s Children veröffentlichten, ein sinfonisches Konzeptalbum über die Mondlandung). Um »Space Oddity« den passenden Weltraum-Flair zu geben, wurden ein Stylophone (ein rudimentärer Synthesizer) und Streicher verwendet, von denen manche echt waren und manche durch ein neues Instrument namens Mellotron imitiert wurden. Das Mellotron war beinahe ein Proto-Sampler, da Tonbandmuster benutzt wurden, um die Klangfarben eines Orchesters zu ersetzen.
Doch davon abgesehen untergrub »Space Oddity« die allgemeine Stimmung des Sommers 1969, indem es die kollektive Begeisterung über die Mondlandung einfach übersprang und direkt zur postlunaren Tristesse überging, zur »Na und? / Und was jetzt?«-Ernüchterung derer, die immer noch auf dem Planeten Erde festsaßen, mit all seinen zunehmenden Problemen. Elf Jahre nach seinem ersten Hit erinnerte sich Bowie gegenüber dem NME: »Nun hatten wir also diesen riesigen Auftrieb durch das technische Know-how der Amerikaner, diesen Typen in den Weltraum zu schießen. Aber sobald er ankommt, ist er sich nicht mehr so sicher, warum er eigentlich dort ist. Und dort habe ich ihn dann auch gelassen.«
Der Song erzählt von einer fehlgeschlagenen Mission, weit entfernt vom technologischen Triumph, der der Menschheit eine neue Grenze geöffnet hatte. Die Melodie wandelt sich vom zweitönigen Trauergesang in den Strophen zu einem seufzenden, doch abgeklärten Refrain, der den passiven Fatalismus Major Toms herbeibeschwört, als er in seiner »tin can« umhertreibt und sich seinem Verderben beugt: »Planet Earth is blue and there’s nothing I can do.« Der Astronaut ist zwar erledigt, doch auch von der Gewöhnlichkeit seines Heimatplaneten befreit – zum Beispiel von den Reportern, die wissen wollen, was für eine T-Shirt-Marke er denn trage.
Seine Aktualität machte den Song für Bowies Plattenfirma, Mercury Records, attraktiv, die ihn im Juli veröffentlichte, dem Monat der Mondlandung. Zwei weitere Monate würde es noch dauern, bis »Space Oddity« es im Herbst schließlich in die Top 5 der UK-Charts schaffte. »Solche Verkaufstricks waren damals eine große Sache. […] Mercury nahmen ihn ganz explizit dafür unter Vertrag«, erinnert sich Dudgeon. Tony Visconti hingegen, damals Bowies Stammproduzent, hatte die Arbeit an der Single genau deswegen abgelehnt. Das Timing hielt er für einen billigen Trick, also reichte er das Projekt an den eifrigen Dudgeon weiter. Dudgeon war ein Toningenieur mit wenig Erfahrung als Produzent und konnte Noten weder lesen noch schreiben, also entwarf er ein bildliches System, um seine Ideen dem Arrangeur Paul Buckmaster zu vermitteln: eine farbkodierte Partitur, die aussah wie »eine Landkarte für Kinder, voll mit kleinen Zeichnungen und Sternen«. Bestimmte Symbole oder Linien standen dabei etwa für »einen Stylophon-Einsatz oder einen Mellotron-Part«.
In vielerlei Hinsicht glich »Space Oddity« einem Film. Es war ein kollaboratives Kunstwerk: Bowie war der Drehbuchautor und Hauptdarsteller, Dudgeon der Regisseur, Buckmaster der Kameramann und die Musiker (unter anderem Rick Wakeman, später bei Yes, am Mellotron, Schlagzeuger Terry Cox von der Folk-Rock-Band Pentangle und Herbie Flowers, der bald darauf der gefragteste Auftragsbassist der Glam-Ära werden sollte) sorgten für lebhafte Details, ähnlich wie es Kostüme und Sets im Film tun. Als Kind war ich ganz verzaubert von »Space Oddity«: die rauschenden Startgeräusche (eine kleine Hommage an die Beatles-Nummer »A Day in the Life«), das Knurren des Basses und – mein Lieblingsdetail – die Art, wie Bowie »tpeculiar« sang, indem er den letzten Laut von »most« noch vorne an »peculiar« hängte: »floating in a most peculiar way«. Das klang auch peculiar*, wie schwerelose Sprache.
Seltsamerweise schien Bowie der Erfolg der Single innerhalb kürzester Zeit peinlich zu sein. Ihr haftete das Image einer Novelty-Single an, was wiederum auf Bowie abfärbte, der deswegen jahrelang als One-Hit-Wonder galt. Das dazugehörige Album, das verwirrenderweise wie schon das Debüt einfach David Bowie hieß (aber in Amerika als Man of Words/Man of Music auf den Markt kam und später als Space Oddity wiederveröffentlicht wurde), war eine halbherzige Angelegenheit. Aufgenommen wurde es in Eile mit Visconti zurück auf seinem Posten, im Mittelpunkt steht Bowies zwölfsaitige Gitarre. Es ist wohl Bowies schlechtestes Album, zumindest bis zur Mitte der 1980er. Das Debüt ist noch charmant und verspielt, Bowies Herzblut offensichtlich, seine Freude an den Scherzen und dem Schauspiel spürbar. Das zweite Album hat nichts Vergleichbares zu bieten. Heute ist es eher von archäologischem Wert, etwas, das man nach Hinweisen auf spätere Großtaten durchforsten kann oder nach Anhaltspunkten, wie es in dieser Phase der Unentschlossenheit um Bowies Geisteszustand bestellt war.
Bowie ist hier immer noch auf der Suche nach einem verkäuflichen Selbst und greift dabei größtenteils auf blasse Kopien Anderer zurück: die Harmonica-lastige Dylan-Nachahmung »Unwashed«, rustikaler Folk nicht fern von dem, was die Faces in wenigen Jahren auf die Beine stellen würden, und fahle Donovan-eske Nichtigkeiten wie »An Occasional Dream«. »Wild Eyed Boy from Freecloud« versucht sich wohl an der sinfonischen Erhabenheit von Scott Walkers Solo-Alben (ein weiterer damaliger Favorit Bowies), gleicht aber eher den selbstgefälligen Veröffentlichungen von The Man from U.N.C.E.L.-Star David McCallum.
Zwei zutiefst faszinierende Songs gibt es auf der zweiten David Bowie dennoch: »Cygnet Committe« und »Memories of a Free Festival«. »Cygnet« erinnert an Roy Harpers Meisterwerk Stormcock (1971), wirkt aber lange nicht so vollständig realisiert und beeindruckend. Es ist eine zehnminütige, schwer verständliche Allegorie über den Niedergang des Hippie-Undergrounds. Im Oktober 1969 gab Bowie Disc & Music Echo ein Interview, in dem er darüber sprach: »Es besteht im Prinzip aus drei verschiedenen Standpunkten zu den militanteren Gruppen der Hippie-Bewegung. Die galt mal als großes Ideal, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Ich greife sie nicht wirklich an, aber mache darauf aufmerksam, dass auch die Militanten als Menschen unsere Hilfe brauchen, auch wenn sie die Dinge falsch angehen.« Der letzte Teil des Songs besteht aus einer unbarmherzigen Karikatur gegenkultureller Radical-Chic-Posen: »We […] stoned the poor on slogans«, imitiert er die Freaks, gefolgt von Beispielsprüchen, die von trendig (»Love Is All We Need«, »Kick Out the Jams«) bis zu beinahe schon faschistisch (»Kick Out Your Mother«, »We Can Force You to Be Free«) reichen. Die Lyrics sind insofern interessant, da sie ihre Zeit reflektieren und einen Einblick in die Entwicklung von Bowies Weltanschauung gewähren. Dennoch funktioniert »Cygnet Committe« nicht als Folk-Epos. »Memories of a Free Festival«, eine idealisierte Erinnerung an das Mini-Woodstock in den Beckenham Recreation Grounds, ist dagegen ein wohlgesonnener, fokussierter Abschied vom Hippietraum. Kontemporäre Schlüsselbegriffe wie »Love«, »Ecstasy« und »Satori« fallen, ehe die Coda des Songs in einen »Hey Jude«-artigen Singalong übergeht.
Im Sommer 1969 pflegte Bowie zu behaupten, dass er kein Sänger war, sondern die Leitung des Beckenham Arts Lab seine Hauptbeschäftigung sei, »etwas, das mir mehr bedeutet als alles andere«. Doch nur wenige Monate nach dem Free Festival überkamen ihn Zweifel bezüglich des gesamten gegenkulturellen Unterfangens. Im Dezember gestand er: »Dieser ganze Revolutionskram treibt mich in den Wahnsinn. […] Diese Leute sind so stumpfsinnig, so teilnahmslos. Die faulsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Sie wissen nichts mit sich anzufangen. Warten die ganze Zeit auf Leute, die ihnen zeigen, wo es lang geht. Sie tragen die Kleidung, die sie tragen sollen, und hören die Musik, die sie hören sollen.« Alternative Kultur war zur neuen Konformität geworden und war nun: ein Markt.
Ganz unabhängig davon, wie aufrichtig Bowie hinter den Werten dieser Szene stand, war er nicht der Einzige, den die Hippiekultur ernüchtert zurückließ. 1970, nach Altamont und den Manson-Morden, war der Traum einer jugendlichen Bohème für die Massen im Begriff, sich in Luft aufzulösen. Die Bewegung war in mehrere Fraktionen zersplittert. Manche blieben ihren politischen Idealen treu und versuchten weiterhin, ihr Utopia zu errichten, entweder indem sie sich vom Mainstream komplett abkapselten (in ländlichen Kommunen) oder indem sie einflussreiche und symbolische Persönlichkeiten des Establishments attackierten (wie etwa die terroristischen Aktionen von apokalyptischen Guerilla-Gruppen wie den Weathermen, der Angry Brigade oder der Roten Armee Fraktion). Die meisten distanzierten sich jedoch von der Politik der Gegenkultur, was allerdings nicht bedeutete, dass sie auch deren Haltung, Ästhetik und neugewonnenen Bräuchen abschworen, also der Musik, den Drogen und der Kleidung.
Bowie tat sich schwer damit, sich gänzlich vom Underground loszusagen, und sei es nur, weil er zu dieser Zeit noch die einzige aktive Szene darstellte. Also spielte er weiterhin auf Festivals und plapperte in Interviews die gleichen progressiven Statements über Kommerz und die Bedeutungslosigkeit von Singles nach. Ende 1969 behauptete er, sich überhaupt nicht für die Charts zu interessieren und tat »Space Oddity« – seine bis dahin größte Errungenschaft – als »letzten Endes nur einen Pop-Song« ab. 1970 sagte er dem Melody Maker, dass sein Hit »seinen Zweck erfüllt« habe. »Aber ich hoffe, es wird nicht von mir erwartet, dass ich jetzt ganz viele Songs schreibe und aufnehme, die so offensichtlich sind wie ›Space Oddity‹.«
Bowie befand sich in einer Zwickmühle: Er glaubte nicht mehr aufrichtig an den Underground, aber auch seine bisherigen Erfahrungen als Popstar ließen ihn ratlos zurück. »David würde noch bekommen, was er wollte, aber es trieb ihn in die Verzweiflung«, erinnerte sich Kenneth Pitt später. Allerdings beschreibt der Manager einen Teil von Bowies Desillusionierung auch als bewusste »Heuchelei«: sie sei der Versuch, immer noch zur Gegenkultur zu passen, sich ihrem Nonkonformismus anzupassen. »Seine abfälligen Kommentare über Singles und wie er so tat, als sei er kein Popstar und würde all die Leute verabscheuen, die von ihm ein Autogramm wollten«, sah Pitt als Resultat des irreleitenden Einflusses der Szene um das Beckenham Arts Lab. »Sie waren völlig gegen Erfolg, Hit-Singles und Popstars.«
Bowies Sinn für die Leere und Vergänglichkeit von weltlichem Erfolg wurde durch seine Auseinandersetzung mit dem tibetischen Buddhismus weiter verstärkt. Sein Interesse an asiatischer Spiritualität war tief, langlebig und älter als ihre vorübergehende Popularisierung durch Stars wie die Beatles. Ihren Anfang nahm sie, nachdem er über Beat-Autoren wie Jack Kerouac mit Zen-Konzepten in Berührung kam. Noch mehr blühte sie auf, als er Heinrich Harrers Memoiren Sieben Jahre in Tibet las. Schon in manchen seiner frühesten Interviews ist Bowies Tibet-Faszination offensichtlich. »Ich würde mir gerne freinehmen und die Kloster besuchen«, erzählte er dem Melody Maker 1966. »Die tibetischen Mönche, die Lamas, begraben sich für Wochen in Bergen und essen nur alle drei Tage etwas. […] Man sagt, sie leben für Jahrhunderte.«
Bowie meinte es ernst, wenn er über die spirituelle Armut des »westlichen Lebens« sprach. »Das Leben, das wir jetzt führen«, betrachtete er als »falsch«, doch gab er zu, dass er sich damit schwertat, diese Überzeugungen in seinen London-inspirierten Lyrics unterzubringen. In einem seiner besten frühen Songs, der Single-B-Seite »The London Boys« von 1966, wird diese Leere vielleicht angedeutet, denn sie gewährt einen Einblick in das verängstigte Innenleben eines jungen Lads im Amphetamin-getränkten Herzen der Mod-Szene.
Bowie war ein regelmäßiger Besucher von Londons Tibetan Buddhist Institute, auch bekannt als das Tibet House. Hier traf er einen Mann im Safran-Gewand namens Chime Yong Dong Rinpoche. Durch diesen neuen Guru erfuhr Bowie von Plänen, in Schottland einen Zufluchtsort für Flüchtende vor der maoistischen Unterdrückung in Tibet zu etablieren: das Johnstone House in Eskdalemuir, Dumfriesshire. Er fing an, sich an dem Projekt zu beteiligen, das bald zahlreiche Popstars auf der Suche nach einem spirituellen Erweckungserlebnis anzog – Lennon und Ono, Leonard Cohen, The Incredible String Band –, wie auch einige Schauspieler und Schauspielerinnen. Eskdalemuir ist als »Pflegeheim für ausgebrannte Hippies statt einer religiösen Einrichtung« beschrieben worden. Spirituelle Reflexion war dabei nur eine Art und Weise, seine Zeit dort zu verbringen. Die anderen waren Sex und Drogen.
Bowie jedoch nahm seine Spiritualität ernst. Er war hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, die Jagd auf Ruhm und Glanz gänzlich hinter sich zu lassen und einem erneuerten Verlangen danach, es an die Spitze des Popbiz zu schaffen. Schließlich fing er wieder an, Strategien zu entwerfen und sich mit Leuten gutzustellen, die ihm helfen könnten, sein Ziel zu erreichen.
»Ich spiele mit dem Gedanken, alles hinzuwerfen. Ich wäre gerne ein buddhistischer Mönch«, erzählte der Sänger Ende 1967 in einem Interview. In einem veröffentlichten Gespräch mit William S. Burroughs Jahre später sprach er über eine Zeit, in der er genau das tun wollte, es aber vermasselte, als er sich zwei Wochen vor seiner endgültigen Verpflichtung betrank. An anderer Stelle behauptet er, sein Guru Rinpoche habe ihm davon abgeraten, weil der Buddhismus weder seine wahre Bestimmung noch seine Herzenssehnsucht sei – im Gegensatz zur Musik. In einer weiteren, möglicherweise ausgeschmückten Variante war es Lindsay Kemp, der ihn davon abgehalten habe, sich seine schönen Locken abzurasieren.
Der Name eines Kemp-beeinflussten Pantomime-Stücks von Bowie, »Jetsun and the Eagle« (das er zwischen 1968 und 1969 aufführte, unter anderem im Vorprogramm von Tyrannosaurus Rex), kam von einem tibetischen Jogi aus dem elften Jahrhundert namens Jetsun Milarepa, dessen Schriften Teil des Kanons der Mahayana-Schule des Buddhismus waren, der Bowie angehörte. Er beruht auf der Legende, dass Milarepa ursprünglich ein schwarzer Magier war, der seine Kräfte nutzte, um sich an seiner niederträchtigen Verwandtschaft zu rächen. Schließlich entsagte er den dunklen Künsten und begab sich auf einen höheren Pfad, auf dem er Erleuchtung und Selbstbeherrschung erreichte – und übernatürliche Kräfte wie die, seine Körperform zu verändern und zu fliegen. Manche buddhistischen Vorstellungen fanden auch Eingang in frühe Bowie-Songs wie »Karma Man« und »Silly Boy Blue« vom Debütalbum. Letzterer diente auch als Hintergrundmusik für Aufführungen von »Jetsun and the Eagle« und handelt von der faszinierenden Eigenartigkeit Tibets. Der Song enthält Referenzen auf »yak-butter statues« und Konzepte wie die Wiedergeburt, die Überseele und chela, ein Wort, das »Schüler« bedeutet und gewöhnlich dem »Guru« gegenübersteht.
Wenn der musikalische Ausdruck von Bowies ernsthaftem Interesse an asiatischer Spiritualität etwas infantil wirkt, tut man gut daran, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass er 1969 gerade einmal 22 Jahre alt war. Als jugendlicher Autodidakt wurde sein Interesse von verschiedensten Ideen geweckt – Buddhismus, Nietzsche, Oscar Wildes Ästhetizismus, Warhol und einige mehr. Daraus entstand eine sich noch entwickelnde Weltanschauung, deren einzelne Teile streckenweise noch miteinander unvereinbar waren. Im Gegensatz zu vielen von uns, die als Jugendliche vorläufige Gedanken über Kunst und Leben in ihre Tagebücher kritzelten oder später für Collegemagazine Essays verfassten, die schnell in Vergessenheit gerieten (zum Glück), blieben Bowies Jugendwerke der Nachwelt erhalten: Sie wurden auf Vinyl gepresst, das bis heute im Umlauf ist, und zudem später in hohen Auflagen wiederveröffentlicht. Durch YouTube, Songtextarchive und Fan-Webzines (mit umfangreichen Interviewarchiven) sind sie außerdem jedem offen zugänglich.
Man muss Bowie zugutehalten, dass er sich nicht vormachte, den großen Durchblick zu haben. 1972 gab er zu, »beim besten Willen kein Intellektueller« zu sein: »Ich würde mich eher als einen tastenden Denker beschreiben. Ich lese die Dinge auf …« In einem früheren Porträt bestritt er die intellektuelle Kompetenz seiner kompletten Branche: »Wir sind nicht die großen Denker unserer Zeit, wie man wegen der ganzen Interviews, die wir geben müssen, meinen könnte.« Stattdessen behauptete er, dass Musiker und Kritiker von »echter Reflexion« genauso weit entfernt seien wie ihre Gegner der politischen Rechten, die Rock als degenerierten Müll betrachteten: »Wir […] sind genauso naiv und engstirnig.«
Bowies Beziehung zum Buddhismus allerdings war von Intensität geprägt: Er war wahrhaftig auf der Suche nach Antworten. Aber was genau reizte ihn so an Mahayana, der größten Schule des tibetischen Buddhismus? Mahayana besteht aus einer komplizierten Ansammlung von Prinzipien und Konzepten, steckt dabei voller Widersprüche und schlägt Uneingeweihte so vor den Kopf. Ein paar der Themen haben dennoch einen bemerkenswerten Bezug zu Bowies Karriere. »The Songs of Milarepa«, so der Titel, unter dem Milarepas Schriften bekannt sind, betont die Notwendigkeit der Abspaltung, auch vom eigenen Körper. Bowie selbst hat gesagt, dass ihn »die Idee der Vergänglichkeit« nie in Ruhe gelassen habe: das Selbst als Hirngespinst, eine trügerische Illusion, die dünnste aller Membranen beim Verdecken einer profunden Leere. Im Buddhismus ist diese innere Leere aber nichts sorgenerregendes oder nihilistisches: Das wahre Ich ist das Kein-Ich, eine positive Leere, die sich von der eingebildeten »Substanz« einer öffentlichen Persönlichkeit unterscheidet. Wirklichkeit, die Welt der Erscheinungen, ist maya – ein Wort, das »Illusion«, »Magie« und »Traum« bedeuten kann. Aber nach der Mahayana-Leere ist auch das Selbst eine »magische Show«, nichts weiter als ein Spiegeltrick.
Diese Vorstellungen – die Alltagswelt als Illusion, das wahre Selbst als unsterbliche Essenz – haben gewisse Gemeinsamkeiten mit dem Gnostizismus, den Bowie auf seiner spirituellen Suche später erkunden würde: eine antiweltliche Einstellung, die Betrachtung der sogenannten Realität entweder als dunstige Einbildung oder gescheiterte Kreation einer falschen Gottheit. Der Welt abzuschwören bedeutet, Verlangen und Leid hinter sich zu lassen und so Klarheit zu erlangen.
Sich auf die Jagd nach dem Ruhm und Glanz der Popwelt zu begeben, scheint dem zu widersprechen. Gleichzeitig passt die Idee des leeren Selbst aber auch gut zu einer Karriere, die auf konstanten Veränderungen und Verwandlungen beruht, denn sie bietet quasi eine leere Leinwand für die Persönlichkeit. Hier harmoniert der Buddhismus unerwartet mit den performativen Vorstellungen von Geschlechts- und Eigenkonstruktion, die Camp und Drag zugrunde liegen.
Mit seiner Mischung aus Mahayana und der Camp-Theatralität Lindsay Kemps entwickelte Bowie eine Psychologie des Wandels und der Wandelbarkeit. Der Titel der Bowie-Retrospektive im Victoria and Albert Museum von 2013 spiegelt das gut wider: »David Bowie Is …« In verschiedenen Bereichen der Ausstellung wurde dieser Satz dann vervollständigt. Die vielsagendste Variante: »David Bowie Is … Making Himself Up.«*
Der Bowie der 1960er war noch ein Kind seiner Zeit, und die war von Wahrheit und Wirklichkeit besessen. Dementsprechend ärgerte er sich darüber, dass sein Selbst keinen authentischen Kern hatte. Doch mehr und mehr freundete er sich mit der Idee an, dass jedes Bild und jede Person der Öffentlichkeit gefakt ist, eine Täuschung. Denn so kann man Persönlichkeiten an- und wieder ausziehen, als wären sie Kostüme. »Für mich ist es viel realistischer anzunehmen, dass all das hier (Kleidung, Haare, Gestik) ich bin, dass sich dahinter nicht mehr verbirgt«, so Bowie in einem Interview. »Alles ist an der Oberfläche und ich bevorzuge es so.«
Bowie war auf ein Problem gestoßen, das sich durch die gesamte Rockgeschichte zieht und allen Kunstformen, die sich auf Vorstellungen von Realität und Naturalismus stützen, gemein ist: Durch Wiederholungen und fortlaufende Zeit wird jede einst schockierende, »echte« künstlerische Ausdrucksform früher oder später zur Gewohnheit. In der Pop- und Rockgeschichte hat sich dieser Prozess mehrmals wiederholt: Rock ’n’ Roll, Punk, HipHop – alles wurde zu einem Code, den Außenseiter jederzeit imitieren können, eine Tradition, die ihre originelle Funktion und ihre ursprünglichen Zusammenhänge überlebt hat. Ähnlich verhält es sich mit der Schauspielkunst: Jeder Versuch, deren Glaubwürdigkeit bei der Abbildung von Wirklichkeiten auf eine neue Ebene zu bringen (etwa mit Method Acting), ist letzten Endes gekünstelt – und damit genauso unauthentisch wie die Methoden, an denen sich Schauspieler sonst orientieren.
Wenn alle Versuche, die Wahrheit in Songs oder auf der Bühne zu repräsentieren, zum Scheitern verurteilt sind, wird die Lüge zur aufrichtigeren Alternative. Sich dazu bekennen, ein Scharlatan oder Poser zu sein, ist damit authentisch. Bowie gab 1974 in einem Gespräch mit Burroughs unverhohlen zu, dass er seine Meinung oft ändere: »Ich stimme mit dem, was ich sage, meistens nicht wirklich überein. Ich bin ein schrecklicher Lügner […]. Ich werde oft mit Dingen konfrontiert, die ich mal gesagt habe […], [aber] man kann nicht sein ganzes Leben lang auf einem Punkt beharren.« Das Konzept der Integrität war bloße Einbildung. Wir alle erfinden uns im Laufe unseres Lebens immer wieder neu.
Aus diesem philosophischen und spirituellen Durcheinander entstand schließlich Bowies Gewinnstrategie: ständige Imagewechsel (was man heute »Rebranding« nennen würde). Daraus ging nicht nur ein erfolgreicher Popstar hervor, sondern die einflussreichste Figur der Rockmusik der 1970er-Jahre. Die »David Bowie Is …«-Ausstellung inspirierte einen Werbetexter und Designjournalisten namens Jude Stewart zu einem Artikel mit dem Titel »Sechs Dinge, die ich von David Bowie über Branding gelernt habe«. Darin enthalten waren Lektionen wie »Authentizität ist überbewertet«, »Begründe deine Marke auf Verben, nicht auf Nomen« (in anderen Worten: Lass dich nicht auf einen Stil oder eine Methode festnageln) und »Eine Marke vervielfacht ihren Einfluss durch den Miteinbezug von Kultur« (heißt etwa: Es ist okay, Ideen aus anderen Bereichen der Pop- und Hochkultur zu klauen.)
Diese Herangehensweise – und die Idee, mit jedem Album Sound und Image zu wechseln – ist im Pop heute so weitverbreitet (was größtenteils Bowies Verdienst ist), dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie unglaublich neu sie Anfang der 1970er war. Sowohl in Großbritannien als auch in Amerika betrachtete seriöse Rockkultur Hypes mit Argwohn und verlangte von Bands, ihren Beitrag durch jahrelanges, mühsames Touren durch das Land zu leisten. Fast jede angesehene Band dieser Zeit konzentrierte sich auf eine bestimmte Sache, an der sie dann graduell arbeitete. Man denke an die Stones, Clapton, Fleetwood Mac oder The Grateful Dead … an quasi jede. Integrität kam von Beständigkeit und Hingabe.
Eine weitere Weisheit Jude Stewarts war, dass »große Marken der Kultur den Weg weisen«. Auf Bowie traf das jedoch nur bedingt zu: Oft war er auch einfach nur schnell auf den Füßen, wenn es darum ging, das aufzugreifen, was sich gerade in obskureren Bereichen der Kultur abspielte. In seiner Anfangsphase hinkte er der Zeit sogar ein bisschen hinterher.
Zum Beispiel bei seinem dritten Album The Man Who Sold the World, das Ende 1970 in Amerika und Anfang 1971 in Großbritannien erschien. Die Musikwelt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seit ein oder zwei Jahren eine konzentrierte Rückbesinnung auf einfachen Rock ’n’ Roll unternommen. Federführend waren dabei derart große Namen wie John Lennon, Creedence Clearwater Revival und Bowies Freund Marc Bolan. The Man Who Sold the World hingegen lieferte einen Abriss von Spät-60er-Sounds à la Cream, Hendrix, Jefferson Airplane oder Jethro Tull.
Aus seiner mangelnden Begeisterung für diesen Stil machte Bowie keinen Hehl, er nannte diese Neuausrichtung sogar ganz offen eine Strategie: »Ich brauchte wohl einen Sound, der mehr heavy war, und offensichtlich hat es funktioniert. Es ist nicht so, dass ich mich dieser Musik besonders verbunden fühlen würde – das tue ich nicht. Tatsächlich halte ich sie für ziemlich primitiv.« Doch selbst als strategischer Zug hatte das Album schlechtes Timing. Der Underground war am Abbauen und rauer Rock ’n’ Roll eroberte die Spitze der Charts. Das Resultat war nicht sehr überzeugend – Bowies schrille Schreie über endlose Solos, bombastische Jam-Sessions und Taktwechsel –, auch weil er in den Prozess so wenig eingebunden war. Er gab die Verantwortung an Produzent Tony Visconti und, mehr noch, an seinen neuen Komplizen Mick Ronson ab, der nicht nur Leadgitarre spielte, sondern sich auch um die Arrangements kümmerte und de facto so etwas wie der Chefdirigent des Albums war.
The Man Who Sold the World – das zuerst Metrobolist in Anspielung auf Fritz Langs Metropolis heißen sollte – griff die Science-Fiction-Elemente von »Space Oddity« und »Memories of a Free Festival« (in dem Außerirdische von der Venus landen, mit den Hippies rumhängen und dann wieder verschwinden) auf. Hier lag Bowie auf einer Wellenlänge mit anderen Künstlern aus dem Hippie-Underground wie Jefferson Starship, dem Nebenprojekt von Jefferson Airplane, in deren Blows Against the Empire Hippies ein Raumschiff der Regierung stehlen und die Erde verlassen, um ein Paradies der »freien Seelen, freien Körper, freien Drogen, freien Musik« aufzubauen. Ähnlich auch die Cosmic-Rocker Hawkwind aus der Ladbroke Grove, deren Songs als Metaphern für einen Kampf der Freaks gegen den Faschismus aufgebaut waren. »Saviour Machine« ist der einzige Song auf The Man Who Sold the World, der sich direkt auf Science-Fiction bezieht. Er vermischt zwei Kubrick-Filme über außer Kontrolle geratene Technik, Dr. Seltsam und 2001: Odyssee im Weltraum mit dem verrückt gewordenen Supercomputer H.A.L. In Bowies Song wird ein Supercomputer, der programmiert wurde, um Krieg und Hungersnöte durch Logik und Planung auszumerzen, vor lauter Langeweile wahnsinnig und liebäugelt damit, die komplette Menschheit auszurotten, um sich selbst zu unterhalten.
Der Titeltrack wurde von Kritikern als eine Geistergeschichte oder ein unheimliches Rätsel interpretiert: Menschen, die gar nicht da sind, treffen sich im Treppenhaus. Es wird ohne Worte gesprochen. Die Zeit wird verzerrt, Identitäten ausgetauscht. Als von Science-Fiction begeisterter Teenager ließ mich das Bild vom »Mann, der die Welt verkaufte« immer an Frederik Pohls und C. M. Kornbluths Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute oder Alfred Besters Sturm aufs Universum und Tiger, Tiger! denken, die von Telepathie handelten und in denen übermächtige Firmen das Sonnensystem unter sich aufteilten. Andere nennen Robert Heinleins Der Mann, der den Mond verkaufte als möglichen Einfluss. »The Man Who Sold the World« ist jedenfalls mit Abstand der beste Song des Albums. Unter Leitung Bowies landete die schottische Sängerin Lulu 1974 mit ihrer Version einen Hit, später popularisierte Kurt Cobain die Nummer durch eine akustische Interpretation für Nirvanas MTV Unplugged.
Der zweite Lichtblick ist »The Supermen«, eine langsame Stampede von bearbeiteten Trommeln, die klingen wie Orchesterpauken und über die Bowie einen Text kreischt, der von einer untergegangenen Urrasse von Halbgöttern handelt. Hier ist weniger Science-Fiction der Einfluss als die Taschenbuchabenteuer aus dem Sword and sorcery-Genre*, zusammengewürfelt mit Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra. »Ich war immer noch in der Phase, in der ich so tat, als hätte ich Nietzsche verstanden«, gab Bowie 1976 in einem Radiointerview mit der BBC zu. »Vieles, was ich damals tat, kam davon, wie ich versuchte, Bücher zu vereinfachen, die ich gelesen hatte. […] Ich versuchte, sie so umzuschreiben, dass ich sie verstehen könnte.«
The Man Who Sold the World klingt teilweise wie die Bombast-Prog-Rocker Van Der Graaf Generator und die unwiderstehlich groteske Acid-Folk-Band Comus (die auch der Beckenham Arts-Lab-Szene angehörten) und war Bowies Versuch, als Undergroundband durchzugehen. Es stellt sich die Frage, warum eigentlich? An die alten Hippie-Ideale glaubte er schon nicht mehr und mit dem Beckenham Arts Lab hatte er auch nichts mehr zu schaffen. Der Anstoß für diesen Bruch kam von einem wichtigen neuen Einfluss in seinem Leben: Angela Barnett, genannt Angie. Angie war eine temperamentvolle Amerikanerin, die Bowie 1969 über Calvin Lee kennengelernt hatte, den Chef der PR-Abteilung von Mercury Records. Lee war ein Kind der Swinging Sixties. Später behauptete Bowie, dass sowohl er als auch Angie unabhängig voneinander etwas mit Lee gehabt hätten. Im Herbst zog Bowie mit ihr zusammen, in ein großes Haus in Beckenham namens Haddon Hall. Im März 1970 heirateten sie.
Später sagte Bowie über diese Phase, er habe noch »nach sich selbst gesucht«. Ein paar Anzeichen einer Neuausrichtung gab es aber bereits, am eindeutigsten auf dem Cover von The Man Who Sold the World, auf dem Bowie eine Kutte aus Samt trägt. Entworfen wurde sie von Michael Fish, dem Boutiquebesitzer, von dem auch das »Männerkleid« Mick Jaggers stammte. Androgyn war Bowie schon immer gewesen, doch diese neue Ebene der Drag-Provokation übertraf den gängigen Pretty boy-Look der 1960er. Die Inszenierung des Covers – in einem Kleid mit Blumenmuster und kniehohen Lederstiefeln lehnt sich Bowie auf einer Chaiselongue in klassischer »Fick mich«-Pose lässig zurück, seine langen Locken reichen bis in den Ausschnitt des Kleids – wurde von manchen als präraffaelitisch bezeichnet, andere sehen Lauren Bacall als passendes Gegenstück. So oder so: Auch wenn es bereits einige androgyn aufgehübschte Rocksänger gegeben hatte, hatte sich vorher keiner derart unverhohlen feminin in Pose gesetzt.
Ein weiterer Vorbote des Glam war die Gründung einer kurzlebigen Band mit Mick Ronson und Tony Visconti namens The Hype. Der Name wurde bewusst so gewählt, dass er sich mit der antikommerziellen Haltung des Underground beißen würde. Als weitere Provokation schmissen sich die Bandmitglieder mit Angies Hilfe in völlig übertriebene Kostüme, die ihre Bühnencharaktere repräsentieren sollten: Bowie, bekleidet mit Schalen und Lurex, war Rainbowman, Ronson war der Gangster mit Filzhut, Bassist Visconti schlüpfte in einem Supermankostüm in die Rolle des Hypeman und Schlagzeuger John Cambridge wurde zum entsprechend gekleideten Piraten.
Langsam tastete sich Bowie an den Sound und Look heran, der ihn zum Star machen sollte. Als sichere Wette galt er allerdings immer noch nicht, nicht einmal in seinem unmittelbaren Umfeld. Kurz nach den Aufnahmen zu The Man Who Sold the World, aber noch bevor das Album in Großbritannien veröffentlicht wurde, machte sich Bowies Band – Visconti, Ronson und Schlagzeuger Woody Woodmansey – daran, ein Album ohne ihn aufzunehmen. Zuerst benutzten sie den Namen Hype, bis sie ihn in Ronno – nach Gitarrist Ronson – änderten und Benny Marshall, einen alten Bekannten Ronsons aus Hull, zum Sänger machten. Im November 1970 gingen sie ins Studio, um eine LP aufzunehmen. Zwar taten sie sich mit dem Songwriting schwer, aber Anfang 1971 schafften Ronno es trotzdem, eine Single namens »Fourth Hour of My Sleep« beim Progressive-Rock-Label Vertigo zu veröffentlichen. Dieser Ausflug seiner Mitstreiter – der deren fehlende Loyalität und Weitsichtigkeit offenlegt (wenn man bedenkt, dass Bowie bald der wichtigste Rockkünstler der 1970er werden sollte) – zeigt, wie wenig man sich von dem Sänger 1970/71 zu versprechen schien.
In Amerika erregte The Man Who Sold the World etwas Aufmerksamkeit, in Großbritannien hingegen wurde das Album kaum wahrgenommen. Kurz vor seiner Veröffentlichung im März brachte Bowie ohne Unterstützung Viscontis (der nun mit Marc Bolan beschäftigt war) eine Single heraus. »Holy Holy« war eine schwache, vernachlässigbare T.-Rex-Kopie und verschwand ohne jede Spur in der Versenkung.
Im Frühling 1971 war Bowie bereits fast neun Jahre im Musikgeschäft. Von The Kon-Rads bis zu The Hype war er in ungefähr acht oder neun Bands gewesen, je nachdem wie man den Begriff definiert. Er hat vier oder fünf klar voneinander trennbare stilistische Phasen durchlaufen. Er hat drei erfolglose Alben herausgebracht und eine lange Reihe an Flop-Singles. Aus dieser Reihe tanzt nur »Space Oddity« heraus, ein Meisterwerk, das ihm einen Ruf als One-Hit-Wonder einbrachte, nicht zuletzt bei ihm selbst.
Die Vorstellung vom Blitzerfolg ist so gut wie immer ein Mythos und verdeckt Jahre harter Arbeit und Vorbereitung. Und trotzdem ist es kaum denkbar, dass es Künstler gibt, deren Erfolgsgeschichte eine derart lange Anlaufzeit hatte wie Bowies, geschweige denn solche, die, als es so weit war, derart erfolgreich waren. Warum gab er nie auf? Woher kam sein unerschütterliches Selbstvertrauen? Schlicht und einfach aus der gleichen magischen selbstmotivierenden Kraft, die Marc Bolan auch besaß.
Aber das war nicht alles. Wie Bolan hatte auch Bowie ein Talent dafür, andere von sich zu überzeugen und ihnen weiszumachen, er sei dazu bestimmt, ein Star zu werden. Darum gab es so viele Manager, Mentoren, Komplizen und Musikmogule, die an seine Talente glaubten, selbst als die Beweislage dafür ziemlich dünn war. Sein Charme und seine ungewöhnliche Attraktivität waren daran sicherlich nicht unschuldig. Seine unterschiedlichen Augenfarben (Resultat einer Kindheitsprügelei), der angedeutete Vampir in seinem Lächeln – all das gab ihm einen rätselhaften visuellen Reiz. Hätte David Bowie ausgesehen wie … nunja, Mick Ronson, einem anständig genug aussehenden britischen Burschen, hätte man ihm dann all die Zeit gegeben, in der er sich selbst finden und ein Selbst kreieren konnte, das sich auch verkaufen würde?
Doch Bowie übte diesen Reiz aus – auf Männer und Frauen, auf Homo- und Heterosexuelle. Viele seiner Helfer auf seinem langen, unbeständigen Weg nach oben waren mehr oder weniger verliebt in ihn oder auf andere Weise von seinen verborgenen Starqualtäten in den Bann gezogen. Das erinnert einmal mehr an Dorian Gray und seinen »merkwürdigen Charme«. Vielleicht hatte Wilde recht und Schönheit ist eine Art von Genie – nämlich genau das Genie, das Bowie hatte, bevor sich bei ihm auch in anderer Hinsicht Genialität nachweisen ließ.
* Übersetzt etwa als »Conn der Name, Täuschung das Spiel« – Anm. d. Ü.
* Das Wenden eines meist negativen Sachverhalts zum eigenen Vorteil – Anm. d. Ü.
** Den strategischen Einsatz der oberflächlichen Erscheinung – Anm. d. Ü.
*** Eine Londoner Marke, die sich auf Jugendmode spezialisiert hatte – Anm. d. Ü.
* Wörtlich »heißblütige Männer«, gemeint sind Machos. – Anm. d. Ü.
* Wechsel von Todernst ins Lächerliche – Anm. d. Ü.
* Im Original »gay harlequin«. – Anm. d. Ü.
* Hammer Films ist eine 1934 gegründete Filmproduktionsfirma aus London, die das Horrorgenre vor allem mit ihren Produktionen in den 1950ern maßgeblich prägte und Schauspieler wie Peter Cushing und Christopher Lee bekannt machte. – Anm. d. Ü.
* Dt.: Wachstum. – Anm. d. Ü.
** Als »Potheads« (oder kurz: »Heads«) wurden drogenaffine (in erster Linie »Pot« = Marihuana) Jugendliche bezeichnet. Die Skinhead-Subkultur war zum Zeitpunkt des Zitates noch ziemlich neu. Die spätere Vereinnahmung von Teilen der Szene durch Rechtsextremisten hatte lange noch nicht stattgefunden.
* Sonderbar – Anm. d. Ü.
* »David Bowie erfindet sich selbst« – Anm. d. Ü.
* Fantasybücher, in denen Schwertkämpfer und Magier die Hauptrollen spielen. – Anm. d. Ü.