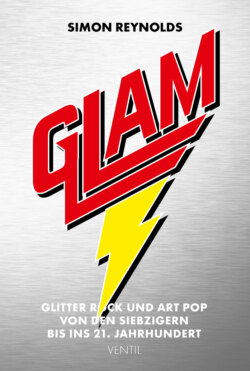Читать книгу Glam - Simon Reynolds - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BOOGIE POET: MARC BOLAN UND T. REX
ОглавлениеJohn’s Children Tyrannosaurus Rex T. Rex
Auf dem Höhepunkt von Marc Bolans Karriere brachte der Melody Maker ein Feature über das T.-Rex-Konzert im Birminghamer Odeon am 9. Juni 1972. Die Zeitschrift präsentierte Pro und Contra des Auftritts wie auch des Phänomens Bolan an sich. Für die Anti-Bolan-Fraktion schrieb Barry Fantoni, ein Comiczeichner und Jazzkritiker, der – ohne Zweifel satirisch – als »Klassik-Kritiker« des Melody Maker vorgestellt wurde. Polemisch beschrieb Fantoni seinen »Gesamteindruck, dass der Musik das vorher fast beispiellose Kunststück gelingt, immer genau gleich zu klingen, nicht nur was das Tempo, die Melodien und Harmonien angeht, sondern auch in Bezug auf Struktur, Instrumentierung und Dynamik«. Während er seine unsichtbare Fliege zurechtrückte, beichtete Fantoni, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Beethoven um dessen Taubheit beneidete.
Die Antwort pro Bolan kam von der fünfzehnjährigen Noelle Parr aus Kilsby, Northamptonshire. Obwohl ihr Text keine wirkliche Konzertbesprechung ist, sondern einfach aus einem Interview montiert war, das ein Mitarbeiter des Magazins mit ihr spontan vor Ort geführt hatte, sind ihre Gedanken vielsagender als Fantonis trockene Ironie. Denn Noelle war in der Lage, die visuellen Aspekte von T. Rex als vollkommene Pop-Erfahrung zu erfassen:
»Zunächst einmal wäre da sein struppiges Haar. Wie er es bewegt, das haut mich um. Seine Locken kleben an seiner Stirn wegen des Schweißes. Das ist so sexy.
Und dann noch die Art, wie er sich bewegt. Sein Körper kräuselt sich richtig. Es ist einfach zu gut. Es pumpt Gefühl in dich. Du kannst einfach loslassen.
Und seine Kleidung ist fantastisch. Er kleidet sich passend zu seinem Körper und seinem hübschen Gesicht. Er wird angefeindet, weil er Frauenschuhe trägt, aber er trägt einfach, was zu ihm passt. Die anderen sind ihm egal.«
Die Musik kam zuletzt, wenn nicht sogar als letztes:
»Seine Musik ist originell – unglaublich, er schreibt die meisten Songs in der Badewanne – und er bringt sie so gut rüber. Er ist mit ihr verbunden, steckt selbst in seiner Musik. Er lebt sie.«
Noelles Text endet mit einer leicht anzüglichen Anekdote. Ihre vier Freundinnen und sie nahmen pinke Damenunterwäsche als Geschenk für ihr Idol mit auf das Konzert. Auf diese stickten sie eine Nachricht für Marc und den gertenschlanken Percussionisten Mickey Finn: »von den fünf Vamporators – Suzanne, Noelle, Judith, Beverley, Adaline« – »Vamporators« war dabei eine Anspielung auf die Zeile »I’m just a vampire for your love« aus dem T.-Rex-Hit »Jeepster«.
So nüchtern und distanziert Fantonis Ansatz auch war, er war nicht gänzlich falsch. Das T.-Rex-Repertoire ist sicherlich eintönig und, wenn man so will, auch schwach. Eine Bandbreite wie die Beatles hatte Bolan nicht. Deren eigene Fanhysterie, die Beatlemania, wurde immer wieder als Vorläufer der T. Rextasy genannt und Bolan dafür gefeiert, das Teenie-Gekreische wieder auf eine Skala gebracht zu haben, wie man sie zuletzt in den frühen Jahren der Fab Four gehört hatte. Tatsächliche Klassikkritiker wie Wilfrid Mellers äußerten sich begeistert über Lennon-McCartneys pentatonisches Wasauchimmer; an einer in die Tiefe gehenden Bolanologischen Songanalyse hat sich bis heute keiner versucht.
Die T. Rextasy war kein Phänomen, das in etwas so leicht messbarem wie einem künstlerischen Erbe resultierte. Dafür war sie zu lebhaft. Was Bolan hinterließ, waren weniger seine Kompositionen oder Songs für die Ewigkeit, sondern vielmehr Performances mit Sex-Appeal. Seine Songs sind schwer zu covern (man denke nur an The Power Stations martialische Misshandlung von »Get It On«), weil sie so sehr von seiner Persönlichkeit und Präsenz abhängen.
Selbst auf dem Höhepunkt seines Erfolgs galt Bolan selten als einer der ganz Großen. Er gab zwar damit an, Großbritanniens meistverkaufter Dichter zu sein – zurecht, denn seine Fans kauften seinen Gedichtband The Warlock of Love in Massen. Doch auch wenn er sich selbst als Poeten bezeichnete, wirklich ernst nahm ihn niemand. Außer Noelle und ihresgleichen natürlich: Im Melody Maker-Artikel schwärmt sie davon, dass Marc »ein brillanter Dichter« sei, denn er »glaubt an die kleinen Leute und erinnert dich an eine andere Welt«. Sie prophezeite: »In vielen Jahren, wenn die Welt am Gipfel der Weisheit angekommen ist, wird endlich erfasst werden, was Marc Bolan geschrieben hat.«
Bolan besaß nicht wie Roxy Music ein Art-School-Empfehlungsschreiben und er hatte auch nicht den intellektuell-autodidaktischen Wissensdurst eines David Bowie. Er las eher J. R. R. Tolkien und C. S. Lewis als Burroughs oder Nietzsche. Er verwandelte sich direkt vom kultigen Hippiefreak zum Teenybop-Pin-up-Boy, ganz ohne Übergangsphase, die ihm Glaubwürdigkeit oder Respekt eingebracht hätte. Vor allem in Amerika, wo T. Rex einzig mit »Get It On« (unter dem Titel »Bang a Gong«, um Verwechslungen mit einem ähnlich betitelten Hit zu vermeiden) einen Top-10-Hit hatten, wird er eher als unbedeutende Randfigur wahrgenommen.
Doch so wenig Bolan auch als künstlerisches Schwergewicht gehandelt wurde, so sehr brillierte er als Leichtgewicht. T. Rex nahmen die Schwere aus dem Blues Rock und machten ihn geschmeidig. Zu einer Zeit, als männlicher Ausdruck von Sexualität zwischen Draufgängertum (»All Right Now« von Free) und Wikingerposen (Led Zeps »Whole Lotta Love«) schwankte, androgynisierte Bolan die Rockmusik – ohne dafür ihr Feuer und ihre Eindringlichkeit aufzugeben. Aus Cock Rock wurde koketter Rock. An die Stelle von Bombast setzten T. Rex Grooves, deren dezente Schärfe Bolan »The Slide«, »das Schlittern«, nannte. Aktive und passive Rollen drehten und wendeten sich: Bolan präsentierte sich in seinen Songs genauso oft als Beute oder Spielzeug (hatte vorher je ein Mann »take me« gestöhnt wie er in »Get It On«?) wie als Jäger. Doch selbst dann war er verspielt, etwa wenn er nach der »Vampire for love«-Routine in »Jeepster« faucht: »And I’m gonna suck you«.
Zudem mieden T. Rex Heavyness. Anders als beim tiefer gestimmten, niederdrückenden Sound von Black Sabbath und ihrer Heavy-Metal-Jünger gibt es keine Qual und keinen Kampf in Bolans Musik. Das Leichentuch, das der 1960er-Trübsinn über die Rockmusik der frühen 1970er gelegt hatte, ließen T. Rex links liegen. Am ehesten formulierten noch »Cosmic Dancer« und »Life’s a Gas« so etwas wie ein Mission Statement. Beide Songs entsprechen der »fröhlichen Wissenschaft«, die Friedrich Nietzsche im gleichnamigen Werk und in Also sprach Zarathustra formuliert hatte. Musik und Tanz waren wichtig und essentiell für Nietzsche als Ausdruck von und Signal für existenzielle Gesundheit und inneres Gleichgewicht. »Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich«, jubelt Friedrich im Zarathustra.
In einem Sinne haben die Miesmacher recht: T. Rex ist keine Musik für Erwachsene. Sie spricht das umherhüpfende Kind in uns an, das neugierig ist, große Augen macht und leicht zu beeindrucken ist. Die Grenzen zwischen Tagtraum und Realität sind noch durchlässig, Mangel und Verlust, Enttäuschung und Zerfall noch unbekannt.
»Ich bin immer noch derselbe kleine Junge«, erzählte Bolan dem Melody Maker auf dem Gipfel seines Ruhmes. »Ich glaube nicht, dass ich mich verändert habe, seit ich vier Jahre alt war. Ich war wahrscheinlich hipper, als ich geboren wurde.« Das erinnert an den modernen Mythos von Peter Pan. Marc Bolan war ein Peter Pantheist, ein moderner Heide, der erstaunt und entzückt war, wo auch immer er hinschaute. »Ich glaube, ich bin ein Kind. Alles begeistert mich«, sagte er dem Magazin Star. Und Bolan war ein Peter Pansexueller: weniger bi-neugierig, sondern das polymorphe, perverse Kind Freudianischer Legenden, den verschiedenen erotischen Möglichkeiten zugetan.
In der Praxis hatte er seine meisten Beziehungen mit Frauen, aber manche, etwa sein früher Manager Simon Napier-Bell, waren davon überzeugt, dass er »prinzipiell schwul« war. Mit Sex hielt er es wie mit seiner Kleidung: Er mochte alles, das ihn anzog, und nahm es sich, unabhängig vom Geschlecht.
Marc Bolans Persönlichkeit und Weltanschauung basierten auf vier Säulen: Androgynität, Dandytum, Magie und einer vierten, die man mit verschiedenen »F«-Worten umschreiben könnte: Fantasie, Fabulismus – das, was Tolkien als »Faerie« bezeichnete. Diese Aspekte überschneiden sich nicht immer notwendigerweise. Es ist absolut möglich, androgyn zu sein, ohne ein Interesse an Mode oder Kosmetik zu entwickeln. »Faerie« hingegen findet eine Verbindung zur Androgynität durch »feyness«*. Früher bedeutete »fey« zu sein, eine wankelmütige Aura zu haben, einer Welt von Elfen, Feen, Kobolden und anderen übernatürlichen Kreaturen zu entstammen. Und natürlich ist »fairy« auch eine gegen feminine schwule Männer gerichtete Beleidigung.
Feminine Dandys gab es seit den Anfängen des Rock ’n’ Roll, das offensichtlichste Beispiel war Little Richard. Im britischen Pop war Femininität allerdings besonders ausgeprägt. Das kam einerseits daher, dass in der Tin-Pan-Alley-Ära schwule Manager oft einen Riecher für hübsche Jungs hatten, deren unschuldige Sexualität sich gut an junge Mädchen vermarkten ließ. Aber es hatte auch etwas mit dem Art-School-System zu tun, das der britischen Rockszene die Lässigkeit der Bohème einimpfte, vor allem hinsichtlich Auftreten und Sexualität. In seinem Buch Bomb Culture erinnert sich Jeff Nuttfall 1969 an den Moment, als Art-School-Attitüden Mitte der 1960er in die Beat-Szene überschwappten: »Schuhe wurden mit Lack von Woolworth bemalt. Beide Geschlechter trugen Make-up und färbten sich die Haare. […] ›Kinky‹* war ein oft gebrauchtes Wort. Überall sah man Reißverschlüsse, Leder, Stiefel, PVC, durchsichtiges Plastik, Männer mit Make-up, tausende Andeutungen von sexuellem Anderssein.«
In der britischen Rockmusik der 1960er herrschte etwas vor, das der amerikanische Kritiker Andrew Kopkind als »keine Variante von Sexualität, sondern ein Gefühl von Ambiguität« ausmachte. Besonders stark traf das auf die Kinks zu, von Ray Davies’ Auftreten, das sich durchaus als »camp« beschreiben ließ, bis zu den versteckten sexuellen Subtexten von Songs wie »See My Friends« oder »Fancy«, die 1970 schließlich in der Transhymne »Lola« überdeutlich wurden. Darin singt Davies aus der Sicht eines nicht sehr maskulinen Mannes, von seinem Liebhaber, der wie eine Lady aussieht, aber höchstwahrscheinlich keine ist.
Am direktesten und schockierendsten war diese Ambiguität bei den Rolling Stones. Mehr noch als alle anderen Thronanwärter waren die Stones die wichtigsten Vorläufer des Glam: Brian Jones mit seiner blonden Pagenfrisur und seinen dandyhaften Unisex-Klamotten; Mick Jaggers Schmollmund und die Art, wie er auf der Bühne herumstolzierte. Jones und Jagger schauten sich Bewegungen und Gesten von Mädchen aus ihrem Umfeld ab – und in Jaggers Fall von Tina Turners hypersexueller Bühnenpräsenz.
Die Genderspielereien der Stones gingen bis an die Grenze zum Anarchischen und Grotesken. Im Promofilm für »Jumpin’ Jack Flash« ist die Band geradezu mit Make-up zugekleistert. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zur Hülle der Promo-Single »Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?«, auf der die Bandmitglieder die Stereotypen britischer Weiblichkeit porträtieren: alte Putzfrauen, die Pelz und Handschuhe tragen, aufreizend gekleidete Militärfrauen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Gleichzeitig verdeutlicht diese boshafte Parodie – die Visualisierung eines ihrer hämischsten Anti-Lovesongs –, wie das Gender-Chaos der Band neben gleichgültiger Frauenfeindlichkeit koexistierte. Ihre Androgynie war oberflächlich. Unter der kosmetisch verschönerten Haut und dem Dandyschmuck schlugen kalte Herzen, die sich die Härte von Blueskünstlern wie Muddy Waters oder Howlin’ Wolf einverleibt hatten.
Wenn männliche Popstars die femininen Hoheitsgebiete Schmuck und Mode für sich vereinnahmten, war das also nicht per se ein Zeichen für eine respektvolle Haltung gegenüber Frauen. Es war eine Erweiterung ihrer Selbstgefälligkeit, ein neues Herrschaftsgebiet für das männliche Ego.
»[Bolan] hatte das größte Ego eines Rockstars überhaupt. In seiner eigenen Vorstellung war niemand großartiger als Marc Bolan.« Das behauptete Mark Volman, der – zusammen mit seinem ehemaligen Turtles-Bandkollegen Howard Kaylan – die Falsett-Backgound-Vocals auf den Hit-Singles von T. Rex einsang, die die Anzüglichkeit der Songs noch weiter steigerten. Laut John Gaydon von der Management-Firma E. G. – der ebenfalls zu einer Zeit mit Bolan zusammenarbeitete, die für den Aufstieg seiner Band ausschlaggebend war – schaute der Sänger, wenn er bei Top of the Pops war, »immer hoch auf den Bildschirm, um zu überprüfen, wie er aussah«. Wie Volman betont auch Gaydon, wie lieb, herzlich und großzügig Marc war (»er war ein reizender Mann«), doch gibt er auch zu, dass seine Eitelkeit fester Bestandteil seiner Persönlichkeit war. Er fügt hinzu: »Ich habe Popsänger immer mit Huren verglichen. Sie verkaufen Teile von sich selbst und müssen immer gut genug aussehen, um gekauft zu werden.«
Wenn das Dandytum einem die Möglichkeit bietet, sich zur Schau zu stellen wie ein Pfau, dann ist die Selbstmythologisierung eine andere Art, »das Ego zu kostümieren«. Die tatsächlichen Fakten sind geistlos und langweilig? Schmück sie aus! Bolan reichte es nicht, toll auszusehen, also wurde er zum Märchenerzähler. Gleich zu Beginn seiner Karriere – ja, eigentlich schon vorher – erzählte er Lügengeschichten. Journalisten gab er extrem aufgeblasene Schilderungen tatsächlicher Ereignisse und er kündigte zukünftige Projekte an, die nie umgesetzt wurden und in den meisten Fällen nie über den Status träger Fantasien hinauswuchsen: einen TV-Cartoon, basierend auf seiner Person und geschrieben von ihm selbst; Drehbücher für »drei europäische Filme […], eines davon für Fellini«; mehrere Science-Fiction-Romane, die angeblich kurz vor ihrer Veröffentlichung stehen würden. Er behauptete, »genug für eine Ausstellung« gemalt und »fünf Bücher fertiggeschrieben« zu haben, die »schon lange in meiner Schublade liegen«. Selbst als es mit seiner Karriere bergab ging, fantasierte er Pläne für eine »neue audiovisuelle Kunstform« herbei. Musikjournalisten hingen an jedem Wort, weil sich Bolans Geschichten gut lasen. Keith Altham – selbst in der PR-Branche tätig – verglich ihn mit Walter Mitty: »Er wusste, dass die Leute immer etwas wollten, das größer war als das Leben, also übertrieb er immer. Und manchmal fing er an, sich selbst zu glauben.«
Bolan entstammte einfachen Verhältnissen: Sein Vater war Lastwagenfahrer, seine Mutter Inhaberin einer Marktbude. Er flüchtete vor diesem Leben im Londoner East End durch Illusionen und Erfindungen. Zuallererst erfand er sich selbst. »Ich bin meine eigene Fantasie«, sagte er dem Magazin Petticoat. Wie im Showbiz üblich änderte er seinen Nachnamen: Aus dem jüdischen Feld wurde Bolan. Der Name gefiel ihm, weil er französisch aussah und man ihm gesagt hatte, er habe angeblich französische Vorfahren. Seltsamerweise schrieb er ihn aber ursprünglich mit einem nicht gerade typisch französischen Umlaut: Bölan.
Eine seiner außergewöhnlichsten Fiktionen dachte sich Bolan für seinen eigenen Entstehungsmythos aus: Er behauptete, er habe lange mit einem Zauberer in Frankreich zusammengelebt, was eine lebensveränderne Erfahrung gewesen sei, während der er in Kontakt mit verschiedenen Formen der Magie und der esoterischen Weisheit gekommen wäre. Die Details dieser Geschichte veränderten sich jedes Mal, wenn er sie erzählte. Manchmal war er ein Jahr dort, manchmal waren es fünf Monate oder achtzehn. Manchmal lebten er und der Zauberer in einem Wald, unter oder sogar auf einem Baum. Ein anderes Mal besaß der Zauberer ein Schloss mit vierzig Räumen im Rive Gauche von Paris. In einer Version war er der Chauffeur des Zauberers – obwohl er nie Autofahren gelernt hatte.
Auch die Form der Magie variierte. Manchmal sprach Bolan von weißer Magie, dann beschrieb er sie wieder als die schauerlichste und unheilvollste schwarze Magie, die man sich vorstellen könne. In einem Interview mit dem Evening Standard wollte er dem Reporter weismachen, dass sie lebendige Katzen gekreuzigt und Menschenfleisch verspeist hätten wie Hühnerknochen, »aus einem großen Kessel«. Als ob ihm aufgefallen wäre, wie sehr er die Gutgläubigkeit seines Interviewers auf die Probe stellte, fügte er hinzu: »Es ist mir egal, ob sie das glauben oder nicht. Es ist unheimlich, so falsch es auch klingen mag.« Dann wieder sprach er davon, Levitationen miterlebt zu haben. Und davon, dass er gelernt habe, Geister und Dämonen zu beschwören und sich unsichtbar zu machen. Außerdem habe er herausgefunden, dass sein Talent als Dichter von einem früheren Leben als Barde herrühren würde. Bolan erzählte auch, ein »Ritual für Pan« ausgearbeitet zu haben, um sich selbst in einen Satyr zu verwandeln, doch habe er dann den Mut verloren, den Fluch auch tatsächlich auszusprechen. Denn wie hätte sein Leben dann ausgesehen? Hätte man ihn in einen Zoo gesteckt? Ihn in einem Krankenhaus seziert?
Diese Geschichten bildeten Bolans eigene Version der Legende von Robert Johnson, der seine Seele für unwiderstehliche Fähigkeiten als Bluesmusiker an den Teufel verkauft haben soll. Sie inspirierten seinen ersten Hit »The Wizard« (1965), der 1970 auf dem ersten T.-Rex-Album in Form eines wilden, beschwörenden Epos wieder aufgegriffen werden sollte. Die Wahrheit hinter der Legende hätte banaler kaum sein können: »Wizard« war Bolans Spitzname für den befreundeten Schauspieler Riggs O’Hara, mit dem er mal für ein Wochenende Paris besucht hatte. Simon Napier-Bell, der Bolan Mitte der 1960er managte, besteht allerdings darauf, dass der Zauberer eine echte Person gewesen sei, ein Hexenmeister, den Bolan in einem Schwulenclub getroffen und mit dem er eine kurze Affäre gehabt habe. »Marc fiel es sehr schwer, kalkulierten Bullshit und Wirklichkeit auseinanderzuhalten«, sagt Napier-Bell. »Er mochte es, in einer mystischen Wolke zu leben, aber er wusste auch, dass diese mystische Wolke ein gutes Bild abgab.«
Das Konzept von Magie – und seine Selbstdarstellung als magisches Wesen – war ein ganz wesentlicher Bestandteil von Bolans Werk. Wörter wie »Magie« und »Fluch« tauchen in seinen Interviews und gelegentlich in seinen Lyrics immer wieder auf. Bolan argumentierte einmal, dass »eine erfolgreiche Rock-’n’-Roll-Platte ein magischer Fluch« sei. Gegenüber dem NME verkündete er 1972: »So etwas wie einen Popstar gibt es gar nicht. Er existiert nicht. Aber wenn man eine Platte aufnimmt, überkommt einen eine gewisse Magie aus den Sphären.« Besonders faszinierend an dieser Bemerkung ist ihre Zweideutigkeit, die sich zwischen entmystifizierenden und mystischen Polen bewegt: Einerseits durchschaut Bolan den Pop-Prozess, doch gleichzeitig lässt er sich von Mystik und Mythen verführen. Seine Aussage legt nahe, Glamour sei selbst ein Trick, auf den wir alle bereitwillig hereinfallen, ein Streich, den wir uns selbst spielen.
Glamour ist ein Konzept, das Bolans Lieblingsschriftsteller Tolkien nutzte, wenn er über Legenden, Sagen und Märchen schrieb. Die veraltete ursprüngliche Bedeutung des Wortes bezog sich speziell auf visuelle Illusionen, also Flüche, die das Auge verzaubern und täuschen. Oder, wie in Webster’s Dictionary zu lesen ist: »Eine Art Nebel in der Luft, der die Dinge anders aussehen lässt, als sie wirklich sind«. Popularisiert wurde das Wort von Sir Walter Scott, der es in verschiedenen Texten verwendet hatte, etwa in seinem Traktat Letters on Demonology and Witchcraft von 1830: »Diese Art von Hexerei kennt man in Schottland als den Glamour, oder deceptio visus, und sie galt als eine spezielle Fähigkeit der Zigeuner.«
Zwischen Glamour und Wortzauber besteht eine etymologische Verbindung: »Glamour« soll mit dem Wort »gramarye« verwandt sein, vielleicht sogar davon abstammen. »Gramarye« bezeichnet okkultes Wissen – Bücher, in denen man Flüche findet. Bolan sah sich selbst immer genauso sehr als Dichter wie als Musiker, ein »Weilder of Words«, wie er einen seiner Tyrannosaurus-Rex-Songs nannte (und fehlbuchstabierte)*. Die Lyrics, die er für Tyrannosaurus Rex und, in geringerem Maße, T. Rex schrieb, ähneln oft Flüchen und magischen Sprüchen, wie sie Daniel Lawrence O’Keefe in seiner Magie-Studie Stolen Lightning beschreibt: voll von »altertümlichen Ausdrücken, Neologismen und Silben, die keinen Sinn ergeben, […] Wiederholungen, Alliterationen und Stilfiguren«, vorgetragen mit »einem sonderbaren Ton in der Stimme«, im Singsang, heulend oder nuschelnd.
Gegenüber dem Evening Standard verteidigte Bolan seine Geschichten von katzenmordenden, menschenverspeisenden Magiern: »Es klingt ego, aber es ist wahr!« Die Formulierung ist sonderbar – »ego« als amorphes Adjektiv, vielleicht als Abkürzung für egozentrisch oder egomanisch. Umso aufschlussreichender die Aussage: Magie und Narzissmus hängen eng miteinander zusammen, die Vorstellung von außergewöhnlichen Kräften, ob angeboren oder später durch Bestimmung erlangt, geht Hand in Hand mit einem Überlegenheitskomplex. »Ich habe schon immer gewusst, dass ich anders bin, gleich von meiner Geburt an«, sagte Bolan 1971 dem Melody Maker. Im folgenden Jahr verkündete er: »Als ich jünger war, war ich davon überzeugt, dass ich ein überlegenes Lebewesen wäre. Anderen Menschen fühlte ich mich überhaupt nicht verbunden.«
Kinderbücher und Jugendliteratur basieren oft darauf, dass sich Leser mit den Helden identifizieren, die anders sind, etwa weil sie einzigartige Fähigkeiten haben, die ihnen zugleich zu Segen und Fluch geraten. Man denke nur an die Harry-Potter-Bücher oder, auf andere Weise, die schweren Missionen, die Bilbo und Frodo in Der Hobbit und Der Herr der Ringe bestehen müssen. Jugendliche und Pre-Teens spricht das aus offensichtlichen Gründen an: Im Angesicht einer Welt, in der man sich unbedeutend und machtlos fühlt, können sie sich durch diese Helden besonders fühlen, während sich ihre eigenen Egos noch in einer zerbrechlichen Aufbauphase befinden. Die Verkaufszahlen von Fantasybüchern und -filmen belegen allerdings, dass manch einer diesen Wunschträumen nie entwächst.
Magie und Selbstherrlichkeit gehören zusammen. Aleister Crowleys Diktum »tue was du willst, soll sein das ganze Gesetz« thront über der egozentrischen Weltanschauung des aufsässigen Kindes. In Stolen Lightning behauptet O’Keefe sogar, magisches Denken spiele eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Egos selbst. Zwar spiegelt sich das neu entstehende Ego zuerst in Bezugspersonen wie Familienmitgliedern, doch setzt sich dieser Prozess später fort, indem das Selbst sich auch in nicht unmittelbarer Umgebung Projektionsflächen sucht, die es dann wiedergibt. »Das Ego muss sich, ›magisch‹, aus anderen Dingen erschaffen« – Helden, Einflüssen, popkulturellen Ikonen und so weiter. »Für sein ganzes Leben sammelt das Ego Gegenstände. Es saugt sie auf wie ein schwarzes Loch.« Dieses gefräßige Selbst neigt dazu, Identifikationsgegenstände zu idealisieren, von der Verehrung von politischen Figuren bis hin zur fanatischen Besessenheit mit Pophelden. Dieser Persönlichkeitskult kann zu einem Schauplatz von Fantasien und Wunschdenken werden, der mehr als nur einen Hauch von Magie in sich trägt.
1975 beschrieb Bolan – inzwischen in seinen späten Zwanzigern, also eigentlich längst der Adoleszenz entwachsen – sein eigenes Wesen als formbar und leicht zu beeindrucken: »Ich bin nicht vierundzwanzig Stunden lang dieselbe Person, ich verändere mich andauernd. Das ist wie wenn ein Kind einen Cowboyfilm sieht und dann, wenn es aus dem Kino kommt, so tut, als würde es um sich schießen, weil es jetzt ein Cowboy ist.« Aussagen seiner Angehörigen bestätigen das. So spricht Bolans Bruder Harry davon, wie Marc als filmbegeistertes Kind die Charaktere von Filmhelden als eine Form von Selbstschutz annahm. Seine Frau June bezeichnete ihn als »wundervollen, wundervollen Schwamm«.
In Bezug auf seinen Song »Mirror Freak« bezeichnete Steve Harley, der Cockney-Rebel-Frontmann, Bolan als den »originalen ›Mirror Freak‹«. David Bowie – wie Harley ein Freund Bolans, aber auch ein Rivale – beobachtete, dass Marc »so unglaublich stark auf sein Aussehen bedacht ist […], er ist wirklich in seinem eigenen Image versunken«. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, mag man sich da denken. Nichtsdestotrotz: Bolans Freude an seinem eigenen Image und Bild – das zuerst nur in Spiegeln und Schaufenstern reflektiert wurde, später auch im audiovisuellen Spiegel seines Publikums – führt uns zur Essenz des Glam.
1956 begab sich Bolan zum ersten Mal auf die Pfade des Pop: Zu seinem neunten Geburtstag bekam er eine Akustikgitarre geschenkt, aber statt zu lernen, sie zu spielen, hat er »sie nur benutzt, um damit vor dem Spiegel herumzuwackeln« und dabei Elvis’ schlüpfrigen Hüftschwung zu imitieren. »Sobald die ersten Rock-’n’-Roll-Acts auf den Plan traten, haben das alle getan«, sagt Napier-Bell über die ersten britischen Nachahmer von amerikanischen Rockern. »Sie übten vorm Spiegel. Nicht unbedingt aus Narzissmus, aber um das Bild auch richtig hinzukriegen. Der Spiegel war der Vorreiter der Fernsehkamera.«
Ein paar Jahre später stieß Bolan in einer Stadtbücherei auf ein Buch, das ihn nachhaltig prägen sollte: eine Biografie über Beau Brummell, einen Dandy der Regency-Ära, dessen penibles Augenmerk für Körperpflege und Kleidung Anfang des 19. Jahrhunderts die englische Aristokratie begeisterte, was ihm eine inoffizielle, aber einflussreiche Stelle als »Berater für Eleganz« des Prinzregenten einbrachte. Als er in dessen Gunst gefallen war und hohe Schulden angesammelt hatte, war er gezwungen, nach Calais umzusiedeln, wo er mit der Hilfe einiger loyaler Freunde eine Parodie seines alten Lebensstils auslebte. In Jules Barbey d’Aurevillys Über das Dandytum und Beau Brummell von 1845 ist die Rede davon, wie der in Ungnade gefallene und zunehmend desillusionierte Exilant imaginäre Dinnerpartys veranstaltete, bei denen er die Ankunft von angesehenen, aber nicht wirklich anwesenden Adligen mit einem Trompetenstoß verkündete.
D’Aurevillys Buch – das Brummell zelebrierte und dessen Eitelkeit, Extravaganz und Frivolität verteidigte – übte starken Einfluss auf Baudelaire und später die französische Dekadenz aus, die sich einer Nostalgie für das nun verblassende Zeitalter der Aristokratie hingab. Baudelaire schrieb, das Dandytum sei so etwas »wie ein Sonnenuntergang«, ein »letzter Funke des Heldentums«. Andere Literaten des 19. Jahrhunderts lehnten das Dandytum ab. Thomas Carlyle dachte an Brummell und seinesgleichen, als er seine Satire Sartor Resartus (1836) schrieb. Carlyle definiert den Dandy als »Mann der Garderobe«, der sich »mit jedem Teil seiner Seele« dem »weisen und gekonnten Tragen von Kleidung« widmet: »So wie Andere sich kleiden, um zu leben, lebt er, um sich zu kleiden.« Für den Dandy dreht sich alles um »den Blick deiner Augen«. Carlyle entdeckt dahinter einen quasi-religiösen Impuls: die »Konfession der Dandys« ist ein an die Gegenwart angepasster Ausbruch »dieses urzeitlichen Aberglaubens der Selbstverehrung«.
Von Brummell über Baudelaire und Oscar Wilde bis zu Brian Jones ist das Dandytum eine immer wieder unterbrochene Revolte gegen ein »sehr hässliches und vernünftiges Zeitalter« – so Wildes Urteil über die graue Welt der industriellen Revolution und das protestantische Arbeitsethos. Die Polarisierung dieser Gegensätze ist allerdings noch älter und reicht mindestens bis in die Zeit der Roundheads und Cavaliers* zurück. Nachdem Cromwells New Model Army** die royalistischen Edelmänner besiegt hatte, die Charles I. verteidigten, schafften die Puritaner nicht nur die Monarchie ab, sondern schlossen auch die Theater und schränkten gottlose Unterhaltungen wie Tänze ein. Doch die alte Pracht kam 1660 zurück, als mit Charles II., dem Erben des exekutierten Königs, auch die Frivolität wieder das Ruder übernahm. (Die Geliebte des neuen Königs war passenderweise Schauspielerin.) In seiner Essenz ist das Dandytum royalistisch, weil der Dandy durch Ästhetik eine Form von Royalität anstrebt. Die Dandys herrschten über ein kaltes Reich des stilisierten Benehmens: Das soziale Leben selbst wurde zum Theater. Aristokraten, die das protestantische Arbeitsethos verabscheuten, mieden die unedle Welt von Produktion und Profit. Stattdessen widmeten sie ihre Zeit sich ständig verändernden Kodexen und Zeremonien, in denen sie hochmütig Wohlstand und Energie verprassten, um ihren Konsum möglichst auffällig zur Schau zu stellen.
Bolan wuchs im Großbritannien der Nachkriegszeit auf. Die Rationierungen hatten gerade erst ein Ende genommen und es gab noch zahlreiche Trümmer von den Bombardierungen des Krieges. Zusätzlich war das East End ein trostloser Ort, rußbeschmutzt von den Abfallprodukten der Industrie. Umso begeisterter muss der junge Bolan von der Vision gewesen sein, die ihm auf den Seiten der Brummell-Biografie begegnete: ein Leben, das nur von Eleganz und Extravaganz diktiert wird. In Interviews sprach er oft über seine Herkunft aus der Arbeiterklasse und über seine »so armen« Eltern. Er schwärmte davon, wie Ruhm und Wohlstand ihn vor einer »Verurteilung zu lebenslanger Arbeit in einer Fabrik« bewahrt hätten.
Aus Brummells Lebensgeschichte leitete Bolan für sich das Konzept der Selbsterfindung ab. »Als Kind war meine einzige Philosophie, dass ein Mensch eine Kunstform ist«, erzählte er dem Petticoat-Magazin. Das erklärt auch, wie es zu dem Widerspruch zwischen Bolans regelmäßigen Erwähnungen seiner Wurzeln in der Arbeiterklasse und seinem vornehmen Akzent kam. Irgendwann Mitte der 1960er gewöhnte er sich seinen Cockney-Dialekt ab und begann so zu sprechen, wie man es aus seinen Fernseh- und Radioauftritten kennt: sanft im Ausdruck, ähnlich der Aussprache eines Theaterschauspielers. Solche bewussten Veränderungen des Sprachstils waren damals Gang und Gäbe im Showbiz. Radio- und Fernsehstar Frank Muir, der sprach, als gehöre er zur Oberschicht, überraschte die Leute gerne, indem er darauf hinwies, dass er »in E10 auf die Schule« ging, »nicht in Eton«.*
Bolan selbst wuchs in einem angrenzenden Stadtteil in Ost-London auf – Postleitzahl E5. Hier – in der Gegend um Hackney und Stamford – fand er auch seine eigene Dandy-Parallelgesellschaft: die Mods. Baudelaire hat darüber geschrieben, wie beunruhigte Männer in Übergangsperioden »eine neue Art von Aristokratie« hervorbringen. Auf die Mods trifft das uneingeschränkt zu. Mods waren junge Männer, die fast immer der höheren Arbeiterklasse oder der unteren Mittelschicht entstammten und denen die Türen der Universitäten genauso verschlossen blieben wie ein sozialer Aufstieg, doch die auch für ein Leben als Arbeiter ungeeignet waren. Intellektuell waren sie durchaus wissensdurstig, doch eher als Autodidakten denn als Akademiker (tatsächlich verabscheuten Mods Studenten). So konstruierten sie ihre eigene Hierarchie, die auf Geschmack und Wissen basierte. Ihr Wertesystem existierte unabhängig von den vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen. Durch die Mod-Subkultur konnten diese hungrigen, jungen Männer eine aristokratische Existenz ausleben, die sich ausschließlich an Kleidung orientierte und an Aktivitäten, bei denen diese vorteilhaft zur Schau gestellt werden konnte (wie Tanzen oder Mopedfahren).
Bolan fing den Spirit der Mods 1977 mit »The London Boys« ein. In den Lyrics blickt er auf eine Gang protziger Jungs zurück, mit der er als junger Teenager verkehrte: »Mighty mean mod king / Dressed like fame.« 1972 erzählte er dem NME: »Damals hab ich mir eine Welt erschaffen, in der ich der König meines Viertels war.« Mit gerade mal vierzehn hing er mit Jungs rum, »die zwanzig oder vierundzwanzig« und »im ganzen East End bekannt waren. […] Das war allerdings eine Illusion, die ich kreiert habe.« In einem anderen Interview erinnerte er sich daran, von seinem eigenen Image »komplett umgehauen« worden zu sein, »von der Vorstellung eines Mark Feld«.
Wie den ersten Dandys ging es auch den Mods um eine streng gehütete Fassade eisiger Unempfindlichkeit. Der Reiz war »die Freude daran, andere in Erstaunen zu versetzen und die stolze Zufriedenheit darüber, selbst niemals erstaunt zu sein« (Baudelaire). Nik Cohn erinnert sich daran, wie Marc als Mod »seine Klamotten vielleicht vier Mal am Tag« wechselte. »Er war sehr auf sein Image fokussiert, arrogant und gefühlskalt. Er nickte Leuten, die nicht hip waren, nicht mal zu.« Seine Obsession mit der eigenen Coolness trieb der junge Marc bis ins Extrem. Jahre später gab er zu: »Ich hatte vierzig Anzüge, aber keine Freunde.«
Der vierzehnjährige Mark Feld war wohlbekannt. 1962 berichtete Town über die Mod-Szene und widmete ihm einen Großteil der Story. Seine Versuche, damit zu prahlen, wie ungezügelt er sein Geld ausgäbe, waren unglaubwürdig: »Ich habe zehn Anzüge, acht Sportjacken, 15 Hosen, 30 bis 35 gute Hemden, ungefähr 20 Pullover, drei Lederjacken, zwei Wildlederjacken, fünf oder sechs Paar Schuhe und dreißig unglaublich gute Krawatten.« Er behauptete, die besten Schneider im East End zu kennen und dass er ihnen detaillierte Anweisungen für das Revers, die Taschen und alle neuesten Mod-Trends geben würde. Sogar seine Schuhe waren handgefertigt. Wie um alles in der Welt konnte er sich das leisten? Angeblich durch Kleinkriminalität. Jedenfalls behauptete er später, er habe dafür Motorräder gestohlen. »Ich war ein ganz schöner Bösewicht. […] Klamotten waren alles, was mir etwas bedeutete.«
Auf dem Foto für den Town-Artikel starren Bolan und die anderen beiden, viel älteren Mods überheblich und ernst in ihren glänzenden Schuhen, Dreiteilern und Krawatten in die Kamera, als Hintergrund dienten die heruntergekommenen Straßen Stamford Hills. Sie sehen aus wie eine Junior-Version von East-End-Gangstern wie den Kray-Zwillingen. Als sie über Politik befragt wurden, gaben alle drei ihrer Unterstützung für die konservative Regierung Ausdruck: »Die sind für die Reichen, also bin ich für sie.« Cyril Connolly argumentierte, Dandys seien grundsätzlich kapitalistisch, alleine schon wegen ihrer Vorliebe für »schöne Dinge und ansehnliche Menschen«. Da sie »den Ruf für soziale Gerechtigkeit nicht hören«, zelebrieren Dandys »die Dinge, wie sie sind«, statt zu versuchen »sie zu verändern«. Auch die Mods waren nicht nur für ungebremsten Materialismus, sondern auch gegen Gleichheit. »Man muss sich von den anderen Kids abheben«, so Bolan gegenüber Town. »Ich meine, man muss ihnen zwei Schritte voraus sein. Das Zeug, in dem man die Hälfte der Versager hier sieht, hab ich schon vor Jahren getragen.«
In mancher Hinsicht waren Mods feminin – manche trugen sogar Makeup –, ohne jedoch wirklich in Berührung mit ihrer weiblichen Seite zu kommen oder Frauen viel Zeit zu widmen. Bolans »The London Boys« fängt die männliche Dominanz der Bewegung ein, in der Jungs sich schick machten, um andere Jungs zu beeindrucken und nicht um Mädchen anzuziehen. Modettes waren Nebenfiguren ohne Gesichter. Die männlichen Mods »waren schlicht nicht interessiert […], zu selbstsüchtig«, schreibt der Mod-Experte Kevin Pearce. Pillen spielten dabei eine Rolle, da sie die Libido (sowie andere biologische Bedürfnisse wie Nahrung und Schlaf) unterdrückten und stattdessen Selbstbewusstsein und Gruppenzugehörigkeitsgefühle förderten.
Bolans Herrschaft als König der Mods fand ein Ende, als seine Eltern Ende 1962 ans andere Ende der Stadt in eine nicht weniger trostlose Gegend Südwest-Londons namens Summerstown zogen. Ohne Anhänger ging ihm seine Stellung verloren und so zog er sich in sich selbst zurück.
In dieser Phase einer, wie er es später nannte, »spirituellen Krise« ersetzte Bolan Kleidung durch Bücher. Er verschlang die Dichter der britischen Romantik, machte mit Rimbaud weiter (»der erste Dichter, der mich richtig mitriss; wenn ich Rimbaud las, fühlte sich das an, als stünden meine Füße in Flammen«) und landete schließlich bei den amerikanischen Beats. Als er Musik als Rettungsweg entdeckte, wurde Dylan sein Vorbild: ein Poet mit Akustikgitarre. Seinen ersten Versuch im Musikbusiness startete er als Folksänger mit Schirmmütze und dem Namen Toby Tyler. Die Stelle als »britischer Dylan« hatte allerdings schon Donovan.
Zu dieser Zeit entwickelte Bolan seine zweite künstliche Stimme, nicht den vornehmen Akzent, sondern die sehr hohe Gesangsart: ein geträllertes Jammern mit übertriebenem Vibrato. Bolan hat einmal behauptet, er habe sich diesen Stil angeeignet, indem er Platten des schwarzen US-Crooners Billy Eckstine mit 45 statt 33 rpm abgespielt hätte. Laut Simon Napier-Bell war es in Wirklichkeit Bessie Smith: »Spiel ihre Alben mit 45 rpm und du hörst Marc Bolan.« Wenn das stimmt, ist Bolans Stimme nicht nur das Produkt technologisch realisierter Künstlichkeit, sondern auch das von Transgendering – wenn er auch höher klingt als sein weibliches Vorbild.
Als Bolan Napier-Bell besuchte, war der junge Manager von Bolans seltsamen Gesangsstil begeistert und fasziniert von seinen ungewöhnlichen Songs. Doch noch mehr vereinnahmte ihn dessen Auftreten, etwa der schlaue Einfall, seine kleine Körpergröße auszunutzen, indem er sich mit übereinandergeschlagenen Beinen in den größten Sessel setzte und so den Effekt »eines Weisen aus einem Dickens-Roman« kreierte. Wenn man etwa fünfzehn Jahre als ist, so Napier-Bell, »hat man normalerweise herausgefunden, wie man das Beste aus sich herausholt. Und Marc hatte das mit seinem Image getan. Es war sehr ausgeklügelt.«
Im Pop, darauf besteht Napier-Bell, ist »das Bild wichtiger als die Musik«. Man kann »den Sound verfälschen«, mit Songs, die jemand anderes geschrieben hat, die von Session-Musikern eingespielt und von einem Produzenten in Form gebracht wurden. Visuelle Reize, so Napier-Bell, können von anderen profitieren, nicht aber dort entstehen, wo sie davor nicht schon existiert haben. Das gewisse Etwas – Präsenz, Charisma, Anziehungskraft –, aus dem Stars ihr Image schnitzen, setzt sich aus dem zusammen, was sie bereits haben. Letzten Endes muss der Prozess der Selbstmanufaktur beim Künstler beginnen. »Wenn du einfach zu jemandem sagst ›Ich will, dass du so eine Stimme hast und dich so anziehst‹ und diese Person dann zu einem Gesangslehrer schickst, kommt nur Müll dabei raus«, sagt Napier-Bell. »Echte Images kommen von echten, ungewöhnlichen Leuten.« Oberflächlich betrachtet ist das eine seltsame Definition von Popstar-Authentizität: Der »wahre« Fake kontrolliert die Maske, die sie oder er trägt. Doch auf Figuren wie Bolan und seinen Freund Bowie trifft sie zu. Beide erfanden erst eine Reihe von Alter Egos, bevor sie eins fanden, das bei der Masse ankam.
Der Unterschied, den Napier-Bell zwischen Manufaktur und Selbstmanufaktur macht, weist auf eine Spannung hin, die sich durch die Popgeschichte zieht. Auf der einen Seite gibt es die Tradition der zusammengestellten Gruppe: Die Bewegungen sind choreografiert, die Mitglieder durchgestylt und in manchen Fällen an Showbiz-Internaten geschult worden, ähnlich dem Studio-System Hollywoods. Auf der anderen Seite findet man die Tradition von Popgruppen und -künstlern, die als unabhängige künstlerische Einheiten funktionieren, ihr eigenes Image genauso kontrollieren wie die Art und Weise, wie es verpackt und präsentiert wird und die auch die musikalische Ausrichtung selbst bestimmen.
In den 1960ern übernahmen in Großbritannien die künstlerisch unabhängigen Gruppen das Feld: Bands aus der Mittelschicht, die Ideen aus dem Umfeld der Art Schools nicht mehr abgeneigt waren und kein Interesse daran hatten, neu geformt oder umbenannt zu werden, wie es noch bei den ersten britischen Rock ’n’ Rollern der Fall war. Napier-Bell hatte seine Finger bei beiden Lagern im Spiel. Zuvor hatte er die Yardbirds gemanagt, eine wichtige Gruppe für den Übergang vom schrillen Pop zum um Seriosität bemühten Rock. John’s Children hingegen – sein anderer Hauptact – waren eine Mischung aus chaotischem Charisma und bewusst manufaktierter Provokation.
Wie viele Gruppen Anfang der 1960er spielten John’s Children auf ihren frühen Singles – »Smashed Blocked« und »Just What You Want – Just What You Get« – nicht einmal selbst. Dafür waren sie nicht gut genug. Die Aufnahmen für ihr Debütalbum verliefen derart schlecht, dass Napier-Bell sie nur retten konnte, indem er ein Fake-Live-Album daraus machte. Er zahlte ein kleines Vermögen (20.000 Pfund, sagt er) für die Schreie der Teeniemädchen vom Soundtrack des Beatles-Films Help! und verteilte sie auf die ganze LP, die nun den provokativen Titel Orgasm trug. Doch John’s Children schrieben fast alle ihre Songs selbst und besaßen ein natürliches Gespür für Chaos und Unsinn. Sie waren aber auch intelligent und charmant. Napier-Bells Rolle wandelte sich in eine beunruhigende Mischung aus Beeinflusser und Freund.
Sein folgenreichster Beitrag war die Entscheidung, Marc Bolan als Gitarrist und Hintergrundsänger in die Band aufzunehmen. John’s Children brauchten einen halbwegs brauchbaren Musiker und eine Dosis Songwriting-Talent, aber Napier-Bell glaubte auch, ihr Erfolg könne Bolans Solokarriere voranbringen. »Die Idee war, dass sich die Öffentlichkeit an Marcs komische, zitternde Stimme gewöhnen würde, wenn sie hinter Andy Ellisons Leadgesang steckte. Dass sie irgendwann einlenken würden.«
Heute werden John’s Children als »Freakbeat« geführt, ein Begriff, den es Mitte der 1960er noch nicht gab und der erst später von Plattensammlern erfunden wurde. Er bezieht sich auf Bands wie The Eyes oder The Creation, die sich in den ungestümen Grenzregionen zwischen Mod und Psychedelic bewegten. Ihr Vorbild waren The Who, deren Sound – weißer R&B, der von all den Amphetaminen so nervös wurde, dass er aus allen Nähten platzte – man als den ersten genuin englischen Beitrag zur Rockmusik sehen könnte, weil er deren Konzentration auf Tanz und Sehnsucht in Richtung sozialer und existenzieller Unruhe lenkte. Ihre Musik – Keith Moons wild um sich schlagende Beckenschläge und Trommelwirbel, die drastisch reduzierten, scharfen Powerchords Pete Townshends, John Entwistles überraschende Bass-Attacken – schürten eine Anspannung, die nach einer explosiven Entladung verlangte. Die bekam sie auch – wenn The Who auf den Höhepunkten ihrer Shows ihre Instrumente zertrümmerten.
John’s Children trieben das Live-Chaos von The Who noch weiter. Zum Soundtrack von heulendem Feedback, das ihre musikalische Unfähigkeit verdecken sollte, inszenierte die Band gespielte, aber überzeugend blutige Schlägereien zwischen den Bandmitgliedern. Ellison sprang dann von der Bühne und verwickelte das Publikum in den Streit, womit er die konfrontativen Auftritte eines Iggy Pop von den Stooges und Alan Vega von Suicide vorwegnahm.
Was John’s Children zur ultimativen Freakbeat-Band machte, war ihre ständig schwankende Mischung aus der Aggression der Mods und der Zartheit psychedelischer Musik. Wie Syd Barrett und Donovan sang auch Ellison so rein wie ein Chorjunge. Sein Gesang war dabei so übertrieben englisch, dass er geradezu verweichlicht wirkte. In Songs wie »Come and Play with Me in the Garden« blühten auch die Summer-of-Love-Themen Natur und Kindheit auf. Bei einem Fotoshooting ließ Napier-Bell John’s Children nackt in einem Feld posieren, ihre Geschlechtsteile von Pflanzen bedeckt.
»Wir sahen wirklich fast wie Engel aus«, erinnert sich Ellison, der damals blond und blass war. »Wir waren komplett in weiß gekleidet. Aber sobald man uns auf die Bühne ließ, wurden wir Monster. Man konnte nicht wissen, was wir abliefern würden. Wenn wir zu Gigs fuhren, pflückten wir Blumen aus den Gärten irgendwelcher Leute. Dann warfen wir sie auf die Bühne und sprangen auf ihnen herum. Es war das Gegenteil von Flower Power.«
Im Februar 1967 ging Ellison auf Napier-Bells Vorschlag ein und besuchte Marc Bolan in dessen Zuhause in Südlondon, um herauszufinden, ob sich mit ihm eine musikalische Beziehung aufbauen ließe. »Er saß im Schneidersitz auf dem Sofa und spielte mir diese seltsamen Stücke vor. Ich dachte mir: ›Auf keinen Fall wird der in unsere extrem wilde Band passen, zu unseren riesengroßen Verstärkern.‹« Bolans Akustik-Folk-Ausrichtung und das elektrische Feedback von John’s Children waren nicht die einzigen Gegensätze. Auch in ihrer Herkunft unterschieden sie sich beträchtlich. Ellison und Drummer Chris Townson kannten sich aus dem Internat, ein starker Kontrast zu Bolans Arbeiterklassewurzeln.
Dennoch bewies Bolan schnell, dass die Rechnung aufgehen könnte: Bei einer der ersten gemeinsamen Proben kreuzte er mit Schallabweisern auf, die er aus Alufolie gebastelt hatte und vor den gigantischen Verstärkern seiner Bandkollegen platzierte, um so das Feedback seiner Gitarre zu steuern. Kurz darauf steuerte er auch Songs bei, etwa die Klassiker »Desdemona« und »Midsummer Night’s Scene« sowie »Sarah Crazy Child« und »Go Go Girl«, zwei weitere Highlights im überschaubaren Repertoire der Band.
»Desdemona« ist einer dieser Songs aus den 1960ern, die die große Frage aufwerfen: Warum war das kein Hit? Der Refrain besteht aus der gewagten Zeile »Lift up your skirt and fly«, dazu drischt Townson auf seine Drums ein wie Keith Moon, im Hintergrund hört man Bolan die Backings blöken wie eine Ziege. »Midsummer Night’s Scene« zeichnet ein geradezu dionysisches Bild wie aus einem Fiebertraum von einem Park nach dem Sonnenuntergang: Hippiemädchen mit »von der Liebe entstellten« Gesichtern streuen Blumen und führen die rituellen Tänze des Pan auf. Der Basslauf gibt einem das Gefühl, in einen Ofen zu starren: Er besteht aus gerade einmal einem Ton, der durch einen Verzerrer enorm aufgeblasen wird. Der Song hat – genauso wie die aufregenden »Jagged Time Lapse« und »Remember Thomas A Becket«, die allerdings nicht aus Bolans Feder stammten – kaum etwas, das man einen richtigen Akkord, geschweige denn ein Riff nennen könnte. Stattdessen brechen plötzlich die Verzerrer aus, treiben Schlagzeugwirbel die Geschwindigkeit voran und langgezogenes Feedback taucht ohne jeden Grund auf und verschwindet wieder.
Doch John’s Children gaben sich nicht damit zufrieden, The Who nur musikalisch in ihrer eigenen Disziplin zu übertrumpfen. Auch die theatralisierte Destruktion dachten sie noch weiter. In einem Bandinterview bezeichnete Bolan einen typischen Gig als »fünfundvierzigminütiges Happening. Manchmal ist uns kaum bewusst, was wir tun. Es ist wie eine große Séance zwischen uns und dem Publikum. Ich habe Andy verrückt werden sehen wie einen Medizinmann bei einem Stammestanz.« Ellison distanziert sich heute von dem Wort »Happening«, das in den 1960ern ein Modewort in der Kunstwelt und dem radikalen Theater war: »Ich habe es nie als irgendeine Art von Kunstform gesehen. Aber wir haben es auf die Spitze getrieben. Uns fast zerstört.«
Dieser Hang zur Selbstzerstörung erreichte im Frühling 1967 seinen Höhepunkt auf einer Tour durch Westdeutschland, passenderweise als Vorgruppe von The Who. Die Mod-Götter wurden komplett an die Wand gespielt, nicht nur was die Musik und die Anarchie auf der Bühne anging, sondern auch durch die schiere Lautstärke. Möglich gemacht hatte das eine massive Wand aus Jordan-Verstärkern, von denen Ellison behauptete, dass sie »von der NASA hergestellt« worden seien und die John’s Children mit dem Geld erwarben, das sie durch den US-Erfolg von »Smashed Blocked« verdienten, das es in Kalifornien und Florida in die regionalen Top 10 geschafft hatte. Die Band hatte sich eine Bühnenshow ausgedacht, in der Peitschen, Kunstblutkapseln (für die Glaubwürdigkeit) und eine große Anzahl an Federn, die im ganzen Konzertsaal verstreut wurden, prominente Rollen spielten.
»Ich hatte damals eine silberne Peitsche«, erinnerte sich Bolan 1972 dem NME gegenüber. »Ich kettete ganze Pritschen voller Verstärker aneinander, schleppte sie über die Bühne und peitschte die Gitarre aus.« Während die Band ohrenbetäubende Dezibel abfeuerte, mischte sich Ellison unter die feindseligen deutschen Zuschauer, kämpfte sich durch ein Meer von wütenden Fäusten und riss dabei voller Freude Kissen auseinander, mit deren Federn er um sich warf. Nach einem besonders wilden Auftritt sahen The Who sich gezwungen, ihr Set mit »My Generation« zu beginnen, eigentlich der abschließende Höhepunkt ihrer Show. »Nur so konnten sie weitermachen«, so Bolan. »Die Bühne war voll von Federn, Büstenhaltern und anderem Zeug.« Ellison erinnert sich, dass The-Who-Manager Kit Lambert John’s Children warnte, dass er sie feuern würde, wenn sie so weitermachten. »Aber wir konnten nicht aufhören. Wir wollten herausfinden, wie weit wir es treiben konnten.«
Der teuer erkaufte Sieg kam beim nächsten Konzert, in Ludwigshafen. »Die Bereitschaftspolizei wurde gerufen. 20.000 Leute drehten durch«, erzählt Ellison. »Wir wurden verletzt. Zuschauer stiegen auf die Bühne und attackierten uns. Wir mussten uns dünne machen. Während wir versuchten, da rauszukommen, sah ich, wie Wasserwerfer durch die Fenster schossen, während Stühle nach draußen geworfen wurden.« Weil die Band nun gezwungen war, Westdeutschland möglichst schnell zu verlassen, ließen sie ihr Equipment zurück.
Fast sofort nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien stieg Bolan aus. Vielleicht hatte er begriffen, dass Bands wie John’s Children – auch wenn sie aufregend waren – zu unkoordiniert waren, um erfolgreich zu sein. Dass »Desdemona« kein Hit wurde, leistete seinen Beitrag zu dem Gefühl, dass sich die Gruppe auf dem Holzweg befand.
Auch die Musikwelt befand sich im Umbruch. Das ungehobelte Auftreten von den frühen Who und Stones verschwand, versiertes musikalisches Handwerk und im Studio geschliffene Produktionen nahmen zu, etwa im Fall von Eric Clapton und Jeff Beck, nachdem sie bei den Yardbirds ausgestiegen waren. Dann gab es noch Bands wie Procol Harum und Traffic, die »reifen« Beatles mit ihren Schnauzbärten oder die Fusion von Gewalt und Virtuosität, die sich The Jimi Hendrix Experience auf die Fahnen geschrieben hatten. John’s Children hingegen nahm keiner ernst.
Dennoch sah Bolan seine kurze Zeit mit der Band als wegweisend. 1971 erklärte er ZigZag: »Alles, was ich [mit T. Rex] tue, ist im Prinzip John’s Children nachzubilden oder das, was ich mir von John’s Children erhofft hatte, als ich bei ihnen anfing.« Von John’s Children zu T. Rex nahm er allerdings einen langen Umweg über seine neue Band Tyrannosaurus Rex.
Angeblich war es ein Auftritt des Sitar-Gurus Ravi Shankar, den er auf dem Weg nach Hause von seiner katastrophalen letzten Tour mit John’s Children in Luxemburg gesehen hatte, der Bolan zur Gründung des Akustik-Duos Tyrannosaurus Rex inspirierte. Bolan und die restlichen Bandmitglieder trugen noch immer ihre weißen, blutgetränkten Bühnenoutfits (das Blut war teils künstlich und teils echt) von dem außer Kontrolle geratenen Konzert in Ludwigshafen. »Marc war wie verzaubert. Shankar saß auf einem Teppich, spielte seine Sitar und nichts konnte seinen Auftritt unterbrechen«, sagt Napier-Bell.
Wenn Shankars Konzert wirklich ein derartiger Heureka-Moment gewesen sein soll, ist es allerdings seltsam, dass Bolan unmittelbar nach seiner Rückkehr versuchte, in London seine eigene komplett elektrische Band auf die Beine zu stellen. Die Band wurde überhastet durch eine Anzeige im Melody Maker zusammengestellt und spielte einen einzigen, desaströsen Gig im Rock Garden in Covent Garden. »Marc achtete beim Vorspiel nur auf die Namen und das Aussehen der Bewerber, wie er es immer tat«, erklärt Napier-Bell. »Geprobt haben sie auch nicht. Er glaubte einfach, dass kosmische Magie etwas Wundervolles hervorbringen würde.«
Erst nach diesem Debakel legte sich Bolan auf das akustische Konzept von Tyrannosaurus Rex fest. Ein Mitglied seines fehlgeschlagenen Bandprojekts behielt er bei, ein siebzehnjähriges »Blumenkind«, das den Namen eines Hobbits aus Tolkiens Der Herr der Ringe angenommen hatte: Steve Peregrin Took – warum er seinen Vornamen behielt und so die Märchen-Aura untergrub, ist nicht bekannt – war eigentlich Schlagzeuger, sah sich jedoch gezwungen, sein Schlagzeug zu verkaufen, um die Miete zahlen zu können. Es war also der Zufall, der dazu führte, dass Tyrannosaurus Rex sich für einen Sound entschieden, der auf Bolans Gesang und Gitarre zu Tooks Handpercussions und Hintergrundseufzern basierte.
Der verschrobene Stil des Duos sagte dem neuen Hippiepublikum zu. Schnell wurden sie zu einem gefragten Act und verdienten 50 Pfund pro Gig. Napier-Bell fühlte sich in seinem Glauben an Bolans Talent bestärkt und wollte den Preis anheben, doch Bolan, der sich der antikommerziellen Haltung des Undergrounds angepasst hatte, war dagegen. »Marc sagte, ›Oh nein, Mann. Das will ich nicht. Es ist nicht richtig. Ich bin Teil dieser Kultur und es ist keine Geldkultur‹«, erinnert sich Napier-Bell. Also gingen Bolan und sein erster Manager getrennte Wege. Tyrannosaurus Rex wandten sich daraufhin Blackhill zu, einer aufstrebenden Management-Firma direkt am Puls der britischen Gegenkultur.
Blackhill war von Peter Jenner und Andrew King gegründet worden, um sich um die führende Psychedelic-Band des Landes, Pink Floyd, zu kümmern. Ihren Sitz hatten sie in der Ladbroke Grove. Teil des Teams war Jenners Mitbewohnerin June Child, die Pink Floyd zuerst zu ihren Gigs fuhr, sich dann um ihre Finanzen kümmerte und schließlich die erste Mitarbeiterin der jungen Firma wurde, da sie als Empfangsdame und Mädchen für alles angeheuert hatte. Sie und Bolan verliebten sich schnell. June Child hatte nicht nur den passenden Namen für ein Blumenkind, sondern auch den klassischen Look: Sie war blass, gertenschlank und hatte ein langes, ovales Gesicht, umrahmt von strohblonden Locken. Sie war aber auch sieben Jahre älter und damit erwachsener als Bolan. Child wurde zu seiner Beraterin, praktisch auch zu seiner Managerin sowie seiner Seelenverwandten, Muse, Liebhaberin und schließlich Ehefrau.
Möglicherweise war es auch Teil ihres Reizes, dass sie eine kurze Zeit Syd Barretts Geliebte war. Bolan sah dem Sänger und Gitarristen von Pink Floyd etwas ähnlich: Er war hübsch, mit dunklen Locken und dem Hauch eines Gipsy. Es gab aber noch tiefergehende Parallelen: einen köstlich englischen Gesangsstil und Lyrics, die in die idyllisch-unschuldigen Welten von Kinderbüchern abtauchen. »Er ist einer der wenigen Menschen, die ich tatsächlich ein Genie nennen würde«, schwärmte Bolan von Barrett. »Er hat mich unglaublich inspiriert.« Barretts Pop-Erfolge mit Pink Floyd – Hits wie »See Emily Play« und The Piper at the Gates of Dawn, eines der großen Alben des britischen Summer of Love – ermutigten ihn zu erkunden, was bereits in ihm steckte.
Barrett versuchte bewusst zu vermeiden, wie ein Amerikaner zu klingen. Stattdessen drückte er sich klar und prononciert aus. So klang er hin und wieder auf positive Weise nach britischer Oberschicht, was die Hörer zurück in die Kinderstuben des Englands zur Zeit von Eduard VII. trug. Dem kamen im Pop nur »Lady Jane«, der pseudo-mittelalterliche Minnesang der Rolling Stones, und die übertrieben präzise, vornehme Ausdrucksweise in Donovans »Mellow Yellow« zuvor. Mit all ihren Kinderreim-artigen Assonanzen und Binnenreimen trieben Barretts Texte die psychedelische Erhöhung der Kindheit – ein Thema, das im britischen Pop als erstes die Beatles mit »Strawberry Fields Forever« und »Yellow Submarine« angeschnitten hatten –, etwa mit »See Emily Play«, »The Gnome« und »A Candy and a Currant Bun«, noch weiter. Auf The Piper at the Gates of Dawn erzeugt »Matilda Mother« die friedliche Benommenheit der Gute-Nacht-Geschichte. Die mütterliche Stimme verwandelt die »scribbly lines«* auf dem Papier vor dem inneren Auge in kleine Wunderländer. In »Bike« begegnet uns eine freundliche Maus namens Gerald. Der Anthropomorphismus und Animismus (Barrett glaubte an Baumgeister) sprachen das pantheistische Bewusstsein vieler LSD-Konsumenten an. Es gab aber auch dunkle Schimmer des Übernatürlichen (»Lucifer Sam«, über eine unheimliche Katze – »that cat’s something I can’t explain«), die die Psychose vorwegnahmen, die Barrett später heimsuchen sollte, nachdem das psychedelische Trommelfeuer, dem er sich aussetzte, den Schutzschild seiner Psyche niedergerungen hatte.
Den Namen für The Piper at the Gates of Dawn nahm Pink Floyd vom siebten und mystischsten Kapitel des Kinderbuchs Der Wind in den Weiden. Darin erblicken die Wasserratte und der Maulwurf den Naturgott Pan, nachdem sie von den betörenden Klängen seiner Urmusik flussaufwärts gelockt wurden. Bolan fing an, sich obsessiv für Pan zu interessieren, den man für gewöhnlich mit bäuerlichen Riten und Druidenlogen verbindet und der in der Mythologie mit ausgelassenen Elfenjungfern (Nymphen) dargestellt wird. Eine kleine grüne Statue des Halbmensch-Halbziegenbocks, der er den Spitznamen Poon gab, zierte den Kaminsims in seinem und Childs Zuhause, später war sie auch auf der Hülle der Tyrannosaurus-Rex-LP A Beard of Stars zu sehen. Pans Präsenz schimmert durch die komplette Diskografie des Duos, vor allem in Songs wie »Woodland Bop« auf A Beard of Stars oder »Puckish Pan«, von dem es nur ein Demo gibt.
Pan diente auch J. M. Barrie als Quelle, als er Peter Pan erfand, den »wilden Jungen«, der nie erwachsen wird (und der bei Bühnenaufführungen immer von einer androgynen jungen Frau gespielt wurde). In den 1960ern kam ein neuer Typ junger Mann auf, der das Bild des ausgereiften Mannes zurückwies und sich mit Dingen beschäftigte, die traditionell als weibliches Terrain galten. Bolan und Barrett gehörten zu dieser neuen Sorte »weicher Männer«, wie auch andere Figuren des Underground der späten 1960er wie Kevin Ayers und Robert Wyatt von The Soft Machine. Ihre Generation war die erste, die sich nicht mehr der »Charakterbildung« des Militärs unterziehen musste (die Wehrpflicht wurde Anfang 1961 abgeschafft). Die »weichen Männer« waren auch die ersten Söhne, die so antiautoritär erzogen worden waren, dass manche von ihnen nie mit ihren nachsichtigen Müttern brachen. Somit gab es für sie keinen Anlass, sich mit der patriarchischen Gesellschaftsordnung zu identifizieren.
Diese Generation junger Männer trennte sich auch nicht von vielen Objekten ihrer Kindheit, selbst dann nicht, als Sex, Drogen und Rock ’n’ Roll auf den Plan traten. »Ich will immer noch erwachsen werden und ein Mann sein«, teilte Bolan den Teenies mit, die das Mädchenmagazin Jackie lasen. »Bolan war mehr jemand, den Mädchen bemuttern wollten, als jemand, von dem sie gefickt werden wollten«, sagt Peter Jenner von Blackhill. »Er spielte den hübschen Jungen. Und zwar eindeutig einen Jungen, nicht einen Mann.«
»Was Pink Floyd elektronisch machen, machen wir akustisch.« So beschrieb Bolan Tyrannosaurus Rex einmal. Auf Texte und Gesang trifft das sicherlich zu, auf die Musik eher nicht. Da weist der beschwörende, schnell geschrammelte Folk Richie P. Havens’ mehr Parallelen auf. Oder The Incredible String Band, wenn sie etwas mehr Rock ’n’ Roll als Folk gewesen wären. Bolans und Tooks Sound hatte weder Bass noch Backbeat, stattdessen dominierten die hochfrequenten Töne: fröhlich klimpernde Akustikgitarren, schrille Vocals und das Geklirre exotischer Percussioninstrumente – afrikanische Sprechtrommeln, Fingerzimbeln und das Pixiphone*, ein »kleines Kinderxylophon«, das Took bei Harrods in der Spielzeugabteilung gefunden hatte.
Neben Percussions übernahm Took auch den Hintergrundgesang – Harmonien, aber auch Sprechchöre und Zwischenrufe. Am verrücktesten ist seine Mischung aus Wiehern, Schreien, Zischen, Seufzern und nervöser Mundpercussion auf »Scenes of Dynasty«, einem Track, der nur aus Stimmen und lose zusammenpassendem Klatschen besteht. »Steves Getrommel hat mich nie so richtig begeistert«, gab Bolan zu. »Aber was er wirklich gut konnte, war Singen […]. Er hatte ein Gespür für Harmonien.«
Tyrannosaurus-Rex-Songs klingen oft wie spontane Jam-Sessions, die auf einer Waldlichtung von einem unter einem Giftpilz versteckten Mikrofon aufgenommen wurden. Es gibt praktisch keine trendigen psychedelischen Effekte, wie sie die Tontechniker der Abbey Road Studios für The Piper at the Gates of Dawn angefertigt hatten. Eine der wenigen Ausnahmen ist ein Song vom zweiten Album Prophets, Seers & Sages: The Angels of the Ages: »Deboraarobed«. Wie der befremdliche Titel nahelegt, ist der Song ein Audio-Palindrom: Genau in der Mitte macht er eine Kehrtwendung und endet schließlich wieder mit seinem Anfang. Es dauert eine Weile, bis man das kapiert hat. Zuerst klingt es einfach, als würde Bolan eine verlorengegangene oder neu erfundene Sprache rezitieren.
Im Kern klingt jeder Tyrannosaurus-Rex-Song wie ein kosmischer Straßenmusikant, dessen Geschrammel und Getriller genau den Mittelpunkt zwischen Folk und Rockabilly trifft. Die perkussiveren Songs ähneln den Hippie-Jams, die spontan auf Festivals oder besetzten Grundstücken stattfanden: Die – mindestens – bekiffte Menschenmenge griff sich einfach Bongos, Tamburine, Flaschen, Kochtöpfe oder was sonst noch so herumlag und klimperte los.
Mehr noch als Syd Barrett oder The Incredible String Band beeinflussten Bolan zu dieser Zeit zwei Schriftsteller: J. R. R. Tolkien und C. S. Lewis, die meistgelesenen Fantasy-Autoren des 20. Jahrhunderts, die beide den Inklings angehörten, einer Verbindung in Oxford, die aus gleichgesinnten Studierenden bestand, die sich von der modernen Welt angegriffen fühlten.
Manche bezeichnen Bolan als unersättliche Leseratte. Andere behaupten, er war Legastheniker und habe sich Tolkiens Werke von June vorlesen lassen. In einem Interview sprach Bolan davon, sich von Tolkien persönlich eingesprochene Aufnahmen seiner Bücher anzuhören. Was davon auch stimmen mag, das Debütalbum von Tyrannosaurus Rex, My People Were Fair and Had Sky in Their Hair … But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows, lieh sich seinen albern langen Titel von einem Spruch, den Tom Bombadil in Der Herr der Ringe aufsagt. Gewidmet ist das Album »Aslan und den alten Narnianern« – eine Anspielung auf den Christus-ähnlichen Löwen in C. S. Lewis’ Romanreihe, die in der magischen Welt Narnia spielt.
Eines der ersten Tyrannosaurus-Rex-Interviews erschien in der Undergroundzeitung Gandalf’s Garden. Darin erklärt Bolan, der Bandname sei ihm eingefallen, als er als Kind die Masern hatte: Während er ans Bett gefesselt war, las er ein Buch über prähistorische Dinosaurier, in dem stand, es sei plausibel, dass sie »Feuer und Rauch geatmet« haben könnten, was wiederum die Existenz von Drachen bewies. »Ich lasse meine Kindheit in meinen Songs wieder aufleben. Ich gehe in die Dinge, etwa Platten und Bücher, und lebe darin.«
Bolans frühe Lyrics sind überladen von geheimnisvoller Sprache und damit weit entfernt von den Hit-Singles von T. Rex, der Band, die aus Tyrannosaurus Rex entstehen sollte. Keine Spur von der prägnanten Sexiness von »Get It On«. Stattdessen ähneln die Songs aus Bolans Hippie-Phase viel eher zufälligen Sammlungen von exotisch klingenden oder altertümlichen Wörtern, weit entfernt von Raum und Zeit. Diese Wörter entnahm er der Archäologie und Anthropologie, der Mythologie und Zoologie. Barden und Jungfern erscheinen im Überfluss, dazu findet man Hinweise auf verschwundene Zivilisationen wie die Inkas und beinahe ausgestorbene Indianerstämme wie die Shawnee. Vor dem geistigen Auge des Hörers erscheint eine Palette von antiquierten Waffen, Kleidungsstücken, Stoffen und Fahrzeugen (bevorzugt Streitwagen), ebenso wie seltene Substanzen wie Damast und Chalzedon.
»Die Vergangenheit interessiert mich«, sagte Bolan Gandalf’s Garden gegenüber. »Ich schreibe nie für die Zukunft. Namen, Wortketten, sonderbare Bücher […], Kräuternamen machen mich fertig, sie treiben mich völlig in den Wahnsinn. Aus Kräuternamen kann ich ganze Geschichten basteln.« Tyrannosaurus-Rex-Songs erzählen allerdings gar keine Geschichten. Stattdessen werden sie von einer nicht-narrativen Unlogik zusammengehalten, die über zungenbrechende, verbalmusikalische Effekte wie Binnenreime, Assonanzen und Zischen funktioniert: »chants a crooning moon rune«; »a tusk of boar with dwarfish saw«. Und überall stecken Kreaturen. Manche gibt es wirklich, andere sind ausgestorben oder komplett mythologisch: Raben, Delfine, Störche, Flugsaurier, Waldgeister.
Alle Zutaten, aus denen Tyrannosaurus-Rex-Songs bestehen – Archäologie, das Tierreich, Dinosaurier, Märchen und Fantasy-Literatur – bieten Fluchtwelten für Kinder (oder zumindest taten sie dies vor der Zeit von Internet und Videospielen). Als ich die Lyrics aller vier Tyrannosaurus-Rex-Alben durchging, fiel mir auf, dass Bolans frühes Songrepertoire ein nahezu vollständiger Querschnitt aus meinen Interessen als Sechs- bis Zehnjähriger ist. Mein erster Wunschberuf war es, als Archäologe im Dschungeldickicht Maya-Tempel zu entdecken. Dann wollte ich Zoologe oder Vogelkundler werden Fischadler mit einem Binokel betrachten und Pfotenabdrücke in Gips gießen. Und schließlich entschloss ich mich, Kinderbuchautor zu werden, denn ich wollte Schriftsteller sein. Der Hobbit, Der Herr der Ringe und Die Chroniken von Narnia begeisterten mich zu der Zeit besonders: Ich muss sie alle jeweils drei oder vier Mal gelesen haben, bevor ich schließlich zu Science-Fiction und Erwachsenenliteratur aufstieg.
Auf dem Backcover von Prophets, Seers & Sages befindet sich der Text »Im Kopf eines Mannes ist eine Frau, im Kopf einer Frau ist ein Mann, aber welche Wunder durchstreifen den Kopf eines Kindes«. Die Vorpubertät als verlorenes Paradies der Vorstellungskraft. Der Ausbruch der Sexualität verringert die Kapazitäten für die Ehrfurcht vor dem Fantastischen. Das Publikum von Tyrannosaurus Rex bestand jedoch aus Hippies und Studenten aus der Bohème. Aus der Pubertät waren sie längst raus und die sexuelle Befreiung einer der Grundpfeiler des Weltbildes der Gegenkultur. Was reizte sie also an der Unschuld? Der einzige Tyrannosaurus-Rex-Song über den Liebesakt ist wohl »Juniper Suction«, aber er ist unaufrichtig und bemerkenswert ängstlich im Ton – was sich ändern würde, sobald Bolan zum anzüglichen Hüftkreisen von T. Rex übergangen war.
Doch selbst im Gebiet der prä-adoleszenten Fantasie scheut das Werk von Tyrannosaurus Rex die dunklere Seite der Kinderliteratur: die englische Tradition von Geistergeschichten und unheimlichen Erzählungen. Auch Tolkiens unheimliche Seite lässt es aus: die Realität des Bösen und die harte Notwendigkeit, gegen es vorzugehen.
Was Bolan von Tolkien und Lewis lernte, waren die Kreation neuer Welten und die Sehnsucht, dem Hier und Jetzt zu entkommen. In seinem Essay »Über Märchen« setzt sich Tolkien mit dem Gedanken auseinander, dass das Erfinden von imaginären Welten Gottspielereien gleichkäme. Der Schriftsteller spiegelt den Schöpfer wider, indem er »eine sekundäre Welt« kreiert. Innerhalb dieser »Subkreation« folgt alles »den Gesetzen dieser Welt«, die sich auch wiederum der Schriftsteller ausgedacht hat. Tolkien, ein Professor der Philologie, ging sogar so weit, für die Völker der Mittelerde mehrere komplett erfundene Sprachen zu entwerfen.
Für Bolan bedeutete seine Vorstellungskraft einen Schutzraum für seine eigene beschädigte Größe vor den Demütigungen der harschen Realität. Er beschrieb sich selbst als »sonderbares Kind, sehr abgefuckt«, das »sehr in meine eigene kleine Welt« abtauchte. »Ich habe nicht oft mit anderen Leuten Boogie getanzt […]. Ich las sehr viel.« Die Bücher von Tolkien und Lewis inspirierten ihn dazu, sein eigenes magisches Reich herbeizuzaubern: Beltane. Es wurde zum Schauplatz eines Buches mit dem Titel The Krakenmist, das er Anfang 1968 schrieb (der Titel kam von John Wyndhams Sci-Fi-Roman Wenn der Krake erwacht, dessen Titel wiederum von einem Gedicht Alfred Tennysons stammte, das auf einer altnordischen Legende basiert). Er hatte auch geplant, ein ganzes Konzeptalbum in Beltane spielen zu lassen, aber heraus kam dabei nur der Song »Beltane Walk« vom selbstbetitelten, ersten T.-Rex-Album von 1970.
Der Reiz dieser imaginären Welten für Leser (oder Hörer, im Fall von Tyrannosaurus Rex) liegt in dem Zufluchtsort, den sie für das innere Kind bieten, eine Fantasiewelt, die vom Zynismus der Welt abgesichert und abgespalten ist. Das Leben eines Erwachsenen mit seinem Fokus auf Karriere und Konsum hingegen zerfrisst die Seele und verhärtet das Herz: In seinen Briefen und Interviews bezog sich Bolan oft auf »die harte Welt« oder beschwerte sich darüber, dass das sogenannte echte Leben »sehr hart« sei, ein Ort voller »Blockierungen«, in der »fast alles, das sanft ist […], verdächtig ist«.
Diese Beschwerden sind zeitlos, waren aber in den späten 1960ern besonders verbreitet. Tolkiens Unmodernität machte ihn bei den Hippies erst so beliebt. Er glaubte, die Fantasie könne Gegenmittel und Widerstand angesichts der allgegenwärtigen Enttäuschungen bieten: ein Ort der »Freiheit von der Vorherrschaft der empirischen ›Fakten‹«. Wie die Literaturkritikerin Jenny Turner beobachtete, wurde Der Herr der Ringe »geschrieben, um die moderne Welt in Schach zu halten«. Tolkien selbst merkte an, dass »die Leser und Macher von Märchen sich nicht wegen ihrer Flucht in die Altertümlichkeit schämen« sollten. Schließlich »bevorzugen sie nicht nur Drachen, sondern auch Pferde, […] nicht nur Elfen, sondern auch Ritter und Könige« gegenüber »fortschrittlichen Dingen wie Fabriken […], Maschinengewehren […], Bomben«.
Obwohl Psychedelic-Rock-Bands elektrische Gitarren, riesige Verstärker, Lichtshows und höchstmoderne Studiotechnik nutzten, misstrauten sie technologischen Fortschritten außerhalb ihres eigenen Schaffens. Bands wie Traffic sprachen davon, »unsere Köpfe auf dem Land frei zu kriegen«. Die neuen Rockfestivals wählten für ihre Stammestreffen ländliche Gegenden aus. Bolan schloss sich diesem Zurück-zur-Natur-Trend an. 1968 erzählte er dem NME, er könne »Städte und die Realitäten des modernen Lebens« nicht ausstehen: »Dinge aus Plastik stoßen mich ab.« Gegenüber Fusion behauptete er, dass das Debütalbum My People Were Fair aus »Wald- und Landliedern« bestehe, von denen er »die meisten auf dem Land« geschrieben habe.
Auf diesem Album rezitiert Bolans Freund John Peel – der führende DJ des britischen Undergrounds – eine »Woodland Story« nach dem Vorbild von Der Wind in den Weiden. Der Protagonist, Kingsley Mole, hat Tagträume von »gesunkenen Galeonen und Bildern von verrosteten Dublonen und überschwemmten Kabinen, voll von modrigen Musketen und hellgoldenen Handschuhen«. Auf der Rückseite der Hülle huldigte Peel dem Duo: »Tyrannosaurus Rex entsprangen den traurigen, zerstreuten Blättern eines vergangenen Sommers. Während des harten, grauen Winters wurden sie von denen gepflegt und gestärkt, die sie liebten. Als der Frühling kam, blühten sie auf, Kinder jubelten und die Erde sang mit ihnen. Es wird ein langer, ekstatischer Sommer werden.«
Peel war der größte Unterstützer der Band. Er spielte ihre Songs im Radio und lud sie ein, bei seinen DJ-Gigs aufzutreten. »Peel hypte Marc und seine Musik«, erinnert sich Peter Jenner. »Und Peel war der Trendsetter des Undergrounds. Er war ein starker Live-DJ, verdiente damit gutes Geld, und die Hälfte davon gab er Bolan und Took.« Ihre ständige Präsenz bei diesen Gigs und den für Peels Sendung aufgezeichneten Live-Sessions machte aus Tyrannosaurus Rex eine der bekanntesten Bands des Undergrounds.
Peel und Bob Harris – Peels jüngeres Gegenstück bei Radio One, dem Pop-Sender der BBC – hatten großen Einfluss in der Grauzone zwischen Underground und Mainstream. Andere Vermittler zwischen diesen Polen waren das wöchentliche Musikmagazin Melody Maker und das monatliche ZigZag sowie die auflagenstärksten Zeitungen der Gegenkultur wie die International Times und Oz sowie die Programmzeitschrift Time Out (damals noch als Kollektiv betrieben). Das spirituelle und geografische Zentrum der Gegenkultur – das in etwa Haight-Ashbury entspricht – lag in den West-Londoner Vierteln Ladbroke Grove und Notting Hill Gate. Damals war diese Gegend funky und abgeranzt, Immigranten und die Bohème mischten sich mit Argwohn untereinander. Hier befanden sich die Büros von Undergroundheften wie Frendz und progressiven Labels wie Island. Hier lebten behaarte Rocker wie Hawkwind oder The Pink Fairies und auch Marc Bolan selbst, der mit June Child in eine Dachwohnung in Blenheim Crescent gezogen war.
Über ganz Großbritannien verteilt gab es gegenkulturelle Außenposten ähnlich der Ladbroke Grove: Headshops, groovy Boutiquen, Plattenläden, Arts Labs und besetzte Gebäude. Bei Open-Air-Festivals kam die Langhaar-Community zusammen. Manche dieser Festivals waren unabhängig und anarchisch, mit der Zeit nahm aber auch die Anzahl der kommerziellen und (relativ) gut organisierten Festivals zu. Tyrannosaurus Rex spielten auf dem ersten einer Reihe von kostenlosen Konzerten im Hyde Park (die Idee dazu hatte Peter Jenner).
Der Underground wurde mehr oder weniger mit Studierenden gleichgesetzt. College-Gigs zu spielen war wichtig, denn so konnten progressive Bands vor einem relativ aufgeschlossenen Publikum auftreten oder zumindest vor einem, das nicht nur zum Tanzen da war. Diese Auftritte waren gut bezahlt: Dank der Gebühren, die jeder Student automatisch an die National Union of Students zahlen musste, standen den studentischen Organisatoren beachtliche Budgets zur Verfügung. Gewöhnliche Club-Promoter beschwerten sich bitterlich darüber, dass Universitäten bestimmte Bands einfach vom Markt wegkaufen würden.
Musikalisch bezog sich der Begriff »Underground« auf ein weites Spektrum: bombastischer Heavy Rock, die verschachtelten Strukturen des Prog Rock mit seinen Klassik- und Jazz-Einflüssen, trippiger Space Rock, Folk-Blues-Barden, um nur ein paar zu nennen. Aber trotz dieser Vielschichtigkeit gab es gemeinsame Eigenschaften und Einstellungen. Undergroundbands kümmerten sich nicht besonders um ihr Image. Oder besser: Sie kümmerten sich um ein Anti-Image. Immer weniger tauchten sie selbst auf ihren Albumcovern auf, an ihre Stelle traten surreales oder abstraktes Artwork. Mit ein paar Ausnahmen verzichteten sie auch auf übermäßige Selbstdarstellungen. Lieber ließen sie die Musik für sich sprechen und verbreiteten mit ihren langen Jams und Solos eine auf das Innere fokussierte Atmosphäre.
Aber wichtiger noch: Für den Underground waren Rock und Pop Gegensätze, »kommerziell« ein Schimpfwort. Diese Ablehnung äußerte sich etwa im Desinteresse an der 7"-Single und ihren kreativen Möglichkeiten. Was gut funktionierte, schließlich gab es kaum etwas auf ihren LPs, das auch nur ansatzweise radiofreundlich oder kurz genug für eine Singleauskopplung war. Manche Bands (Pink Floyd nach der Barrett-Ära, Led Zeppelin) veröffentlichten gar keine Singles. Denn die waren fürs Tanzen gedacht, für Diskotheken. Ernsthafte Musikhörer griffen aber zu Alben. Von 1968 bis 1969 passte sich Bolan dieser Eigenart an. Als die ersten Labels anklopften, um Tyrannosaurus Rex unter Vertrag zu nehmen, war seine Verhandlungsposition: »Ich will keine Single machen, sondern ein Album.«
Was Image und Auftreten anging, bedeutete die neue Anti-Pop-Attitüde, dass ein neuer, zäher Look in Erdtönen die psychedelische Farbenfreude der Swinging Sixties verdrängte. Dieser Anti-Stil bestand aus natürlichen Materialien und urtümlichen Stoffen, handgemachten Gewändern, Batik-Shirts und vor allem verblassten Jeansstoffen. Schlaghosen wurden mit Aufnähern verziert, selbst wenn sie keine Löcher hatten. Geflickte Jeans wurden zum Symbol der Selbstmachkultur. Sie kommunizierten Abstand zur massenproduzierten Welt der Mainstreammode. Als Symbolbild von Praktizismus und Ungezwungenheit wurde der Jeansstoff zur Uniform der Gegenkultur.
Die aufschlussreichste Änderung von der Mod- zur Hippie-Ästhetik lag in den Haaren: lang und glatt bei Frauen, zottelig oder bis zum Fake-Afro gekräuselt bei Männern. Bärte standen sowohl für die Rückkehr zur Natur als auch fürs Erwachsenwerden. Bärtige Musiker zeigten, dass sie derartige Pop-Albernheiten wie Images und die Notwendigkeit, Mädchen anzusprechen, hinter sich gelassen hatten. Das ultimative Anti-Glam-Bild sind wohl die Zeichnungen von einem Hippiepärchen – bärtiger Mann und Frau mit behaarten Achselhöhlen – beim Sex in Alex Comforts Ratgeber The Joy of Sex.
Steve Peregrin Took trug einen dünnen Bart, aber Bolan ließ sich nie einen wachsen. (Ehrlich gesagt sah er auch nicht so aus, als wäre er dazu in der Lage gewesen.) In anderen Bereichen orientierte sich der einstige Mod am Stil der Hippies. Fotos von Tyrannosaurus Rex zeigen ihn wenig ausgeschmückt, in Shirts mit U-Ausschnitten, Jeans, schlaffen Hüten und anderen bunt zusammengewürfelten Gewändern.
Auch ideologisch passte er sich an. Seinen kreativen Prozess beschrieb er als intuitiv und nicht kalkuliert und behauptete, die Songs kämen von einem höheren Ort: »Wenn ich komponiere, kommen Worte und Musik einfach zusammen. Zuerst sehr grob, aber dann werde ich davon high und kann nicht mehr damit aufhören, bis ich mir den Kopf wegpuste und es geradezu aus mir heraussprudelt«, erzählte er Gandalf’s Garden. Auch Authentizität und Aufrichtigkeit – zwei wichtige Schlagwörter der Gegenkultur – schrieb er sich auf die Fahne: »Ich sage, was ich bin. Ich sehe nach dem aus, was ich bin. Ein Image aufrechtzuerhalten, ist einfach zu aufwändig.« Er gab vor, Öffentlichkeit und kommerziellem Erfolg gleichgültig gegenüberzustehen. Tyrannosaurus Rex, so Bolan, würden nun zwar auch Geld für ihre Auftritte bekommen, »aber diesen Sommer spielen wir trotzdem umsonst. Wir haben die Erlaubnis vom Stadtrat, in bestimmten Parks in den Musikpavillons zu spielen, solange wir keine Werbung dafür machen.« Er sprach gerne mit Gandalf’s Garden, weil es Teil einer »netten Szene« sei, aber davon abgesehen würden Tyrannosaurus Rex »gar keine Interviews geben, niemals, wenn es nach mir ginge«.
Bedenkt man, dass er mit T. Rex das genaue Gegenteil tat – Singles veröffentlichen, ein Star werden, im Luxus schwelgen, zahllose Interviews geben –, ist es verlockend anzunehmen, Bolan habe die Gunst der Stunde genutzt und den Hippie nur gespielt. Ich halte es allerdings für wahrscheinlicher, dass er ein sehr situationsabhängiges Verhältnis zu seiner Weltanschauung hatte. Da Bolan leicht zu beeindrucken und anpassungsfähig war, bog er sich im Verlauf der 1960er wie ein Schilfrohr im Wind der Mode und des Zeitgeists. Und doch lag unter seinem formbaren Charakter der widerspenstige Stahl des Selbstvertrauens. Diese Kombination aus Flexibilität und Lust auf Ruhm teilt sich Bolan mit vielen anderen Schlüsselfiguren des Glam. Am deutlichsten erkennbar ist sie bei David Bowie – der sich auch eine Zeit lang dem Underground verschrieben und die Rolle als tatsächlicher Anhänger überzeugend gespielt hatte.
In ihrer Autobiografie Real Life erinnert sich Marsha Hunt – die dank der Single »Walk on Gilded Splinters« für kurze Zeit in Großbritannien ein Popstar war – an ihre Affäre mit Bolan zu seiner Hippiephase, die sie als einen Fall von »Gegensätze ziehen sich an« beschreibt. »Ich war die Personifizierung von Dingen, die Marc ablehnte. Er lebte zurückgezogen und makrobiotisch […]. Er hatte kein Geld und tat so, als würde er es aus sozialen Gründen ablehnen […]. Er machte sich über meinen Erfolg lustig. Ich glaubte fast, dass er ihn richtig verachtete […]. Aus Marcs Sicht war mein öffentliches Auftreten kommerziell, was der seriösen Kunst unangemessen war, als die er seine Musik ansah, was ihm ihre Obskurität bestätigte.«
Wenn also »Marc, der Hippie« nur eine Rolle war, die er spielte, um sich bei seinen Anhängern im Underground anzubiedern, dann hätte er diese Fassade doch sicherlich gegenüber seiner Popstar-Freundin gelüftet? Dass er sich über ihren Erfolg auch noch lustig machte, legt nahe, dass er das, was er sagte, mit ganzem – unbeständigen – Herzen glaubte. Das ist keine Scheinheiligkeit, wie wir sie sonst kennen. Es ist eher ein Fall von jemandem, der sich so sehr in eine Rolle versetzt, dass sie wahr wird. Steven Took, der Tyrannosaurus Rex später verließ, um mit den Pink Fairies radikalere Musik zu machen, hatte nie den Eindruck, Bolan meine es nicht ernst. »Ich glaube, eine Zeit lang war Marc ein guter Hippie«, erinnerte er sich, als sich T. Rex gerade auf dem Zenit ihres Erfolgs befanden. »Wir saßen oft herum und kritisierten alles, was geändert werden musste.«
Was auch immer der Fall war, wenige Jahre später sang Marc ein anderes Lied: über seinen neuen Rolls-Royce etwa (obwohl er gar nicht Autofahren konnte), oder indem er gegenüber der Weekly News damit angab, nicht mehr »40 Pfund die Woche« zu verdienen, sondern »40 Pfund die Sekunde«. (Bolan-typisch eine maßlose Übertreibung. Der entsprechende Jahresbetrag wäre eine Milliarde.)
Als er gefragt wurde, wo Steve Took denn wäre, witzelte er kühl: »Oh, irgendwo in der Gosse.«
Dabei waren Tyrannosaurus Rex kommerziell tatsächlich recht erfolgreich. Mit »Debora« und »One Inch Rock« hatten sie sogar zwei Hits in den Top 40 (bevor Bolan sich gegen Singles entschied) und sowohl My People Were Fair als auch Unicorn, ihr drittes Album, schafften es in die Top 15 der Album-Charts. Ende 1969 war die Band jedoch am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen: bei Albumverkäufen zwischen 13.000 und 17.000 Exemplaren. Die – kurzzeitig vom Underground-Ethos gedämpfte – Lust auf größeren Ruhm kochte in Bolan wieder auf. Das Resultat war ein origineller Schachzug, den später andere Kultfiguren wie Adam Ant kopieren sollten: der strategische Ausverkauf, der Underground/Mainstream-Switch. Ein riskantes Unterfangen: Leicht könnte man die ursprünglichen Anhänger vergraulen, ohne neue hinzuzugewinnen.
Mit dem vierten – und, wie sich später herausstellen sollte, letzten – Tyrannosaurus-Rex-Album A Beard of Stars (1970) unternahm Bolan bereits ein paar zögerliche Schritte in diese Richtung. Er fing wieder an, E-Gitarre zu spielen. Took hatte die Band verlassen und sein Nachfolger, Mickey Finn, war bei den exotischen Arrangements lange nicht so kreativ wie er. Stattdessen sorgte Finn für mehr Funk. Auf ein paar Stücken spielte Bolan auch einen E-Bass. Diese Veränderungen führten aber noch zu keiner kompletten Rhythmusgruppe. Tyrannosaurus Rex waren noch nicht bereit fürs Radio, aber »By the Light of a Magical Moon« verwies bereits auf Bolans Bubblegum-Boogie-Zukunft. Er und Produzent Tony Visconti fügten der Aufnahme den Klang kreischender Mädchen hinzu und beschworen damit die Fanmassen, die erst noch kommen sollten. Wahrscheinlich hatte sich Bolan daran erinnert, wie Simon Napier-Bell den gleichen Trick auf John’s Childrens Orgasm angewandt hatte.
Ende 1970 hatten Tyrannosaurus Rex ihren Namen in T. Rex geändert und ein selbstbetiteltes Album veröffentlicht, als wollten sie damit auf den Neustart hinweisen. T. Rex stand mit einem Fuß noch im Underground, aber der andere schritt mit vollstem Selbstvertrauen in Richtung Top of the Pops. Auf »Seagull Woman« und »Beltane Walk« ist der klassische T.-Rex-Sound bereits da: Die Grooves stolzieren, die Blues-Riffs sind opulent, die Refrains reiner Zucker. Doch auf dem Album gibt es auch Songs wie das unheimliche »The Children of Rarn«, ein Fragment aus Bolans nie realisiertem Konzeptalbum/-buch über die prähistorische Erde und Ur-Rassen mit Namen wie Dworns oder Lithons. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen (präziser Pop und ausufernder Acid Rock) lag Bolans Remake seiner allerersten Single »The Wizard«. Die neue Version klingt, als hätte sie Chart-Potential, bis sie in einen abgehackten, dilettantischen Groove übergeht, zu dem Bolan in Endlosschleife skandiert »He was a wizard and he was my friend he was«, bis daraus schwerverständliches Gekläffe wird. Es sind mitreißende Abschiedsworte an den Underground.
Das Jahr 1970 wird oft als Pause beschrieben: die Ruhe vor dem Glam-Sturm. Die Musikwelt trat auf der Stelle, die meisten großen Bands hatten sich entweder gerade erst aufgelöst (manche dieser »Scheidungen« wurden durch Hochzeiten ausgelöst, etwa bei den Beatles) oder befanden sich auf dem absteigenden Ast. Supergroups wie Blind Faith, die die Rollen dieser Bands einnehmen sollten, fehlte es zu sehr an der organischen (weil zufälligen) Gangmentalität der Vorläufer, um ernsthafte Alternativen zu bieten. Im Lauf des Jahres machte sich Ungeduld breit. Das neue Jahrzehnt sollte endlich beginnen – und mit ihm ein neuer Sound, der mit den schalen Ideen und starren Idealen der vergangenen Dekade aufräumen würde wie mit alten Essensresten im Kühlschrank.
In Großbritannien waren es T. Rex, die den Startschuss für die neue Pop-Ära gaben.
Irgendwo zwischen A Beard of Stars und T. Rex drehte Bolan seine Einstellung gegenüber Singles komplett um und entschied, dass sie keine kommerziellen Ablenkungen seien, sondern »Energie-Ausbrüche«, Flugblätter, die ihre Nachricht in die Welt trugen, um »die Leute auf den Geschmack zu bringen«. ZigZag gegenüber erklärte er: »Ich sehe keinen Grund, warum die Freaks nicht in den Charts repräsentiert werden sollten.« Eine innere Unruhe hatte dieses Umdenken angestoßen. Sein Ego brauchte eine größere Bühne als die, die ihm eine bloße Kultanhängerschaft bieten konnte. Es gab aber auch einen Faktor von außerhalb: Rock ’n’ Roll war auf den Popmarkt zurückgekehrt. Bolans Antenne hatte registriert, in welche Richtung die Popkultur als nächstes ausschlagen würde und wie und wo er sich dafür positionieren musste.
Ein Beispiel für den Proto-Glam-Sound war Norman Greenbaums »Spirit in the Sky«, ein glorreicher unbeschwerter Stomper, der Anfang 1970 den ersten Platz der UK-Charts erreichte. Etwa zur gleichen Zeit landete John Lennon mit »Instant Karma!« auf beiden Seiten des Atlantiks einen Top-5-Hit. Lennon hatte Phil Spector um einen 1950er-Sound gebeten, doch der Produzent hatte Alan Whites harte Drums im Mix viel weiter vorne platziert, als es in der Rock-’n’-Roll-Ära akzeptabel (oder überhaupt möglich) gewesen wäre. »Instant Karma!« und das Spector-produzierte Solo-Album John Lennon/Plastic Ono Band, das im selben Jahr erschien, »haben mich unglaublich inspiriert«, gab Bolan später zu. »Der Drum-Sound …« Und dann war da noch Mungo Jerrys »In the Summertime«, ein altmodischer Schrammel-Along mit zitterndem Gesang, nicht unweit von Bolans eigenem. »Summertime« wurde in 19 Ländern zu einem Nummer-eins-Hit. In Großbritannien verbrachte der Song sieben Wochen an der Spitze der Charts. »Es ärgerte Marc sehr, dass Mungo Jerry mit seiner Stimme eine Nummer Eins gelandet hatte«, sagt Napier-Bell. »Das war der Moment, als er merkte, dass er keine Minute mehr warten konnte.«
»Gerade beschäftige ich mich viel mit den 1950ern […]. Das Feeling der 1950er ist sehr wichtig«, sagte Bolan dem NME ein paar Jahre, nachdem er Popstar geworden war. Dieses »Feeling« war schon immer Teil seiner DNA, selbst bei Tyrannosaurus Rex, doch es wurde von den geselligen Hippies und ihren Akustikgitarren überdeckt und kam nur hier und da mal in Songs wie »Hot Rod Mama« oder »One Inch Rock« zum Vorschein. Sobald er sich eine E-Gitarre umgeschnallt hatte, kam seine Liebe für Eddie Cochran, Chuck Berry, Ricky Nelsons Gitarristen James Burton und andere wieder zum Vorschein. Wenn man will, kann man die Songs von T. Rex in ihre Einzelteile zerlegen und die Riffs zu ihren Ursprüngen in Songs von Little Richard, Chuck Berry, Howlin’ Wolf, Jimmy McCracklin etc. zurückverfolgen. Manchmal baute Bolan auch Zitate ein, die auf den Song verwiesen, von dem er sich hatte inspirieren lassen. Die Zeile »Meanwhile I’m still thinking« während dem Fade-out von »Get It On« etwa verweist auf Berrys »Little Queenie« und »Telegram Sam« zieht mit der Zeile »I’m a howlin’ wolf« seinen Hut vor »Smokestack Lightning«.
Das Endprodukt klang jedoch nicht einfach nur nach einer – genau studierten – Kopie. T. Rex waren zwar Rock ’n’ Roll, aber verwoben mit allem, das ihm bis dahin historisch gefolgt war: die halluzinogene Englishness von »Strawberry Fields Forever« und »See Emily Play«, die folkadelische Stimmung von Donovans »Jennifer Juniper« und The Incredible String Bands The Hangman’s Beautiful Daughter.
In Bolans Lyrics, die fortan an Wortgewalt verloren, fand sogar eine Fantasy-Version der 1950er Einzug. »Viele glauben, dass ich kein Poet mehr sei, nur weil ich mich von langen, visuellen Beschreibungen verabschiedet habe«, beschwerte er sich gegenüber ZigZag. »Aber was ich jetzt schreibe, ist tatsächlich Poesie von Herzen.« Die Altertümlichkeit machte nun Platz für Science-Fiction (die fliegende Untertasse in »The Planet Queen«). Mehr noch aber lag der neue Fokus auf der amerikanisierten Gegenwart nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie Glam-Experte Philip Auslander beobachtet hat, hatte Bolan schon immer eine Vorliebe für Autos (»Mustang Ford«, »Hot Rod Mama«), die Tolkien missbilligt hätte – bei Tyrannosaurus Rex hatte er seine romantischen Eroberungen noch mit exotischen Tieren verglichen. Bei T. Rex beinhaltete der Lobgesang Zeilen wie »Like a car you’re pleasing to behold« (»Jeepster«) und »You’re built like a car / You’ve got a hubcap diamond star halo« (»Get It On«). In »Children of the Revolution« erfand er ein Vierteljahrhundert zu früh den Bling*, wenn er prahlt: »I drive a Rolls-Royce / ’cos it’s good for my voice.«
»Ride a White Swan«, der erste Hit von T. Rex, hat die Hippie-Ära noch nicht gänzlich hinter sich gelassen: Der Wagen, um den es geht, wird von Flügeln angetrieben statt von einem Verbrennungsmotor und im Text tauchen Druiden auf. T. Rex sendeten verwirrende Signale. Sie gingen auf eine große Tour mit Ticketpreisen zu gerade mal 50 Pence, um finanziell nicht gut gestellte Teenager anzuziehen, und doch wurden sie in den Werbeanzeigen als »letzte der großen Undergroundbands« angekündigt. Aber anders als zu Tyrannosaurus-Rex-Zeiten – als Bolan die Beine übereinanderschlug – bewegte sich der Sänger nun rhythmisch zum Groove, den die neu hinzugefügte Rhythmusgruppe aus Steve Currie (Bass) und Bill Legend (Schlagzeug) lieferte, über die Bühne. Obwohl »Ride a White Swan« noch vor dem Eintritt der neuen Bandmitglieder produziert worden war, eignete sich der Song perfekt für die Tanzflächen der Diskotheken. Langsam aber stetig stieg die Single in den Charts auf, bis sie es schließlich Ende Januar 1971 auf Platz zwei geschafft hatte. Die Spitzenposition war von der sentimentalen Novelty-Single »Grandad« von Clive Dunn und einem Mädchenchor besetzt.
Doch bald würden diese Tweenies in Richtung Marc Bolan kreischen, der zum ersten echten Pop-Idol des neuen Jahrzehnts wurde. Den entscheidenden Schlag dafür lieferte im Februar 1971 »Hot Love«. Bemerkenswert dabei: Im Kern war es ein zwölftaktiger Blues. »Ich wollte aus einem Zwölftakter einen Hit machen, was eigentlich seit ›Hi-Heel Sneakers‹ [1964 erschienene Single von Tommy Tucker – Anm. d. Ü.] niemand mehr gemacht hat«, sagte Bolan ZigZag. Er behauptete, »Hot Love« zu schreiben, habe nur zehn Minuten gedauert: »Eines nachts haben wir sehr viel getrunken, so vier Flaschen Brandy, es war 4 Uhr morgens. Und dann schrieben wir einfach.« Der Song war zumindest simpel; der honigsüße Glanz, den Produzent Visconti dem Song verpasst hatte, und die feinen Details des Arrangements aber waren alles andere als Wegwerfprodukte. »Hot Love« war die erste Bolan-Nummer mit Hintergrundgesang von Howard Kaylan und Mark Volman, vormals bei den Turtles und später, als Flo & Eddie, Kollaborateure von Frank Zappa and The Mothers of Invention. Mit ihrem schmachtenden und überzeugenden Gesang verliehen sie dem T.-Rex-Sound einen cremigen Touch, der im langen »Hey Jude«-mäßigen Fade-out von »Hot Love« in schwindelerregende Höhen getrieben wurde.
Von seinem bluesigen, dahintuckernden Groove bis zum vage in Richtung Doo Wop schielenden Hintergrundgesang hatte »Hot Love« nichts essentiell Neues zu bieten. Und doch ist alles daran neu – oder zumindest frisch: das Gefühl, die Leichtigkeit. Das geht teilweise auf Viscontis Produktion zurück, liegt aber vor allem an Bolans Präsenz und Persönlichkeit, mit der er bewies, dass man originell sein kann, ohne in nachvollziehbarer Weise innovativ zu sein. Talent leiht, Genie stiehlt.
Als Blues ohne Testosteronüberschuss zielte »Hot Love« vor allem auf die gerade aufkommende Sexualität von Mädchen im Alter zwischen elf und fünfzehn. Bolan spielt einen Vasall, der mit seiner soften Stimme als Gentleman durchgehen könnte, einen »Arbeiter der Liebe«, der so schamhaft flirtet, wie es nur geht: »I don’t mean to be bold but may I hold your hand?« Wenn er die Titelzeile ausspricht, klingt es, als wäre er derjenige, der sich vor Liebe aufgibt. »Hot Love« ist auch der Song, in dem er erstmals sein Repertoire an schweren Atemzügen und gemurmelten Stöhngeräuschen zur Schau stellt, die den Mädchen bei seinen Auftritten dann die größten Kreischer entlockten.
Um den Teeniemarkt erfolgreich zu verführen, war sein neues feminines Aussehen von besonderer Bedeutung: Satin-Jacken, Federboa-Schals, ein Pelzmantel, den er sich von Junes Mutter ausgeliehen hatte und – für die Auftritte bei Top of the Pops, die die ganze Glam-Ära einläuten sollten – ein Tupfen Glitter auf den Wangenknochen. Darüber, wer diese schlaue Idee hatte, herrscht Uneinigkeit: War es June? Chelita Secunda, die Ehefrau seines neuen Managers? Oder ein plötzlicher Impuls von Marc selbst? Bolan-Experte Dave Mantell nennt die zweite »Hot Love«-Performance bei Top of the Pops jedenfalls den Wendepunkt. Bolan trug einen »glänzenden, silbernen Matrosenanzug […] aus Samtstoff, der aber aussah wie Satin oder sogar Lamé« mit »tiefem Ausschnitt«, und fing während des Auftritts immer wieder an »zu kichern wie ein Mädchen«. Während Bolan im langen la-la-la-la-la-la-la-Outro seinen Schal in der Luft schwang, tanzten Mädchen aus dem Publikum auf der Bühne. Dieses Bild überlagerte das des silbern gekleideten, lächelnden Schönlings – und besiegelte Bolans Identifikation mit seinem neuen Publikum symbolhaft.
Bolan wusste, dass sein Look – und gutes Aussehen generell – eine große Rolle in der Übergangsphase von T. Rex spielte. Er hatte verstanden, dass Pop – anders als Rock – als audiovisuelles Phänomen funktioniert, das junge Fans als einen einzigen Lichtstrahl an Empfindungen wahrnehmen. Was davon Bild ist, was Sound und was Worte, können sie nicht voneinander trennen. »95 Prozent meines Erfolgs kommen durch mein Aussehen«, sagte er Creem und fügte hinzu, dass es bei den Beatles oder den Stones auch nicht anders gewesen sei, so sehr sie nun auch behaupteten, dem Pop-Publikum entwachsen zu sein. Aussehen und Präsenz seien, »was das Aufsehen der Leute erregt. Die Musik ist sekundär. Man muss zwar auch gute Musik machen […], aber letzten Endes hat es nichts mit Musik zu tun.«
Und doch: Wenn man sich Live-Aufnahmen von T. Rex auf der Höhe ihres Erfolges ansieht, etwa die großen London-Konzerte im Frühling 1972, ist es bemerkenswert, wie wenig theatralisch und glitterfrei sie im Vergleich zu späteren Glam-Stars oder den durchschnittlichen Popkünstlern im 21. Jahrhundert aussehen. Es gibt kein Bühnenbild oder Requisiten, abgesehen von einem lebensgroßen Papp-Marc am Rand der Bühne. Die Belichtung ist schwach und der Rest der Gruppe sieht ziemlich ungepflegt aus. Sogar Bolans Glam beschränkt sich auf eine Satinjacke und einen fedrigen Schal.
Beim Megakonzert im Wembley-Stadion spielen T. Rex wie eine zusammengewürfelte Garagenband, die ihre Songs gerade noch so zusammenhalten kann. Bolans Tänze und Sprünge sind nicht choreografiert, sondern basieren schlicht auf seinem angeborenen Funk und einem Talent dafür, sich Bewegungen von seinen Vorgängern abzuschauen: Chuck Berrys Entengang, die Gitarren-schwingenden Gesten von Pete Townshend und Jimi Hendrix. Seine einzige echte »Routine« war, einen Schellenkranz auf seinem Griffbrett zu reiben, eine Menge Lärm zu erzeugen und ihn dann über den Gitarrenhals ins Publikum zu schleudern. Eine Darstellung von Masturbation, mit dem in die Menge geworfenen Schellenkranz als Platzhalter für das Ejakulat.
Bolans androgyner Kleidungsstil (er war klein genug, um Frauenschuhe zu tragen) ließen Fragen über seine Sexualität aufkommen. Viele Gerüchte machten die Runde – etwa dass er nach einer Geschlechtsumwandlung Percussionist Mickey Finn heiraten wolle, der selbst sehr feminin war mit seinem langen dunklen Haar, schmalem Körperbau und edler Blässe. Bolan gefiel die Verwirrung, die seine Ambiguität stiftete. In einem Interview erzählt er, wie ihn im Speakeasy Club Mädchen darauf ansprachen, ob er denn »eine Schwuchtel« sei. Er nickte und fragte, ob sie denn »kleine Brüder zu Hause« hätten. Mit einem hämischen Grinsen spielte er den Journalisten die entsetzten Reaktionen der Mädchen vor.
Im März 1970 sprach er mit ZigZag über seinen unbeschwerten Umgang mit Homosexualität und seine eigene Neugier auf Bisexualität: »Ich glaube, alle sollten lieben, was sie lieben, und ich mag die Vorstellung sehr, wie zwei Krieger in die Schlacht ziehen und sich geistig sehr nahe sind. Sie haben jetzt nicht tatsächlich auf dem Schlachtfeld gevögelt, aber innerlich standen sie total aufeinander.« Später, in der Dämmerung seines Daseins als Idol, spezifizierte er seine Sexualität, als er dem Record Mirror gegenüber bekannte, er sei »bisexuell, aber ich glaube eher heterosexuell, denn ich steh definitiv auf Brüste. Ich hab mir immer gewünscht, 100-prozentig schwul zu sein, das ist viel einfacher […]. Wie gesagt, ich hab alles ausprobiert, aber Frauen sind mir lieber.«
Sex und sein öffentliches Äquivalent Tanzen haben bei Tyrannosaurus Rex nie eine große Rolle gespielt. Für T. Rex hätten sie kaum wichtiger sein können. Gegenüber dem NME erklärte er den Abgang Steve Tooks und T. Rex’ neue tanzbare Ausrichtung: »Ich war schon immer ein kleiner Tänzer […]. Der Split mit Peregrin kam tatsächlich teilweise daher, dass ich Boogie tanzen wollte.«
»Boogie« war das Wort der Stunde. Marc beschrieb seine Songs als »boogie mind poems«, Boogie-Gedichte für den Kopf, und der T.-Rexploitation-Film hieß Born to Boogie. Das Wort hat eine lange Geschichte. Es lässt sich auf Boogie-Woogie zurückführen, einen Piano-lastigen Blues-Stil, zu dem Anfang des 20. Jahrhunderts getanzt wurde. Boogie-Woogie drang bis in die verschiedensten Bereiche amerikanischer Pop- und Volksmusik vor, von den Andrew Sisters bis zu John Lee Hooker, dessen »Boogie Chillen« leicht der Song gewesen sein könnte, durch den Bolan damit in Kontakt kam. Obwohl viele glauben, das Wort hätte dieselbe undurchsichtige etymologische Vergangenheit wie der »boogeyman« [Schreckgespenst – Anm. d. Ü.], gibt es eine alternative Theorie, die ins von den Franzosen kolonialisierte Louisiana und zu dem Wort »bouger« führt, das so viel bedeutet wie »sich bewegen«. Ein reizender Gedanke, bedenkt man das Zweitleben, dass Boogie in den 1970ern und 1980ern als Disco-Schlagwort führte: »Boogie Nights«, »Blame It on the Boogie«, »Boogie Wonderland« …
Wie es die Ironie so will, war Boogie Anfang der 1970er alles andere als Glam. Seine Vertreter waren Bands wie Humble Pie, verschwitzte Typen aus Großbritannien, die in Amerika in großen Stadien spielten und deren Debüt-Single »Natural Born Bugie« Platz vier der UK-Charts belegte. Canned Heat, bärtige amerikanische Bluesstudenten, nahmen »Refried Boogie« auf, das aus einem einzigen, über vierzig Minuten langgezogenen Riff besteht und beide Seiten einer Platte der Doppel-LP Livin’ the Blues ausmacht. Obwohl Boogie technisch gesehen als Vierviertelrhythmus definiert wird, den man in zwölf statt sechzehn Töne unterteilt, erkennen ihn die meisten Hörer durch ihr Gefühl: seine Verbindung aus (traditioneller) Black Music und Swing, sein synkopierter Shuffle. Boogie war Rock, zu dem man tanzen konnte, und übte damit einen besonderen Reiz aus, als ein Großteil der Rockmusik zu ausgeklügelt oder entspannt wurde. In Amerika wurde »Boogie!« zum Schlachtruf der Jeans-bedeckten Stadionrock-Horden mit Bierflasche in der einen Hand und Quaaludes in der anderen.
Indem er den tollpatschigen Heterosexismus der Boogiebauern links liegen ließ, machte sich Bolan den Begriff zu eigen. Nun war er aufreizend besetzt, fast schon androgyn und elegant. Sein schönster Boogie war »Get It On«, die Nummer-eins-Single, die auf »Hot Love« folgte. Dieses feine Riff aus dem Handgelenk, darunter die hämmernde Unterstützung eines Bläsersatzes; dieser Refrain im Schatten der geisterhaften Backingvocals; die unsterbliche Zeile »You’re dirty sweet and you’re my girl«. Um einen anderen Song zu finden, der erotisches Verlangen und zarte Verträumtheit derart perfekt balanciert, muss man sich komplett vom Rock abwenden. Diese Kombination findet man stattdessen in den Songs Al Greens oder bei Marvin Gaye zu »Got to Give It Up«-Zeiten.
Die ungewöhnliche Mischung aus scharfem Schnitt und elfenhafter Zartheit erstreckt sich über beide Seiten von Electric Warrior, dem zweiten T.-Rex-Album – bei weitem Bolans bestes Werk, eine nahezu perfekte Platte. Auch wenn Bolan auf dem dunklen, unheilvollen Cover mit seiner Gitarre neben einem Verstärker steht, ist es kein hartes Album. E-Gitarren werden darauf sogar eher spärlich eingesetzt. Tracks wie »Planet Queen« und »Cosmic Dancer« verbindet eher ein eigenartig lockerer Sound. Das Schlagzeug, die abgehackte Akustikgitarre, der ausschweifende Basslauf und die Streicher sorgen für den Drive, aber das Fehlen eines antreibenden zentralen Riffs vermittelt den Eindruck einer leeren Fläche.
»Cosmic Dancer« ist eine Mischung aus Autobiografie und Philosophie: »I danced myself right out the womb / Is it strange to dance so soon?« Statt eines mystischen Knittelverses hat es ein vorzügliches Gitarrensolo, das ausbricht und wieder eingefangen wird wie eine rückwärts abgespielte Videoaufnahme von Zigarettenrauch. »Life’s a Gas« ist Marcs Manifest des »ewigen Jungen«. Schelmisch übergeht er alle Spaßverderber, all diese meckernden Verbündeten des Realitätsprinzips. Wie »Hot Love« (nur im Balladentempo) ist »Life’s a Gas« ein Blues-ohne-den-Blues, sein Höhepunkt erneut ein umwerfend schönes Gitarrensolo, das in der Welt nichts finden kann, das ihm Sorgen bereiten würde.
Electric Warrior hat aber auch seine vulgären Seiten. »Jeepster« besteht aus sexy Nonsense und Liebespoesie: »You’ve got the universe reclining in your hair.« »Jeepster« wurde nach »Get It On« als zweite Single ausgekoppelt und ebenfalls ein großer Hit. Die meisten von Bolans großen Singles waren an eine angebetete Frau gerichtet, eine Rolle, in die sich jedes Mädchen hineinversetzen konnte. Er lenkte seine Aufmerksamkeit sehr zielgerichtet auf die »95 % unseres Publikums« (seine eigene Schätzung), die weiblich waren, deren Sexualität gerade erwachte und die auf der Suche nach einem erotischen, aber unbedrohlichen Fantasieobjekt waren. »Motivation« im Sinne von »Turn-on« zu deuten, war einer seiner liebsten sprachlichen Kniffe, etwa in der Zeile »Your motivation is so sweet« in »Jeepster« oder »The Motivator«, dessen Titelfigur verkündet: »I love the clothes you wear«, darunter ein »velvet hat […] the one that caused a revolution«.
»Revolution« ist zwar etwas hochgegriffen, aber der Wahn, den Marc auslöste, hatte durchaus etwas Aufrührerisches. »Die Rückkehr des Idols der Kreisch-Ära«, schrie es vom Cover des Melody Maker vom 20. November 1971. Die Überschrift des dazugehörigen Artikels: »Prophet einer neuen Generation«.
Experten eilten schnell herbei, um Bolan als den »Nachfolger der Beatles« auszumachen, von dem die Musikindustrie seit Jahren geträumt hatte. Besonders 1969/1970 war diese Suche schmerzhaft, als Single-Verkäufe in ein Rekordtief fielen und das Album ihren Platz einnahm. Die Industrie fürchtete, Teenager würden das Interesse an Popmusik gänzlich verlieren, wenn nicht bald jemand Neues käme, um ihren Durst nach purer Aufregung, sofort zündenden Singles, tanzbaren Beats und visuell stimulierenden Helden, die sie begehren oder mit denen sie sich identifizieren können, zu löschen. Als Leute wie der Promoter Tony Smith die Stones und die Beatles anführten, wenn sie Bolan dafür priesen, dass er »eine komplett neue Generation junger Kids« anspräche, »deren Durchschnittsalter um die 15 liegt, wenn nicht jünger«, geschah das aus Begeisterung und Erleichterung.
Die Statistik bekräftigt den Vergleich mit den Beatles. In ihrem ersten großen Erfolgsjahr entsprachen T. Rex’ Verkäufe 3,5 Prozent des britischen Musikmarktes. In diesem Jahr hatten sie drei Nummer-eins-Alben: Electric Warrior, die Compilation Bolan Boogie und eine Neuauflage der ersten beiden Tyrannosaurus-Rex-LPs als Doppelalbum. Vor ihnen hatten das nur – wer hätte das gedacht – die Beatles geschafft. Ein weiteres Beatles-Echo war der nachträgliche Erfolg von Bolans Gedichtband The Warlock of Love, von dem plötzlich 20.000 Exemplare verkauft wurden. Das weckte Erinnerungen an Lennons Bestseller In His Own Writings von 1964. Bald war Bolans Einfluss sogar groß genug, um seine eigene Apple-ähnliche Plattenfirma zu gründen, das EMI-Sublabel T. Rex Wax Co. (anders als bei Apple wurden dort aber nie andere veröffentlicht als Bolans eigene Platten).
Was aber noch erfreulicher war: Lennon und McCartney nannten Bolan einen würdigen Nachfolger. Lennon hielt T. Rex für »guten Rock ’n’ Roll: Es hat einen guten Beat und es swingt.« Bolans Wortgewandtheit fand er besonders lobenswert: »Seine Art zu schreiben ist neu und ich hab noch nie Texte gelesen, die so witzig und echt sind wie seine.« Ringo Starr wurde ein Busenfreund Bolans, bei dem er sich ein paar Tricks für seinen Solo-Hit »Back Off Boogaloo« abschaute. Er führte auch Regie beim ersten T.-Rex-Film Born to Boogie. Die Wembley-Konzerte 1972 lieferten ein symbolisches Bild für den Generationenwechsel: Die kreischenden Fans ignorierten Starr vollkommen, während er im Bühnengraben stand, um die Show zu filmen.
Die größte Parallele zwischen T. Rextasy und Beatlemania war die Leidenschaft der Fans. Die Leute, die an Bolan glaubten, imitierten sogar seinen Look: die Haare, die Kleidung, das Augen-Make-up, den Glitter und die Goldsterne an den Wangenknochen.
Wie hatte Bolan das hingekriegt? Warum er? Ganz nüchtern betrachtet war er ein seltsamer, ziemlich beschränkter Sänger, gemessen an den Standards seiner Zeit ein mittelmäßiger Gitarrist, ein manchmal beseelter, aber unbeständiger Songwriter und Texter. Aber er hatte »es«, das gewisse Etwas, nach dem die Unterhaltungsindustrie ständig sucht, die Starqualität, die die Industrie kontrollieren, vermarkten und ausbeuten, aber nicht aus der Luft herbeizaubern kann. Tony Visconti schrieb Bolan die größte persönliche Anziehungskraft zu, die ihm je untergekommen war: »Licht strömte aus ihm heraus.« Er hatte Charme im Überfluss, ein Wort, das heute einfach nur Attraktivität bezeichnet, aber einen magischen Subtext besitzt. Er hatte ein tolles Lächeln: Es war so cartoonhaft breit, dass es in beiden Ecken seines Mundes zu funkeln schien und schwankte genau richtig zwischen Charme und Schleim. Dass Bolan sich dessen bewusst war, tat dem keinen Abbruch.
George Melly besteht in Revolt into Style, seiner 1970er-Geschichte der »Pop-Künste«, darauf, dass Magie viel wichtiger sei als Talent: »Magie lässt sich präziser als ›Charisma‹ umschreiben, eine Art magischer Aura, die von bestimmten Objekten, Menschen oder Orten ausgeht und ihnen eine Macht gibt, die über ihre nachvollziehbaren Qualitäten hinausgeht.« »Charisma« ist selbst ein Wort, das heutzutage geradezu entwertet worden ist. Es ist so nichtssagend wie »ikonisch«. In seiner ursprünglichen Bedeutung war es aber durch und durch geheimnisvoll. Es geht bis auf die antiken Griechen zurück (»charis« bedeutet Anmut, Schimmer, ein göttliches Geschenk). Als religiöses Konzept wurde es circa 50 n. Chr. durch Paulus von Tarsus definiert. Charisma konnten talentierte Prediger oder Wunderheiler haben, jemand mit besonders ausgeprägten sprachlichen Fähigkeiten. Doch auch die Gemeinden selbst, die in den frühen Tagen der christlichen Kirche noch aus Außenseitern anstelle der hierarchischen Bürokraten wie in den folgenden Jahrhunderten bestanden, konnten es besitzen. Man könnte argumentieren, dass Charisma dieser Art – ein Bewusstsein, das kollektiv geteilt wird – einen »Vibe« darstellt, der in jeder kultischen Gruppe entsteht, die eine randständige Weltanschauung und ein von der Mehrheit abweichendes Wertesystem miteinander teilt.
Zwei Konzerte im Wembley-Stadion in der Nacht vom 18. März 1972 markierten den Höhepunkt der T. Rextasy. Ringo Starr – anwesend, um Born to Boogie zu filmen – wird erstmals unbeteiligter Zeuge einer Faneuphorie von Beatles-Ausmaß.
Bolan selbst benutzt den Begriff in diesem Sinne, wenn er an seine Mod-Phase Mitte der 1960er zurückdenkt. »Diese Zeit hatte großes Charisma«, sagte er dem NME 1972. Charismatische Energie ging von einem Kult aus und wurde dann auf eine zentrale Figur projiziert: Zuerst kamen die Mods, dann Mod-Bands wie The Who und Small Faces. Wieder und wieder lässt sich dieser Prozess in den verschiedensten Subkulturen beobachten, von Rock bis Rave: Das Volk (eine bestimmte Gruppierung, nicht die allgemeine Öffentlichkeit) hat die Macht, gibt diese aber freiwillig an Anführer aus ihren eigenen Reihen ab.
Nach Len Oakes, dem Autor von Prophetic Charisma, hat der typische Kandidat für die Rolle als Kultführer eine narzisstische Persönlichkeit, die »riesiges Selbstvertrauen« mit enormer Energie, der Fähigkeit zu Verführung und Manipulation sowie auffällig wenigen Selbstzweifeln vereint. Okay, das klingt nach den meisten Popstars beziehungsweise nach so ziemlich jeder und jedem, die etwas mit den darstellenden Künsten zu tun haben. Aber wenn Oakes die Wesenszüge von charismatischen Sekten auflistet – ganze Gemeinden, die in Ekstase verfallen, Hemmungslosigkeit, Hände in der Luft, sich schüttelnde Menschen, die in Ohnmacht fallen; Gläubige, deren Körper von »grauenhaftem Zittern« erfasst werden, schreien und brüllen –, klingt das verdächtig nach Rock ’n’ Roll, Disco, Rave und anderen Ausbrüchen begeisterter Tanzkultur. Man sehe sich nur die Bilder von Born to Boogie an: Mädchen (und hier und da ein Junge), die sich schütteln und wenden, so stark schreien, dass man die Zahnfüllungen und die Speichelfäden in ihrem Mund sehen kann, Hände, die sich nach ihrer Gottesfigur strecken. Das ist Religion, und zwar ganz klassische.
Manchen Beobachtern fiel dieser Wiedergeburts-Aspekt der T. Rextasy schon damals auf. Tony Tyler vom NME sprach von der »fast hypnotischen Kontrolle«, die Bolan bei Auftritten über seine Fans hatte. »Für tausende Rexmaniacs, die sich sicher fühlten in ihrem fundamentalistischen Glauben, brannte [die T. Rextasy] mit der Inbrunst einer religiösen Erfahrung. Eine dionysische Frühlingsweihe, zu der sie alle strömten, um ihre Opfer darzubieten.« Dieser Wahn konnte gefährlich werden. Im Boston Gliderdrome, ein 6.000 Menschen fassender Konzertsaal in Lincolnshire, wurden 33 Fans ohnmächtig. Ein Mädchen musste ins Krankenhaus, wobei sich die Berichte darüber uneinig sind, ob sie in der Aufregung vom Balkon gestürzt oder ein Scheinwerfer auf sie gefallen war.
Sofort entstand um die Hysterie eine Ausbeutungsindustrie. Es gab T.-Rex-Merchandise jeder Art. Der offizielle Fanclub hatte 6.000 Mitglieder und erhielt wöchentlich Tausende von Briefen, von denen viele grauenhafte Gerüchte ansprachen, die Popidole für gewöhnlich umgeben: »Stimmt es, dass Marc an Leukämie oder einer Nierenerkrankung stirbt?« In einem Bolan-Porträt liest June aus einem Fanbrief vor: »Ich würde für dich / mit dir / dir alles (an)tun. Lösch einfach, was nicht zutrifft. Bitte schick mir Essen, abgeschnittene Nägel, Klamotten oder irgendwas, das du angefasst hast.«
»Gibt es irgendwo in Britannien einen Anti-T.-Rex-Fanclub?«, fragte Gerald Levy aus Middleton, Lancashire, in den Leserbriefen des Melody Maker Anfang 1972. Musikmagazine waren voll von Lesermeinungen contra oder pro Bolan. Die Aufregung rührte auch daher, dass es kaum mehr eine Woche gab, in der nicht irgendeine Bolan-Story die Runde machte (selbst sein Pressesprecher BP Fallon bekam sein eigenes Porträt). Andere Beschwerden kamen aus dem Prog-Rock-Lager, das sich über seine »banalen Akkordfolgen« aufregte und ihn als »das größte Desaster, das je die britische Popmusik heimgesucht hat«, beschrieben weil er »den kompletten Fortschritt und Reifungsprozess der letzten Dekade« eigenhändig rückgängig gemacht habe. Und dann gab es natürlich noch die alten Tyrannosaurus-Rex-Fans, die sich wünschten, er würde wieder über Runen und Rarn singen. Die International Times machte sich zum Sprachrohr der verbitterten Herde, als sie auf der Titelseite fragte: »Bolan – wer braucht ihn schon?«
1972 war T. Rextasy auf ihrem Höhepunkt angelangt: riesengroße Konzerte, mehrere Singles auf Platz eins und zwei der Charts, die Veröffentlichung von Born to Boogie. Ende des Jahres machte sich Ermüdung breit. Im Fall Bolans selbst war es kreative, psychische und physische Erschöpfung. Doch auch der Gipfel des Phänomens T. Rextasy war nun erklommen und der Abstieg stand bevor.
»Metal Guru« – Nummer Eins im Mai 1972 – war in mancher Hinsicht der ultimative T.-Rex-Song: ein Jingle, dessen Strophe-Vers-Schema sich endlos in einem Strudel von Karamell und krankhaft-süßem Sound wiederholte. Aber er war auch der erste Hinweis darauf, dass Bolan das Material ausging. Wie Musikkritiker Neil Kulkarni anmerkt, scheint sich Bolan die Frage »Metal guru / Is it you?« selbst zu stellen, um seine Eignung als Anführer einer Generation beurteilen zu können. In Interviews machte er vage Angaben darüber, dass der Song von einer »Gottesfigur« und Isolation handle. Außerdem, behauptete er, arbeite er an einem Drehbuch über das Konzept eines »kosmischen Messias […], ein Nachrichtenbote Gottes, der nach dem Planeten Erde sehen muss […]. Gott ist auf den Planeten seit [Eden] nicht mehr zurückgekehrt. Er erwartet eine Gottesrasse, doch was er vorfindet, ist eine Katastrophe.«
»Metal Guru« ist der Schlüsselsong auf The Slider. Bolan prahlte, dass das Album einen Sound hätte, der »sich komplett von dem unterscheidet, was wir bisher gemacht haben […], softer, aber härter. Wie feste Flüssigkeit.« Aber abgesehen vom erotisch-lässigen Titeltrack und der bereits Anfang des Jahres erschienenen Single »Telegram Sam« war es durchwachsen. In den britischen Album-Charts kam es über den vierten Platz nicht hinaus – ein beunruhigendes Zeichen.
Ironischerweise veröffentlichte Bolan genau dann drei der originellsten und am unterschiedlichsten klingenden T.-Rex-Singles, als Fans und Kritiker anfingen, ihm vorzuwerfen, er würde sich wiederholen und sich selbst kopieren. Die Lyrics bestanden zwar aus weiteren Hinweisen auf seinen Messiaskomplex, doch musikalisch war »Children of the Revolution« viel langsamer als seine vorherigen Hit-Singles. Der von Streichern vorangetriebene, schlingernde Groove machte aus der Nummer eine Art Bubblegum-Vorläufer von Led Zeppelins »Kashmir«.
Die nächste Single beschrieb der Künstler als »sehr schnellen Rockaboogie«. »Solid Gold Easy Action« war der Missing Link zwischen Captain Beefhearts »Sun Zoom Spark« und »Bits and Pieces« von The Dave Clark Five: einem schrillen Sägezahn-Riff folgt ein aufrüttelnder »Hey! Hey! Hey!«-Sprechchor zu Bum-bum-bum-Beats, dann ein Bo-Diddley-Shuffle, gefolgt von einem Refrain, der so süßlich ist, als würde man sich Schwarzwälder Kirschtorte ins Ohr stopfen.
Dann kam »20th Century Boy«, Bolans punkigstes Statement überhaupt. Diese Single beschrieb er als »Erektionsrock […], eine Aufnahme reiner Energie […]. Teile des Textes zitieren Muhammad Ali […]. Ich glaube, dass jeder Mann im 20. Jahrhundert ein Superhengst ist und die Platte ist für ihn.« Der Song quillt von fast schon parodistischen Machismen geradezu über. Bolans Gesang könnte nahezu als Rap durchgehen. Er gibt Zeilen wie »sting like a bee« von sich, bietet sich aber immer noch als Spielzeug an (»I wanna be your toy«). Die rauchigen weiblichen Soul-Backings erinnern an Merry Clayton auf »Gimme Shelter«. »20th Century Boy« tritt die Türe sofort mit einem lauten Riff ein und bewegt sich dann in ein Stooges/Fun House-mäßiges Durcheinander aus kreischendem Saxophon, geschlagenem Rhythmus, Schellenkranz und fast schon gegurgelten Vocals von Bolan: eine absurde Karikatur von Bedrohlichkeit, die dennoch etwas Verstörendes hat.
Ein paar Jahre bevor die T. Rextasy losbrach, argumentierte George Melly, dass unter dem erotischen Rausch des Teen-Fan-Wahnsinns ein primitiver religiöser Impuls läge: »Während der Geschichte ist religiöser Enthusiasmus dieses Ausmaßes von sexueller Hysterie oft nicht zu unterscheiden. Ebenso rätselhaft ist das plötzliche Aussterben der gefährlichen Göttlichkeit eines Künstlers oder einer Gruppe […]. Die Schreie verstummen, die Menge löst sich auf […].« Melly hat Recht in Bezug auf die Willkür hinter den Niedergängen von Popidolen, aber im Fall Bolans gibt es ganz banale Gründe für seinen raschen Abstieg. Anders als die Beatles oder Stones war Bolan von seinen kreativen Mitteln abhängig: Seine Band bestand aus Angestellten, nicht aus Gegenstücken, die er glänzen lassen konnte oder die sich ins Songwriting einzubringen gewusst hätten.
Und obwohl er so gerne davon sprach, sich an anderen Künsten ausprobieren zu wollen, war Bolan kein künstlerischer Universalgelehrter wie sein Freund David Bowie. Er konnte ums Verrecken nicht schauspielern oder Drehbücher schreiben. Born to Boogie war ein Allerlei aus mitreißenden Aufnahmen von den Wembley-Konzerten und pseudo-surrealen, halbimprovisierten Zwischenspielen, die auf John Lennons Anwesen gefilmt worden waren. Dem NME gegenüber schwärmte Bolan von einer Szene, in der Ringo Starr (als Haselmaus) und Bolan (als der verrückte Hutmacher) »Byron-mäßige Gedichte in einem hellroten Cadillac« vorlesen. »Es ist alles sehr camp – und am Ende singen wir ›Tutti Frutti‹.« Doch seid gewarnt: Ein genervter Zwerg kreuzt auch auf und isst den Außenspiegel des Cadillacs.
Bolan begann auch, den Druck des Ruhmes zu spüren. Er verglich ihn damit, von Hunderten von unsichtbaren Menschen gegen die Wand gedrückt zu werden. Schon im April 1972 sprach er von einem Bedürfnis, sich zurückzuziehen und darüber, wie viel einem die Berühmtheit zwar gäbe, doch dass das, was sie koste, unersetzbar sei, etwa wie Gehirnzellen. »Ich habe mich nie so unsicher gefühlt oder solchen Schmerz gespürt wie jetzt. Ich bin musikalisch nackt«, beschwerte er sich. »Was ich spiele und singe ist eine Projektion meines echten Ichs.« Einer der besseren Tracks auf The Slider, »Main Man« beinhaltet die vielsagenden Zeilen »As a child I laughed a lot […] Now it seems I cry a lot«. Dem Melody Maker beichtete er: »Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint wie dieses Jahr.«
Todesvorahnungen machten ihm zu schaffen: »Ich weiß nicht, ob ich als menschliches Wesen noch viel länger hier sein werde […]. Ich habe wirklich das Gefühl, dass alles morgen vorbei sein könnte. Nicht nur die Band – ich meine das Leben.« Er fantasierte, alles hinter sich zu lassen und in Ägypten Archäologe zu werden.
Seinem Ego versetzte die Tatsache einen tiefen Schlag, dass T. Rex nicht in der Lage waren, ihre britischen Erfolge in Amerika zu wiederholen. »Get It On« schaffte es unter dem Titel »Bang a Gong« zwar in die Top 10, aber T. Rex stolperten in den Grand-Canyon-großen Abgrund zwischen FM- und AM-Radio in Amerika. FM war die Domäne der behaarten Prog-Freaks, denen T. Rex zu seicht und poppig waren. Die AM-Sender widmeten sich purem Pop, waren die Heimat von den Carpenters oder Boybands wie den Osmonds. Für diesen Markt hatten T. Rex zu viel kosmisches Drumherum.
Zwischen 1972 und 1974 tourten T. Rex wiederholt durch die Staaten. Die Reaktionen variierten. Ein neue Welle Glitterfans schwärmte zu ihrem Gig in Santa Monica, in San Francisco hingegen ließen Bolans Popstar-Moves das langhaarige Publikum – das immer noch den Acid-Rock-Glanzzeiten der Stadt nachtrauerte – kalt. Roy Hollingworth vom Melody Maker war diese Unbeholfenheit aufgefallen, als er über die Tour Ende 1972 berichtete. Bolans verführerische Tricks funktionierten zu Hause vor einem jungen Publikum, das schon mit dem Fernseher aufgewachsen war. Ältere Zuschauer, »die sich nicht bewegen, grooven, sich nicht nass machen, tanzen oder aufstehen und schreien«, berührte das alles nicht. Als Bolan ein Handtuch in die Menge warf, »fing es niemand auf«. Es war demütigend. Und es beweist, dass Charisma etwas ist, was die Gemeinde genauso sehr haben muss wie ihr Prophet: eine sich gegenseitig befeuernde Bauernfängerei, deren Rollen sich ständig vertauschen.
Von den Berichten aus Amerika tief getroffen, bemühte sich Bolan um Schadensbegrenzung. Im November 1972 gab er dem Melody Maker ein Interview, dem die Zeitschrift den unbarmherzigen Titel »Marc: Ich war kein US-Flop!« gab. Er bestritt, dass ein gut besuchter Gig in New York in Wirklichkeit das war, was Konzertpromoter ein »Papierhaus« nennen, d. h. ein Konzert, dessen Publikumszahlen durch verschenkte Tickets in die Höhe getrieben wurden. Er prahlte, dass es in Amerika Interessenten für eine TV-Serie im Stil der Jackson-5-Cartoons gäbe, die er selbst schreiben würde. Es war der typische Bolan-Bullshit und keiner kaufte ihn ihm ab.
Anfang 1973 war im Prinzip alles vorbei.
Aber wir wollen uns nicht zu lange mit Bolans Fall aufhalten. Mit dem Kokain und dem Champagner, seinem zunehmenden Gewicht und dem schrecklichen neuen Haarschnitt. Mit seiner ansteigenden Paranoia und den unwürdigen Sticheleien in Richtung Bowie, der ein Level an künstlerischer Glaubwürdigkeit erreicht hatte, von dem Bolan nur träumen konnte. Dabei flimmerte die alte Brillanz auf späteren Alben wie Tanx (1973) und Dandy in the Underworld (1977) durchaus sporadisch immer wieder auf. Und es gab eine Reihe von Killersingles: das elegische »Teenage Dream« und das alberne »New York City«, beides ordentliche Hits, und das proto-punkige »Laser Love«, das unverdient floppte.
Ignorieren wir also die Jahre des Niedergangs und konzentrieren uns auf die Glanzzeit. Was lässt sich über das Phänomen Bolan sagen? Popkultur-Experte Pete Fowler bemängelte, dass die T. Rextasy, anders als die Beatlemania oder der Rock-’n’-Roll-Hype der 1950er, nicht »rein« gewesen sei. Wie Bowie wusste Bolan, wie Fanidentifikation funktionierte und dass dem Aufstieg eines Stars sein Fall folgt. Bereits 1965, in einem seiner ersten Interviews, blickte Bolan voraus auf die Ruhe und Weisheit eines Lebens nach dem Stardasein: »Wenn ich meine Berühmtheit hinter mir gelassen habe, werde ich wissen, wo ich stehe.« Bolan war von der Musikpresse geschult worden, die er seit 1962 eifrig gelesen hatte. Die Hefte hatte er behalten, um sich auf sie beziehen zu können und um bestimmte Dinge nachzuschlagen, etwa was für eine Gitarre dieser oder jener Künstler gespielt hat. »Ich stehe total auf Bilder. Und Handbewegungen. All dieser Kram.«
Aber was ist mit dem Phänomen an sich? Den intensiven Erfahrungen von Fans wie Noelle Parr? Die waren rein (und auch etwas unrein in Gedanken – da waren sie auf unschuldige Weise schmutzig). Die pure Jugend der T. Rexmaniacs sorgte für eine gewisse Unwissenheit. Auch wenn Bolan selbst leicht außerhalb seines eigenen Mythos stand, seine Fans steckten mittendrin.
Heute haben wir keinen Zugang mehr zum Phänomen Bolan. Wir können darüber lesen oder uns Videos anschauen, die es dokumentieren. Doch was bleibt, ist sein Werk. Drei oder vier tolle John’s-Children-Songs. Die Rätselhaftigkeit von Tyrannosaurus Rex, deren Alben nie einen nennenswerten Einfluss gehabt hätten, wären sie in den Nullerjahren nicht von Animal Collective und anderen Freakfolk-Künstlern aufgegriffen worden. Zwei fast perfekte Alben: T. Rex und Electric Warrior. Und das wichtigste: Neun brillante Singles hintereinander, von »Ride a White Swan« bis »20th Century Boy«.
In den Texten wimmelt es von Geistesblitzen jugendlichen Genies. Doch wären sie nichts ohne ihre Vortragsweise, ohne Bolan selbst. T. Rex waren letztendlich weniger das Werk eines Künstlers, sondern das Werk eines Körpers. Es ging alles von Marc aus. Diese Stimme. Dieses Gesicht. Das Funkeln in seinen Augen. Das Grinsen bis über beide Ohren.
Glamour, der im Endeffekt nichts mit angemalten Wangen oder einer Jacke aus Satin zu tun hatte, mit Dingen also, die man kaufen oder nachmachen kann. Glamour als eine unheimliche Beharrlichkeit des Selbst, als ein Funken purer Willkür.
Tolkien hätte genauso gut Marc beschreiben können, als er schrieb: »Faërie kann nicht in einem Netz von Worten gefangen werden. Denn es hat die Eigenschaft, nicht beschrieben, wohl aber wahrgenommen werden zu können.«
Oder wie es Syd Barrett ausgedrückt hätte: that cat’s something I can’t explain.
* Dt.: Exzentrizität – Anm. d. Ü.
* Dt.: pervers – Anm. d. Ü.
* Richtig geschrieben müsste der Titel »Wielder of Words« heißen. Mit dem Begriff ließe sich jemand bezeichnen, der Worte benutzt, um seine Ziele zu erreichen. – Anm. d. Ü.
* Im Englischen Bürgerkrieg (1642–1649) wurden die pro-parlamentarischen Kräfte Roundheads genannt, die Royalisten, die die Macht des Königs verteidigten, hingegen waren die Cavaliers. – Anm. d. Ü.
** Armee der Roundheads. – Anm. d. Ü.
* E10 ist eine Londoner Postleitzahl, Eton eine berühmte Eliteschule. – Anm. d. Ü.
* Dt.: »gekritzelte Zeilen« – Anm. d. Ü.
* Das in den Credits scherzhaft als »pixiephone«, also Elfenphone, aufgeführt wird. – Anm. d. Ü.
* Aus der HipHop-Szene stammender Ausdruck für protzigen Schmuck und das entsprechende Auftreten. Anm. d. Ü.