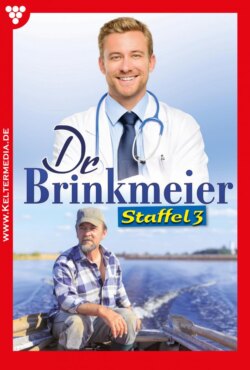Читать книгу Dr. Brinkmeier Staffel 3 – Arztroman - Sissi Merz - Страница 6
Оглавление»Alsdann, Eggerer, wir sind uns einig. Stücker zehn von deinen Mastbullen zum alten Preis. Und dazu eine Garantie für die Abnahme von weiteren zwanzig. Schlag halt ein!«
Valentin Eggerer, der Altbauer auf dem Einöd-Hof, zögerte einen Moment, dann folgte aber doch der Handschlag, der das Geschäft mit dem Viehhändler Ammering unter Dach und Fach brachte. Dieser nickte zufrieden. »Was ist? Gibt’s keinen Schnaps auf den Geschäftsabschluß?«
Der Bauer vergrub die Hände in den Hosentaschen und warf seinem Sohn Thomas einen knappen Blick zu. »Hol uns zwei Stamperln, Bub. Und hernach gehst wieder an deine Arbeit, ich brauch’ dich hier nimmer.« Der ärgerliche Ausdruck in den Augen des Jungbauern schien ihm zu entgehen, während der Viehhändler monierte: »So könnte ich mit meinem Buben fei net umspringen, der tät’ mir was anderes erzählen.«
»Der Thomas ist gut gezogen, der weiß, wer hier der Herr auf dem Hof ist. Gehen wir ins Haus.«
Valentin Eggerer war ein hochgewachsenes Mannsbild mit einem breiten Kreuz und Händen, die zupacken konnten. Obwohl er heuer im siebenundfünfzigsten Lebensjahr stand, arbeitete er noch voll mit auf dem Hof, der etwas außerhalb der kleinen Ortschaft Wimbach, unweit des Königssees lag. Mit seiner Frau Maria hatte er längst Silberhochzeit gefeiert, seine beiden mittlerweile erwachsenen Kinder arbeiteten ebenfalls mit im Betrieb. Die Familie Eggerer hielt zusammen, und es hätte ein schönes Leben auf dem Erbhof sein können, wenn der Altbauer kein solcher Patriarch gewesen wäre. Valentin kannte nur seine eigene Meinung und ließ sonst nichts gelten. Er bestimmte und kümmerte sich auch um die kleinsten Dinge auf dem Hof. Daß sein Verhalten für seinen Sohn Thomas demütigend war, daß dieser sich nur wie ein besserer Laufbursch fühlte, der nicht mal einen Sack Saat allein kaufen konnte, ohne vorher den Alten zu fragen, das störte diesen nicht im geringsten; im Gegenteil. Er meinte, daß es nur auf diese Weise ging. Deutete seine Frau einmal scheu an, daß ihr Sohn allmählich auch etwas Verantwortung übernehmen müsse, dann bekam sie meist zu hören: »Der Bub kann den Hof übernehmen, wenn ich nimmer bin. Hier hat es allerweil nur einen Bauern gegeben, und der bin immer noch ich!«
Maria Eggerer litt unter dem beherrschenden Wesen ihres Mannes ebenso wie ihre Kinder. Früher war Valentin nicht so gewesen, da hatte er sich freundlich und einfühlsam gegeben. Im Laufe der Jahre aber schien sich sein Herz verhärtet zu haben. Maria wußte nicht, warum, sie konnte sich das einfach nicht erklären. Doch es war so, und es wurde immer schlimmer.
Am Mittagstisch erzählte Valentin ausführlich von dem erfolgreichen Geschäftsabschluß und endete mit der Feststellung: »Ich kann mir net vorstellen, daß du das auch so gut hingekriegt hättest, Thomas. Dazu fehlt dir einfach das Geschick, das Gespür. Als Bauer taugst was. Aber was die Geschäfterln angeht, kann dich jeder dahergelaufene Viehhändler übers Ohr hauen.«
»Du redest so, als wäre der Thomas dumm«, beschwerte Monika, seine Frau, sich empört. »Würdest ihn mal ein Geschäft abschließen lassen, dann könntest erleben…«
»Wer hat denn dich gefragt?« unterbrach die Altbauer seine Schwiegertochter unfreundlich. »Wie kommst du mir eigentlich daher? Schweig und unterbrich mich net, ich war nämlich noch net fertig.« Er maß Thomas mit einem strengen Blick. »Scheint so, als hättest net einmal dein Weib unter Kontrolle. Aber bessere Geschäfte abschließen als dein Vater, das bildest dir ein, gelt?« Der Alte lachte verächtlich. »Ich will dir mal was sagen, Bursch: Das hier ist mein Hof, da bestimme ich, was gemacht wird. Und dir fällt gewiß kein Zacken aus der Krone, wennst dich fügst. So habe ich es auch bei meinem Vater tun müssen.«
»Die Zeiten haben sich aber geändert«, wagte Valerie, die Hoftochter, einzuwenden. »Du brauchst uns fei net zu behandeln wie Leibeigene. Wir tun auch so unser Arbeit, genau wie du.«
»Schweig, du dummes Ding!« Valentin schlug mit der Faust auf den Tisch, daß es krachte. »Das fehlte noch, daß ich mir dein dummes Gerede anhöre.«
Valerie sprang vom Tisch auf und rannte aus der Stube. Die Mutter wollte ihr folgen, aber ihr Mann bestimmte barsch: »Sitzen bleibst, ich dulde kein Rumgerenne beim Essen. Das narrische Ding wird sich schon wieder einkriegen.«
»Tut mir Leid, aber mir ist ebenfalls der Appetit vergangen.« Monika erhob sich und ging hinaus, Thomas folgte ihr. Der Altbauer kümmerte sich nicht darum, er wirkte sogar recht zufrieden, wie seine Frau bekümmert feststellen konnte.
»Warum bist nur immer so zu den Kindern?« wunderte sie sich mit leiser Stimme. »Du stößt sie ständig vor den Kopf. Auf Dauer läßt sich das fei niemand gefallen. Manchmal kommt es mir so vor, als wolltest sie absichtlich aus dem Haus treiben.«
»So ein Schmarrn. Ich zeig’ ihnen nur, wo es langgeht. Du weißt doch selbst am besten, wie wichtig Zucht und Ordnung sind, Maria. Oder willst mir erzählen, du hast deinen Ausrutscher mit dem Himi schon vergessen? Ich jedenfalls net!«
Zuerst wußte Maria gar nicht, worauf ihr Mann anspielte. Als es ihr dann aber einfiel, konnte sie es nicht fassen. »Das ist über zwanzig Jahre her! Und außerdem ist nix passiert damals.«
»Ja, weil ich es verhindert hab’. Hältst mich vielleicht für so dumm? Ich weiß ganz genau, daß du es damals darauf angelegt hast. Aber ich hab’ den Knecht vom Hof gewiesen. Und ich greife auch jetzt mit eiserner Faust durch, damit da eine Zucht und Ordnung herrschen auf unserem Hof.«
Maria musterte ihren Mann verschämt. »Hast wirklich geglaubt, daß was gewesen ist zwischen dem Himi und mir? Bist deshalb so anders geworden, so… hart und ungerecht?«
»Red keinen Mist«, tuschte der Bauer seine Frau grob nieder. »Ich bin immer gerecht. Aber ich gebe es net zu, daß auf dem Hof einfach jeder macht, was er will. Ich habe zu bestimmen, es geht nach meinem Willen. Und am End’ hab’ ich noch immer recht behalten!«
»Und irgendwann wirst sehr allein sein, wennst net beizeiten lernst, daß es auch noch andere Menschen auf der Welt gibt, die einen eigenen Willen haben«, dachte Maria resigniert. Doch sie wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Gedanken auch laut auszusprechen…
Die Jungbäuerin hatte sich in die eheliche Schlafkammer im ersten Stock geflüchtet und ihren Mann mit den Worten empfangen: »So kann es net weitergehen, Thomas. Ich halte das keinen Tag länger aus. Laß uns fortgehen und woanders neu anfangen!« Die zierliche Blondine stahl sich in seine Arme und murmelte erstickt: »Manchmal hab’ ich das Gefühl, als könnte ich hier nimmer atmen. Geht es dir nicht auch so?«
»Freilich, ich weiß ganz genau, was du meinst«, gestand er ihr zu und hielt sie ganz fest. »Aber das ist nicht so leicht. Wir sind da daheim, ich bin der Jungbauer. Ich will gar net davon reden, daß die Eltern uns brauchen, damit der Hof auch in der nächsten Generation weiter bestehen kann. Aber es ist mein Erbe, und das werfe ich net einfach fort. Außerdem müssen wir an die Kinder denken. Der Seppl wird irgendwann der Jungbauer hier sein. Und die Liesel hat dann ein Anrecht auf die Hälfte des Hofes. Na, Schatzerl, es hat keinen Sinn, wegzulaufen. Wir müßten einfach zuviel aufgeben. Im Grunde unser ganzes Leben.«
»Ja, ich weiß.« Monika seufzte schwer. »Aber dein Vater wird immer schlimmer. Es ist ganz unmöglich, mit ihm auszukommen. Außerdem ertrage ich es nicht, wenn er dich so mies behandelt. Dann kann ich net ruhig bleiben.«
»Ist schon recht, Liebes. Ich verstehe dich, für mich ist es ja net anders. Aber ich mag trotzdem nicht fortgehen. Der Hof ist schließlich unser Daheim.«
»Ich wünschte, er wäre es wirklich, nicht bloß ein Ort, an dem man sich immer so fühlt, als wäre man bloß geduldet…«
*
Valerie Eggerer fühlte sich auf dem Einöd-Hof schon seit einer Weile nicht mehr wirklich wohl. Obwohl sie hier geboren und aufgewachsen war, hatte sie doch manchmal das Gefühl, nicht mehr hierher zu gehören. Und das aus einem ganz bestimmten Grund.
Das hübsche Madel mit den blonden Locken und den tiefblauen Augen hatte sein Herz vor einer Weile verschenkt. Doch der Bursch, dem Valerie gut war, würde niemals die Billigung des Vaters finden, das wußte die Hoftochter sehr genau. Denn Toni Preisler war der Großknecht auf dem Einöd-Hof. Und Valentin hatte bereits des öfteren angedeutet, daß für seine Tochter nur eine gute Partie in Frage kam. Was er sich darunter vorstellte, war klar: Ein Jungbauer aus Wimbach oder der Umgebung, der ein ordentliches Erbe vorzuweisen hatte. Da kam ein Knecht, der nur auf seiner eigenen Hände Arbeit stolz sein konnte, überhaupt nicht in Betracht. Valerie wußte es genau, denn vor ein paar Tagen hatte sie gewisse Andeutungen gemacht und damit nur Hohn und Spott geerntet. »Du willst dir einen Burschen zum Heiraten selbst aussuchen? Daß ich net lache! Dazu bist doch viel zu dumm«, hatte Valentin behauptete. »Gewiß wirst dir einen Gigolo anlachen, der sich hier auf dem Hof einnisten und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen will. Aber net mit mir! Deinen Bräutigam suche ich aus, Ende der Diskussion!«
Sie hatte versucht, vernünftig mit ihrem Vater zu reden, aber das hatte sich wieder einmal als unmöglich erwiesen. Ganz mutlos war Valerie, als sie nun den Hof verließ und
hinauf zum Sennhüttel stieg, wo sie sich mit Toni verabredet hatte. Es dauerte nicht lange, dann erschien der Bursch. Auch ihm ging die Heimlichtuerei zuwider, Valerie sah es ihm gleich an. Zwar schenkte er ihr zur Begrüßung ein zärtliches Busserl, doch seine markante Miene drückte deutlich aus, daß er sich nicht wirklich wohl fühlte. Hand in Hand spazierte das junge Paar über den schmalen Steig, der vom Hüttel noch weiter hinauf zu einem Aussichtspunkt führte. Hier hatte man einen herrlichen Rundblick auf die malerische Umgebung des Königssees, das Tennengebirge und auch den Zauberwald. In der Ferne konnte man Berchtesgaden erkennen. Und an einem klaren Sommertag wie diesem ging der Blick noch viel weiter bis hinein in die verblauende Ferne. Ganz wehmütig wurde es Valerie mit einem Mal ums Herz, und die sprach spontan aus, was sie dachte: »Wir werden wohl irgendwann von hier fortgehen müssen, Toni, net wahr?«
Der Bursch schaute seine Liebste ernst an. »Wie kommst denn auf den Gedanken? Du bist hier daheim.«
»Das ist mir nimmer so wichtig. Freilich ist der Hof mein Zuhause. Und ich hab’s früher für selbstverständlich genommen. Aber seit wir uns lieb haben, da hat sich halt vieles geändert. Es ist mir nimmer so wichtig, wo ich bin. Hauptsache, wir sind beisammen. Und auf die Dauer kann man doch mit dem Vater nimmer auskommen. Er wird immer schlimmer, läßt überhaupt nicht mehr vernünftig mit sich reden. Daß der Thomas und ich längst erwachsen sind, das scheint er völlig übersehen zu haben.«
»Dein Vater ist ein harter Mensch. Er läßt nix gelten, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn wir zwei fest zusammenstehen und ihm klar machen, daß er uns net trennen kann, dann wird er es irgendwann hinnehmen.«
»Mei, Toni, ich wünschte, ich könnte auch so denken.« Valerie lehnte den Kopf an die Schulter des Burschen, der einen Arm um sie gelegt hatte. »Ich hab’ dich so lieb. Und es gibt nix, was ich mir mehr wünsche, als endlich ganz ohne Versteckspiel mit dir beisammen sein zu können. Aber es geht einfach net.«
»Und warum nicht?« Er blieb stehen, schaute sie offen an und entschied: »Ich werde mit dem Bauern reden. Mehr als nein sagen kann er schließlich net.«
»Und dann? Was soll hernach werden? Wenn er dich vielleicht vom Hof wirft?« Sie blickte unsicher zu ihm auf.
»Würdest mit mir gehen? Ich meine, ganz woanders hin, neu anfangen? Ich weiß, ich mute dir da viel zu, aber…«
Valerie lächelte, als sie versprach: »Ich würde überall mit dir hingehen, darauf kannst dich verlassen. Aber ich hab’ Angst, daß der Vater uns irgendwie auseinanderbringt. Du kennst ihn doch. Er kann sehr hart und rücksichtslos sein.«
»Freilich, da hast recht. Trotzdem möchte ich heut noch mit ihm reden. Das ewige Versteckspiel geht mir total zuwider. Kommst mit? Oder meinst, es ist besser, ich geh’ allein?«
Valerie mußte nicht lange nachdenken. »Freilich komme ich mit, es betrifft doch uns beide.« Sie schob ihre Hand in seine und lächelte tapfer. Aber ihr Herz, das klopfte zum Zerspringen…
Toni Preisler hatte sich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um mit dem Einöd-Bauern zu reden, denn dieser hatte gerade Streit mit seinem Sohn. Es ging um die Anschaffung eines neuen Traktors, die Valentin Eggerer als Verschwendung betrachtete. Und das sagte er Thomas auch ganz offen. Die beiden schrien sich gerade an, als Valerie und Toni auftauchten. Der Altbauer fuhr den Großknecht an: »Was willst denn du da, Toni? Ich hab’ jetzt keine Zeit. Wennst was zu besprechen hast, komm halt morgen in der Früh’, so wie immer.«
»Es geht aber um was Privates«, stellte der Bursch klar und straffte sich ein wenig. »Bauer, ich hab’ dir was zu sagen. Die Valerie und ich, wir haben uns lieb und wollen heiraten.«
Valentin starrte den Großknecht an, als halte er ihn für übergeschnappt. Thomas sagte: »Ich freu’ mich für dich, Valerie. Und ich wünsche euch alles Gute.« Er warf seinem Vater einen schrägen Blick zu. »Ihr werdet es brauchen können…«
»Thomas, laß uns allein. Und du auch, Madel!« Der Altbauer warf seiner Tochter einen knappen, unfreundlichen Blick zu. Doch Valerie wollte nicht gehen. Sie schob ihre Hand in Tonis Rechte und schaute den Vater trotzig an.
Dieser zischte: »Schleich di, oder muß ich erst grob werden?«
»Ich will net! Es geht schließlich auch um meine Zukunft«, kam es entschieden von ihr, doch ihre Stimme klang sehr unsicher.
»Geh nur, Valerie, ich erzähle dir später alles«, versprach der Bursch da begütigend. Nur widerwillig verließ sie die Stube. Valentin wurde nicht laut, man hörte draußen nichts von dem nun folgenden Gespräch zwischen Bauern und Knecht. Es dauerte eine ganze Weile, dann erschien Toni wieder. Er war eine Spur blasser als sonst, wirkte aber gefaßt. Valerie wollte sofort wissen, was los gewesen sei. »Sag es halt! Was habt’s ausgemacht?«
Toni nahm ihre Hand und verließ mit ihr zusammen das Haus. Im Wirtschaftshof blieb er stehen und ließ Valerie wissen: »Er gibt es net zu, daß wir heiraten. Wenn ich dich nicht in Ruhe lasse, will er mich aussi schmeißen. Es ist, wie wir vermutet haben; er läßt einfach net mit sich reden. Sackerl Zement!«
»Und was soll nun werden?« Valerie sank der Mut, sie fühlte sich ganz niedergeschlagen. Da wurde im Arbeitszimmer des Bauern das Fenster geöffnet, und Valentin Eggerer forderte streng: »Komm eini, Madel, ich dulde es net, daß du dich mit dem Knechterl draußen umeinant treibst.«
Sie hatte eine heftige Erwiderung auf der Zunge, aber Toni mahnte Valerie: »Das hat doch keinen Sinn. Geh nur, auf die Weise erreichen wir nix.«
»Aber, Toni, was sollen wir denn bloß tun?« kam es da zutiefst verzweifelt von dem Madel. »Bitte, sag es mir!«
»Im Moment geht gar nix. Wir müssen halt abwarten.«
»Gehen wir fort! Ich komme mit dir, wohin du willst. Der Hof ist mir verhaßt, ich mag das alles hier nimmer sehen«, begehrte sie da unglücklich auf. »Ich will nur noch weg!«
»Valerie, nimm dich zusammen, das hat doch keinen Sinn. Ich kann und will dich net zwingen, deine Heimat zu verlassen. Du würdest es mir irgendwann übelnehmen. Und dann könnten wir niemals wirklich glücklich miteinander werden.«
»Ach, Toni, mir ist alles einerlei, wenn du net bei mir bist.«
»Ich bin ja bei dir.« Er hauchte ihr ein Busserl aufs Haar und lächelte ihr warm zu. »Du hast Recht gehabt, man kann beim Bauern net mit dem Kopf durch die Wand. Wir müssen ein bissel geschickter vorgehen. Warte nur ab, es wird noch alles gut werden. Ich verspreche dir…«
»Valerie, komm sofort eini! Oder soll ich dich holen?«
»Geh jetzt. Wir reden morgen in Ruh’ weiter. Nach dem Nachtmahl treffen wir uns oben am Hüttel, einverstanden?«
»Ja, ist schon recht.« Sie tauschten ein rasches Busserl, dann eilte das Madel ins Haus. In der Diele wartete der Vater bereits auf sie. Valerie wollte an ihm vorbei, doch er packte sie am Oberarm und herrschte sie an: »Das Knechterl schlägst dir aus dem Schädel, hast mich? Du wirst einen ordentlichen Burschen heiraten, einen, der was vorzuweisen hat. Net so einen Dahergelaufenen mit Löchern in den Taschen, hast mich?«
»Ich hab’ den Toni lieb, und daran kann keiner mehr was ändern, auch du net!« begehrte Valerie auf.
Doch der Alte kannte kein Pardon. Kalt drohte er seiner Tochter: »Einmal seh’ ich dich noch mit dem Kerl, hernach jag’ ich ihn eigenhändig mit dem Hund von Hof!«
*
Anna Stadler, die hübsche Apothekerin von Wildenberg, bediente rasch den letzten Kunden und schloß dann die Ladentür ab. Ihre einzige Angestellte, Susi Angerer, wunderte sich über das Verhalten der Chefin. Sonst ließ diese nie auf die Sekunde genau den Hammer fallen. Dafür mußte es schon einen besonderen Grund geben.
»Kannst heimgehen, Susi, ich hab’ noch was vor und muß gleich weg«, ließ die grazile Blondine ihre Angestellte da auch schon wissen. »Die letzten beiden Fächer räumst dann am Montag ein.«
»Ist schon recht. Darf man fragen, was ansteht?« Susi lächelte keck. »Oder ist die Frage überflüssig?«
Anna verdrehte die Augen. Susi hatte zwar das Herz auf dem rechten Fleck, aber sie konnte manchmal schon sehr direkt sein. Und da nützte kein Ausweichmanöver etwas. Deshalb gab sie ebenso direkt Antwort. »Ich unternehme mit dem Max Brinkmeier eine Kraxeltour. Wir wollen die kurze Route an der Westseite des Untersbergs nehmen.«
»So, so. Kraxeln also. Ja mei, es ist schon eine Schand’, wenn man sich vorstellt, was Sie alles für den Doktor tun. Und er weiß es so überhaupt net zu schätzen…«
»Geh, Susi, jetzt redest einen Schmarrn, das weißt schon. Also, pfüat di, bis Montag.« Anna ging hinauf in ihre Privatwohnung, die über der Apotheke lag. Sie hatte den Laden vor etwas mehr als zwei Jahren von ihren Eltern übernommen. Diese hatten sich auf Lanzarote zur Ruhe gesetzt. Anna war eine tüchtige junge Frau, sie hatte den Laden in Schwung gebracht und auch die Wohnung nach ihren Vorstellungen renoviert. Nun waren die Stuben praktisch eingerichtet, strahlten zugleich aber auch eine gewisse Gemütlichkeit aus.
Während die Apothekerin sich umzog, ließ sie in Gedanken noch einmal die vergangenen Wochen Revue passieren. Nicht mal einen Monat war es her, daß Dr. Julia Bruckner, die Freundin des Wildenberger Landarztes, wieder nach Afrika geflogen war. Und dieser Abschied, der hing Max Brinkmeier noch immer nach.
Der engagierte Mediziner hatte mehr als zehn Jahre in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Zusammen mit der schönen Julia hatte er aus einer vergessenen Missionsstation mitten im Dschungel von Ruanda ein funktionierendes Buschhospital gemacht. Vor einiger Zeit war Brinkmeier senior dann erkrankt und nicht mehr in der Lage gewesen, die Landarztpraxis von Wildenberg weiterzuführen. Max hatte es als seine Pflicht angesehen, nach Deutschland zurückzukehren, um diese Aufgabe zu übernehmen. Es war für ihn keine leichte Entscheidung gewesen, das wußte Anna. Schließlich hatte sie die Trennung von Julia Bruckner bedeutet, der Frau, die Max über alles liebte. Und es schien so, als leide nicht nur er unter dieser Trennung. Vor einer Weile war Julia plötzlich in Wildenberg aufgetaucht. Für alle Beteiligten schien da klar zu sein, was die Zukunft bringen würde.
Anna Stadler, die heimlich in den feschen Landarzt verliebt war, hatte die beiden bereits vor dem Traualtar stehen sehen. Aber dann war es doch anders gekommen. Dr. Tom Kennedy, ein schottischer Arzt, der ebenfalls auf der Station in Afrika arbeitete, war in Wildenberg erschienen und hatte Julia überredet, ihn wieder nach Holy Spirit zu begleiten.
Für Max Brinkmeier war das ein schwerer Schlag gewesen, von dem er sich noch längst nicht wieder erholt hatte. Zunächst war er unendlich enttäuscht und wütend gewesen. Mittlerweile hing er total durch, wie Anna das für sich nannte. Der Mediziner mit Leib und Seele schien den Spaß an seiner Profession verloren zu haben. Er versah seine Arbeit nach wie vor gewissenhaft, kein Patient konnte sich über ihn beschweren. Aber der Spaß daran, Menschen zu helfen, die Lebensfreude schienen Max abhanden gekommen zu sein.
Anna hatte sich in den vergangenen Wochen sehr bemüht, den jungen Mann wieder aufzurichten, ihn ein wenig von seinem Kummer abzulenken und zu trösten. Daß er am Vortag mit der Idee gekommen war, mal wieder zusammen kraxeln zu gehen, wertete sie als positives Zeichen. Und sie freute sich natürlich sehr darauf, endlich mal wieder zu zweit ein paar Stunden in der schönen Bergwelt ihres Heimattales verbringen zu können. Schließlich kannten Anna und Max sich von Kindesbeinen an, und sie hatten sich immer gut verstanden. Sie war zuversichtlich, ihm über seine Krise hinwegzuhelfen. Und sie hoffte zugleich, daß Julia Bruckner in absehbarer Zeit nicht wieder nach Wildenberg kam. Was sie mit ihrer spontanen Abreise verursacht hatte, konnte Anna nun mit viel Geduld wieder ausbügeln…
Als die junge Frau wenig später das Doktorhaus von Wildenberg erreichte, stand Max Brinkmeier gerade neben der Haustür. Er war damit beschäftigt, das alte Türschild wieder anzubringen. Mit finsterer Miene löste er die Schrauben und warf dabei noch einen langen Blick auf das neue Schild. Er hatte es gravieren lassen, als es so aussah, daß Julia bei ihm bleiben, sie auch wieder beruflich an einem Strang ziehen würden. Doch diese Hoffnung hatte sich nun ja in Rauch aufgelöst…
»Hallo, Max. Ich hoffe, du hast unsere Verabredung zum Kraxeln net vergessen«, meldete sich Anna zu Wort, weil der junge Mann gar so selbstvergessen vor sich hin werkelte. Er wandte den Kopf und ein jungenhaftes Lächeln begrüßte sie.
»Anna, schön, daß du kommst. Ich hab’ mir gedacht, bevor wir aufbrechen, stärken wir uns noch. Die Afra hat heut morgen einen feinen Hefezopf gebacken. Und frischen Kaffee gibt es auch.«
»Das klingt ja richtig verlockend. Ich bin dabei!«
»Prima. Einen Moment, ich muß nur noch etwas in die Mülltonne befördern.« Er griff nach dem neuen Türschild, da legte sie eine Hand auf seinen Arm und mahnte ihn: »Das solltest net tun. Man kann schließlich nie wissen, was geschieht. Vielleicht kommt die Julia ja in absehbarer Zeit wieder und…«
Die markante Miene des jungen Mediziners wurde abweisend. »Das glaube ich nicht. Und selbst wenn sie das tun würde, könnte es mit uns nicht einfach so weitergehen wie bisher.«
»Was willst jetzt damit sagen?« Anna erschrak ein wenig über die harsche Ablehnung, die aus Max’ Worten sprach. Doch er gab ihr keine direkte Antwort, verschwand kurz und kehrte dann ohne das Türschild wieder zurück. »Gehen wir auffi, komm!«
Sie folgte ihm mit gemischten Gefühlen. In den vergangenen Tagen hatte es so ausgesehen, als ob Max sich langsam fangen und die neuerliche Trennung von Julia hinnehmen würde. Nun aber gab er sich wieder so verbittert und unglücklich wie am Tag ihres heimlichen Verschwindens. Sollten denn Annas Bemühungen nicht gefruchtet haben? Fast schien es ihr so. Doch sie irrte sich, zumindest was die Seelenlage des Landarztes betraf, das zeigte sich gleich darauf.
Max betrat die Wohnung seines Vaters, bat Anna aber, kurz im Treppenhaus zu warten. Als er zurückkehrte, trug er ein Tablett mit Kaffee und Kuchen und stieg damit noch eine Treppe höher zu seiner eigenen Wohnung. Anna wunderte sich ehrlich.
»Ich dachte, wir trinken zusammen mit der Afra und deinem Vater Kaffee«, warf sie ein.
»Heut net. Ich möchte gern mit dir allein sein, Anna. Ich habe dir nämlich einiges abzubitten.«
Seine Worte steigerten ihre Überraschung noch. Zugleich fing ihr Herz an, unruhig zu klopfen. Max verhielt sich mit einem Mal ganz anders als bisher. Was mochte das nur bedeuten? Sie sollte es wenig später erfahren. Als sie sich nämlich bei Kaffee und Kuchen gegenübersaßen, gab Dr. Brinkmeier offen zu: »Ohne dich hätte ich die vergangenen Wochen nicht überstanden, Anna. Ich weiß, was ich dir verdanke. Und ich möchte nicht, daß du denkst, ich wüßte deine Hilfe nicht zu schätzen.«
»Ich bitte dich, Max, ich hab’ ja gar nix besonderes gemacht. Es war nicht mehr als ein kleiner Freundschaftsdienst. Das solltest du nicht überbewerten.«
»Hast eigentlich Absichten auf den Rainer Fewinger?« wechselte er nun das Thema. »Vielleicht geht es mich nix an, aber ich wüßte da gerne Bescheid. Magst es mir verraten?«
Sie errötete ein wenig und lächelte nervös. »Jedem anderen würde ich eine solche Frage als Indiskretion auslegen. Aber bei dir nehme ich es net krumm. Schließlich sind wir alte Freunde. Der Rainer ist in mich verliebt und würde mich gerne heiraten. Deshalb kommt er ja auch öfter übers Wochenende nach Wildenberg.«
»Das würde sich doch wunderbar fügen für dich«, sinnierte Max. »Er hat schließlich auch eine Apotheke. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß ein gemeinsamer Beruf sehr verbinden kann. Aber manchmal hilft net einmal das…« Er blickte bekümmert vor sich hin, Anna versicherte ihm: »Ich will net fort von hier. Schließlich ist Wildenberg mein Heimatdorf. Hier leben die Menschen, die mir etwas bedeuten. Ich könnte das alles niemals einfach im Stich lassen und fortgehen.«
»Du bist eben ein treuer Mensch, soll es geben.«
»Max, hör mir mal zu. Ich finde, es wird Zeit, ganz offen miteinander zu reden. Daß die Julia fort ist, bedeutet doch net das Ende eurer Beziehung. Du hast mir selbst gesagt, daß du net weißt, ob sie bleiben wird. Schließlich weißt, wie sehr sie an ihrer Arbeit in Afrika hängt. Aber eine Entscheidung, die kann man auch revidieren. Sie muß net für alle Zeiten gelten.«
»Du hast mir mal gesagt, daß du Julias Verhalten falsch findest. Für dich steht die Liebe an erster Stelle, dann kommt erst der Beruf. Ich habe damals noch anders gedacht, weil ich Julias Passion für ihre Arbeit in der Entwicklungshilfe kenne. Aber jetzt ist mir bewußt geworden, daß du Recht hattest. Man kann seinen Beruf überall ausüben, gerade als Arzt. Aber man darf den Menschen, den man liebt, nicht im Stich lassen.«
»Sicher sieht sie das nicht so. Und ich bin auch davon überzeugt, daß sie sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Schließlich hatte sie doch den festen Willen, bei dir zu bleiben. Du solltest sie nicht verurteilen, Max. Verbitterung ist ein schlechter Ratgeber.«
»Ach, Anna, du hast wie immer Recht. Trotzdem fällt es mir schwer, mit dem umzugehen, was Julia getan hat. Es stellt für mich alles in Frage. Ich verspüre kaum noch einen Antrieb, meine Arbeit zu erledigen. Wenn ich morgens aufwache, denke ich zuerst an Julia und frage mich, wie sie ihr Leben ohne mich meistert. Vermutlich fällt es ihr nicht schwer, sie konnte ja auch einfach weggehen. Und ich fühle mich wie ein Idiot.«
»Nun mach aber mal einen Punkt. Du bist sehr enttäuscht worden und mußt damit erst mal fertig werden. Aber das schaffst du nicht, wenn du nur nachgrübelst und in der Vergangenheit wühlst. Komm, laß uns aufbrechen. Eine Kraxeltour wird dir den Kopf wieder frei machen. Und hernach siehst die Dinge nimmer so eng.«
Er warf ihr einen dankbaren Blick zu. »Gehen wir.«
Anna sollte recht behalten; die Bergtour wurde für sie und Max zu einem wunderbaren Erlebnis. Sie stiegen in die Westwand des Untersbergs ein, kraxelten ein gutes Stück bis zu einem Aussichtspunkt, von dem aus sie einen herrlichen Rundblick hatten. Es war ein klarer, sonniger Sommertag, die Sicht ging ungehindert bis hinüber zum Tennengebirge im Norden und über Zauberwald und Hintersee hinweg nach Berchtesgaden. In der würzigen Bergluft lag bereits der Duft der Heumaat auf den umgebenden Matten, ein Bergadler kreiste zeitweise über ihnen. Und als die Sonne schon tief im Westen stand, ihr warmes Licht das liebliche Land mit einer Kaskade von Karmesin und Gold überflutete, da wurde auch dem jungen Landarzt das Herz ganz weit. Er warf Anna immer wieder dankbare Blicke zu, denn allein hätte er sich kaum zu einem solchen Ausflug aufraffen können.
Müde und zufrieden kehrten sie nach Wildenberg zurück. Und beim gemeinsamen Abendbrot waren auch Josef Brinkmeier und die Hausperle Afra dabei. Man unterhielt sich angeregt, die Stimmung war heiter. Als Max kurz die Stube verließ, um eine Flasche Wein aus dem Keller zu holen, sagte sein Vater mit offener Anerkennung zu Anna Stadler: »Das verdankt der Max nur dir. Wenn du bei ihm bist, Anna, dann ist er wieder der Alte.«
»Aber es hält net lang vor«, warf Afra skeptisch ein. »Der Max hat keine Freude mehr an seiner Arbeit. Jeden Morgen kommt er mit griesgrämiger Miene zum Frühstück. Und jeden Abend hockt er unglücklich droben in seiner Wohnung. Ich sag es euch, das nimmt kein gutes Ende. Daß die Julia ihm das aber auch antun mußte!«
»Bist auch der Meinung?« fragte Josef Anna, die sich ihre Antwort gut überlegte. Sie stand noch unter dem Eindruck des schönen gemeinsamen Nachmittags. Aber sie wußte auch, daß es wenig Sinn hatte, sich etwas vorzumachen.
»Ich glaube, die Afra hat Recht. Der Max ist in eine richtige Krise geraten. Seit die Julia fort ist, geht es ihm schlecht, auch wenn er das jetzt nimmer so direkt zeigt. Es müßte was geschehen, glaube ich.«
»Du hast schon viel für ihn getan«, warf die Hauserin ein.
»Ich meine ja auch net, daß ich etwas ändern kann. Wißt ihr, ich bin für den Max nur eine gute Freundin, mehr net. Ich kann ihm ein bissel beistehen, aber seinen Trennungsschmerz, den kann ich ihm net abnehmen. Und der setzt ihm eben doch arg zu.«
Brinkmeier senior rieb sich nachdenklich das Kinn, dann beschloß er: »Ich rede morgen mal mit dem Lukas und der Tina. Wenn einer den Max richtig einzuschätzen weiß, dann ist es sein Bruder. Und der wird gewiß auch einen Einfall haben, wie wir ihm noch helfen können, damit er endlich seinen Kummer vergißt.«
»Lade den Lukas und seine Frau halt zum Mittagsmahl ein«, schlug die Hauserin dem alten Landarzt vor. »Der Max wird sich freuen, sie zu sehen. Und ein bissel nette Gesellschaft ist nie verkehrt.« Sie warf der jungen Apothekerin einen vielsagenden Blick zu. »Wenn er nur sein Herz für dich endlich entdecken würde, dann hätten alle Sorgen auf einen Schlag ein Ende.«
»Leider geht es im Leben nicht immer so, wie man es sich wünscht«, seufzte Anna da. »Leider…«
*
Lukas Brinkmeier und seine Frau Tina erschienen am nächsten Tag pünktlich zum Mittagessen. Sie brachten auch ihren kleinen Sohn mit, den sie nach seinem Onkel genannt hatten. Max freute sich stets, seinen Namensvetter und Neffen zu sehen. Er nahm das Baby gern auf den Schoß, das sich bei ihm überaus wohl fühlte. Zu viert verbrachte man ein paar nette Stunden, doch auch Lukas bemerkte, daß mit seinem Bruder etwas nicht stimmte.
Nach dem Essen legte Tina das Kind schlafen, Max und Lukas saßen noch in der guten Stube beisammen. Die Brüder sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Während Max sandblondes Haar wie der Vater hatte, kam Lukas nach der früh verstorbenen Mutter. Er war ein dunkler Typ mit samtbraunen Augen. Und auch was das Temperament anging, unterschieden die zwei sich wie Tag und Nacht. Max war ausgleichend und verständnisvoll, Lukas leicht erregbar und aufbrausend. Früher waren sie wie Hund und Katze gewesen, denn der Bauer hatte sich dem Studierten unterlegen gefühlt und war oft neidisch gewesen. Seit er mit der patenten Tina verheiratet war, die ihm Selbstbewußtsein vermittelte, hatte sich das Verhältnis der Brüder gebessert. Und nur deshalb war es nun auch möglich, daß Lukas offen fragte: »Was ist los mit dir, Max? Du hast dich verändert, bist nimmer so wie früher. Ist das die Schuld von der Julia? Oder steckt noch mehr dahinter? Magst dich net aussprechen?«
»Es liegt an der Trennung von der Julia, das stimmt schon«, gab der Landarzt nachdenklich zu. »Seit sie fort ist, habe ich an nix mehr richtig Spaß. Sogar mein Beruf ist mir einerlei geworden, ist nur noch eine lästige Pflicht.«
Lukas war ehrlich überrascht, das zu hören. »Ich kann mir das net wirklich vorstellen. Du hast dir hier in Wildenberg doch einen Namen gemacht, die Leut’ respektieren dich, sie zählen auf dich. Das ist eine Leistung, auf die du stolz sein kannst. Und du bist ein guter Arzt, das weißt schon selbst.«
Der junge Mediziner lächelte schmal. »So hättest früher net mit mir geredet, Lukas. Ich freu’ mich, daß wir uns jetzt besser verstehen. Und deshalb will ich auch ganz ehrlich zu dir sein. Wenn einer käme und die Praxis übernehmen wollte, ich würde net nein sagen. Weißt, als ich nach Wildenberg zurückgekommen bin, da ist’s in erster Linie aus Pflichtgefühl geschehen. Ich konnte und wollte den Vater net im Stich lassen. Er hat schon nach meinem Examen damit gerechnet, daß ich in die Praxis einsteige. Meine Jahre in Afrika, die hat er mir fei übel genommen.«
»Aber das ist doch alles längst vergessen«, warf Lukas ein.
»Schon. Und bis vor kurzem bin ich auch mit meinem Leben hier zufrieden gewesen. Obwohl ich was Entscheidendes vermissen mußte. Aber weißt, ich hab’ heimlich immer damit gerechnet, daß die Julia mir folgt. Und als sie dann wirklich gekommen ist, da war ich einfach nur glücklich. Ich hab’ mir schon die Hochzeit ausgemalt. Die Praxis haben wir zusammen geführt, alles war perfekt. Daß ich jetzt wieder allein da stehe, kann ich net akzeptieren. Mein Leben kommt mir so leer und sinnlos vor.«
»Du bist net allein, Max. Es gibt hier in Wildenberg viele Leut’, denen du wichtig bist. Und deiner Familie sowieso. Schau, wenn ein bissel Zeit vergangen ist, dann wirst…«
»Eben das glaube ich net, daß die Zeit was ändert. Ich habe zu lange warten müssen auf etwas, das sich nur als Traum, als Luftschloß entpuppt hat. Und damit kann ich net umgehen.«
Lukas stutzte. »Du denkst doch net daran, nach Afrika zurück zu gehen? Willst wieder im Buschspital arbeiten?«
Davon wollte sein Bruder allerdings nichts wissen. »Freilich net. Ich laufe der Julia nicht nach, das kommt überhaupt net in Frage. Sie hat es nicht einmal für nötig gehalten, mir ins Gesicht zu sagen, daß sie mich verläßt. Sie hat einfach entschieden, über meinen Kopf hinweg. Daß ich das hinnehmen muß, ich bitter genug. Aber Zugeständnisse kannst von mir keine mehr erwarten. Die Zeiten sind vorbei.«
»Max, meinst net, daß du zu hart reagierst?« Tina hatte leise die Stube betreten und setzte sich nun zu den Brüdern an den Tisch. Sie lächelte ihrem Schwager lieb zu und versicherte ihm: »Wir verstehen deinen Kummer, und wir sind für dich da, wennst uns brauchst. Aber du solltest die Julia nicht völlig aus deinem Leben streichen. Meinst net, daß das ein bissel unfair wäre?«
»Unfair? Und was ist das, was sie gemacht hat?«
»Schau, du bist verletzt und unglücklich. Und das ist ja auch kein Wunder. Ich finde es auch net recht, daß die Julia einfach ohne ein Wort abgehauen ist. Das hätte sie net tun sollen. Aber vielleicht konnte sie auch net anders. Wenn ihr wieder für eine Weile getrennt seid, wird ihr womöglich bewußt, was sie wirklich will. Und wenn sie dann zurückkommt, wird es für immer sein.«
»Mei, ich weiß nicht…« Dr. Brinkmeier schaute seine Schwägerin und seinen Bruder nachdenklich an, dann beschloß er: »Ich geh’ ein bissel an die frische Luft. Seid mir net böse, aber im Moment würde ich einfach gern allein sein.«
»Ist schon recht«, versicherte Lukas. »Wir sehen uns nachher noch.« Er schaute seinem Bruder hinterher, und als die Tür hinter ihm klappte, meinte er: »Es ist ärger, als wir gedacht haben. Er denkt daran, alles hinzuwerfen. Daß die Julia einfach fort ist, hat ihm das Herz gebrochen.«
»Hast was erreichen können?« fragte nun Josef, der eben die Stube betrat. »Ich hab’ den Max weggehen sehen.«
»Ich fürchte, es geht ihm schlechter als befürchtet.«
Der alte Landarzt erschrak. »Und was können wir tun?«
»Ich glaube, der Max braucht einfach mal Abstand zu allem«, meinte Tina. »Wie wär’s, wenn wir ihm einen Urlaub schenken? Er muß ja net weit weg fahren. Schließlich haben wir hier im Berchtesgadener Land die schönste Natur. Aber eine oder zwei Wochen auf einem Hüttel, mitten im Grünen, das würde ihn gewiß aufmöbeln. Ihr wißt doch, wie er die Natur liebt.«
Josef nickte. »Das ist eine gute Idee. Ich werde mich gleich darum kümmern. Da muß ja einiges organisiert werden.«
»Brauchst Hilfe, Vater?« fragte Tina gleich, doch Josef winkte ab. Er freute sich, wenn er mal wieder ein wenig gefordert wurde. Der Ruhestand, in den ihn sein krankes Herz gezwungen hatte, wurde ihm beizeiten fad.
»Das schaffe ich schon allein, keine Angst. Aber ihr dürft dem Max nix verraten. Erst wenn alles perfekt ist, wollen wir ihn vor vollendete Tatsachen stellen.«
»Und warum? Ich finde, wenn er schon in Urlaub fahren soll, dann muß er das doch zumindest wissen, oder?« Tina schaute ihren Mann an, der abwinkte und mit leiser Ironie behauptete: »Wenn der Max vorher was erfährt, können wir das Ganze vergessen. Kennst ihn doch. In seinem jetzigen Zustand, da vergräbt er sich daheim und hat zu nix mehr Lust. Und zum Wegfahren fehlt ihm ganz gewiß die Energie.«
Josef war der gleichen Meinung. »Wenn er aber erfährt, daß die Vertretung schon bereitsteht und ein Hüttel in den Bergen auf ihn wartet, ja mei, was will er da machen? Dann bleibt ihm nix anderes übrig, als zuzustimmen.« Brinkmeier senior lächelte angedeutet. »Das hoffe ich zumindest.«
*
Drückende Schwüle lag über der kleinen Missionsstation im Hochland von Ruanda, gut fünfzig Kilometer südlich der Hauptstadt Kigali. Schwere bleigraue Wolken hingen über dem tropischen Wald, in dem das Konzert des Lebens an diesem Tag noch lauter und intensiver war als sonst. Jedenfalls empfand Dr. Julia Bruckner es so. Die schöne Ärztin mit dem kastanienbraunen Locken und den himmelblauen Augen rieb sich die Stirn, hinter der ein dumpfer Schmerz pochte.
Seit Julia wieder in Holy Spirit war, hatte sie bereits alle Gefühlsregungen von Unsicherheit über Skrupel bis hin zum handfesten schlechten Gewissen Max Brinkmeier gegenüber durchgemacht. Als der erste Blitz schwefelgelb über dem Giftgrün des Dschungels aufflammte, erhob die junge Medizinerin sich und trat hinter das schmale Fenster des Ärztebüros. Sie blickte eine Weile nach draußen, wo der Wind auffrischte und es zum ersten Mal an diesem Tag möglich machte, durchzuatmen. Dabei gingen Julias Gedanken auf Wanderschaft.
Sie dachte an den Tag, als sie nach Wildenberg gekommen war. An das glückliche Strahlen in Max Brinkmeiers Augen, an das wunderbare Gefühl, heimgekommen zu sein. Die wenigen Wochen, die sie im Heimatdorf ihres Freundes verbracht hatte, erschienen ihr im nachhinein wie ein kostbares Geschenk oder ein angenehmer Traum, an den man immer wieder gerne zurückdachte.
Für eine Weile hatte Julia sich eingeredet, daß sie alles hinter sich lassen und mit Max in Wildenberg glücklich werden könnte. Doch es war nur ein frommer Selbstbetrug gewesen. Dies hier war ihre Welt, die Station, die Kranken, denen sonst niemand half, weil sie arm und unbedeutend waren. Sie besaßen keine Krankenversicherung, sie konnten sich nicht mal ein Busticket nach Kigali leisten. Ohne die Arbeit der Ärzte und der frommen Schwestern in Holy Spirit waren sie hilflos einfachen Krankheiten ausgeliefert, die in Europa mit ein paar Tabletten kuriert wurden, hier aber den Tod bedeuten konnten.
Bei ihrer Rückkehr nach Ruanda war Julia ihre eigentliche Motivation wieder so richtig zu Bewußtsein gekommen. Und sie war überzeugt gewesen, das Richtige zu tun. Ging es um ihre Arbeit, dann empfand sie diese Überzeugung nach wie vor. Doch ihr Leben, das erschien der jungen Frau momentan wie ein einziges Chaos. Sie vermißte Max schrecklich. Schon ungezählte Male hatte sie den Hörer in die Hand genommen, um ihn anzurufen. Aber dann hatte ihr doch der Mut gefehlt. Sie ahnte, wie sehr sie ihn enttäuscht und verletzt hatte. Und sie fürchtete sich davor, daß er sie abweisen könnte, daß er nicht mehr in der Lage war, ihr zu verzeihen. Eine schreckliche Vorstellung…
Der Himmel öffnete seine Schleusen, Julia wandte sich vom Fenster ab und kehrte an den Schreibtisch zurück. Sie hatte eigentlich einige Krankenblätter aktualisieren wollen. Doch sie war einfach nicht in der Lage, sich zu konzentrieren. Und die bohrenden Kopfschmerzen machten ihr zudem zu schaffen. Mit einer knappen Bewegung langte sie in eine Schreibtischschublade und nahm ein Pillendöschen heraus. Sie ließ eine Tablette in ein Glas Wasser fallen, als jemand von der Tür her sagte: »Das sollten Sie nicht tun. Es könnte zur Gewohnheit werden.«
Sie blickte auf und in die hellblauen Augen von Tom Kennedy. Der schottische Hüne mit dem brandroten Haar lächelte ihr ein wenig zu. »Schauen Sie mich nicht so böse an, Julia. Ich habe nur dafür gesorgt, daß sich aufhören, sich etwas vorzumachen und sich wieder Ihrem Leben stellen. Oder habe ich Sie vielleicht mit Gewalt in den Flieger nach Kigali gesetzt?«
»Habe ich das behauptet?« Sie stürzte die übelschmeckende Pillenbrühe herunter und murmelte: »Lassen Sie mich bitte in Ruhe, Tom. Ich habe zu tun.«
»Was denn? An Max denken?« Sie wollte ihm heftig widersprechen, doch er meinte lässig: »An dem Krankenblatt sitzen Sie jetzt seit einer Stunde. Schützen Sie keine Arbeit vor, wenn Sie nicht mit mir reden wollen. Seien Sie ehrlich.«
»Also gut. Verschwinden Sie!« Julia schüttelte den Kopf. »Ich hasse Sie, Tom! Sie sind daran schuld, daß meine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und das werde ich Ihnen niemals verzeihen. Max bedeutet mir mehr als alles andere.«
»Und warum sind Sie dann nicht in Wildenberg geblieben?«
Sie atmete tief durch und schaute ihn mit undurchdringlicher Miene an. »Sie haben sich in unglaublicher Weise in mein Leben eingemischt. Sie haben mich in eine haltlose Lage gebracht und auch nicht davor zurückgeschreckt, sich mit Max zu raufen. Was hätte ich denn tun sollen?«
»Das jedenfalls nicht. Versuchen Sie nicht, mir den Schwarzen Peter zuzuschieben. Es war Ihre Entscheidung, hierher zurückzukommen.« Er wandte sich zum Gehen, da gab sie leise zu: »Ja, vielleicht stimmt das. Ich fühle mich für die Menschen hier verantwortlich. Ich weiß, daß sie die Station brauchen. Und ich muß Ihnen net sagen, wieviel sie mir bedeutet. Aber es war trotzdem falsch. Ich hätte Max nicht einfach so verlassen dürfen. Das wird er mir nie und nimmer verzeihen.« Damit stand sie auf und schob sich an Dr. Kennedy vorbei nach draußen.
»Ich bin trotzdem froh, daß Sie hier sind«, sagte er in ihrem Rücken, und dabei klang seine Stimme ganz sanft.
Julia schaute sich nicht um, sie ging hinüber in den Trakt der Station, wo die Nonnen ihre Zellen hatten. Oberschwester Mary, die sich im Laufe der Jahre zu ihrer rechten Hand entwickelt hatte, konnte momentan nicht arbeiten, sie hatte sich den Fuß gebrochen. Dieses Malheur war für Julia ausschlaggebend gewesen, Wildenberg zu verlassen und nach Afrika zurückzukehren. Allein auf sich gestellt war Dr. Sörensen nahe daran gewesen, aufzugeben. Denn ohne Marys Hilfe konnte die junge Ärztin nicht arbeiten. Als Dr. Bruckner nun den karg eingerichteten Raum der einheimischen Ordensschwester betrat, monierte diese: »Sie müssen bei mir keinen Hausbesuch machen, Frau Doktor. Ich komme schon zurecht. Wenn ich nur bald den Gehgips kriege und ein klein wenig mobiler bin…«
»Der Gehgips bedeutet net, daß sie gleich wieder herumspringen sollen. Sie müssen sich noch eine Weile schonen, Mary, das ist Ihnen doch sicher klar.«
»Schon, aber ich werde gebraucht. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen Ihnen gegenüber. Das wird nicht besser, wenn ich nur faul herumsitze.«
»Ein schlechtes Gewissen? Ich verstehe nicht…«
»Na ja, eigentlich ist es meine ›Schuld‹, daß Sie wieder hier sind. Nachdem Sie die Station verlassen hatten, ist immer deutlicher geworden, daß Dr. Kennedy und diese Dänin nicht miteinander auskommen. Sie hat keinen Respekt vor ihm, sie hat einfach gemacht, was sie wollte, tagelang krank gespielt und auf dem Sofa gelegen. Sie weiß sehr genau, wie sie den roten Riesen zur Weißglut bringen kann. Und es hat ihr offenbar richtig gut gefallen, ihn zum Narren zu halten. Die Situation war weitaus bedrohlicher als die Zeit, in der Dr. Kennedy weg gewesen ist. Er wollte alles hinschmeißen, wir wußten uns alle keinen Rat mehr. Und da habe ich ihm den Vorschlag gemacht, Sie wieder zurückzuholen. Glauben Sie nicht, daß mir das leicht gefallen wäre. Ich weiß schließlich, daß Sie in Wildenberg glücklich gewesen sind. Aber es war die einzige Möglichkeit, die Station zu retten. Deshalb habe ich ihm diesen Ratschlag gegeben.«
Julia hatte der Nonne aufmerksam zugehört, nun stellte sie aufrichtig fest: »Es war die richtige Entscheidung, Mary. Ich habe das längst eingesehen. Eigentlich hätte ich Holy Spirit nie verlassen dürfen. Es war eine sinnlose Flucht, denn vor seiner Berufung kann kein Mensch fliehen. Das wissen Sie ja auch.«
Die farbige Ordensfrau lächelte verständnisvoll. »O ja, das stimmt. Ich glaube, daß jeder Mensch eine bestimmte Aufgabe in seinem Leben zu erfüllen hat, das steht alles in Gottes Buch geschrieben. Wenn man sich dagegen wehrt, dann wird man nicht glücklich, das geht einfach nicht. Aber ist die Station denn wirklich Ihre Berufung? Sind Sie da ganz sicher? Sie und Dr. Brinkmeier, Sie sind das ideale Paar. Und sie lieben sich aufrichtig, von Herzen. Das ist etwas sehr Kostbares.«
»Ja, ich weiß. Trotzdem habe ich in Wildenberg gespürt, daß meine ›Flucht‹ nicht das richtige Mittel gewesen ist. Ich glaube, ich hätte auf Dauer nicht glücklich werden können mit Max, wenn das so ganz auf Kosten der Station gegangen wäre. Tom hatte da schon recht, man sollte sich nicht drücken.«
»Aber Sie mußten zu viel zurücklassen. Denken Sie denn, daß es für Dr. Brinkmeier und Sie doch noch eine vernünftige Lösung geben kann?« hakte Mary mitfühlend nach.
Julia mußte sie enttäuschen. »Ich hatte nicht den Mut, Max ins Gesicht zu sagen, daß ich wieder nach Afrika gehen, statt dessen habe ich ihm einen Brief geschrieben. Und ich bin überzeugt, er nimmt mir das sehr übel.«
»Dann… ist es aus? Das kann ich nicht glauben.«
Die schöne Ärztin lächelte traurig. »Ich habe noch Hoffnung, denn ich kann Max niemals vergessen und auch unsere Liebe nicht einfach in den Wind schreiben. Aber ich fürchte, vor mir liegen einsame Wochen und Monate. Wenn es überhaupt wieder eine Annäherung zwischen uns geben kann, dann braucht sie Zeit.«
*
»Valerie, du kommst nachher mit mir zum Sennhüttel. Wir haben wieder einen Logiergast. Und das Hüttel muß hergerichtet werden.« Valentin Eggerer wartete gar nicht auf eine Antwort seiner Tochter, er hatte die Küche bereits wieder verlassen.
Maria warf Valerie einen fragenden Blick zu. »Stimmt was net, Tschapperl? Hast Kummer?«
»Ach, weißt, Mama, beim Hüttel treff’ ich mich fei immer mit dem Toni. Wenn da jetzt einer wohnt, geht das ja auch nimmer. Ich weiß wirklich net, was noch werden soll.« Dem Madel traten Tränen in die Augen, die Bäuerin setzte sich kurz zu Valerie, legte einen Arm um ihre Schultern und riet ihr: »Mach dir net zu viele Sorgen. Der Toni steht zu dir, so wie man es sich wünscht. Ich bin überzeugt, daß es für euch beide noch einen glücklichen Ausgang geben wird. Schließlich ist dein Liebster fleißig und net auf den Kopf gefallen. Der bringt es überall zu was.«
Die Hoftochter wischte sich über die Augen und lächelte tapfer. Doch sie hatte natürlich nur zu gut verstanden, was die Mutter ihr mit diesen Worten sagen wollte. »Wenn der Vater net nachgibt, werden wir von hier fortgehen müssen. Davor hab’ ich Angst. Freilich kann der Toni schaffen. Und ich bin ja auch net dumm, als Hauserin kann ich mich leicht verdingen. Aber der Hof ist doch unser Daheim. Für den Toni bedeutet er fast mehr als für mich. Er hängt an dem Betrieb, und er versteht sich gut mit dem Thomas. Es könnte alles so einfach sein…«
»Warte halt ab. Du darfst nur net den Mut verlieren«, meinte die Bäuerin mit Zweckoptimismus.
Nach dem Mittagsmahl machte sich Valentin Eggerer auf den Weg zur alten Sennhütte, seine Tochter begleitete ihn. Das landschaftlich einmalig gelegene Häuschen war vor ein paar Jahren grundlegend renoviert worden. Es gab hier nun Strom und Wasser und alles war nach modernen Maßstäben eingerichtet. Valentin war ein wenig stolz auf seine »Touristenattraktion«, wie er die Sennhütte nannte. Und daß nun sogar ein Doktor dort absteigen wollte, gefiel ihm ganz besonders.
»Der Dr. Brinkmeier wird die Mahlzeiten mit uns einnehmen. Daß du mir ja freundlich zu ihm bist. Wenn er ledig ist und net zu alt, könnte was daraus werden, hast mich?«
Valerie bedachte ihren Vater mit einem Blick, der zwischen Resignation und kalter Wut schwankte. Und ihre Stimme war nicht fest, als sie ihm vorwarf: »Du hast überhaupt kein Herz, Vater. Sonst würdest net so was sagen, wo du ganz genau weißt, daß ich den Toni liebhab’ und keinen anderen!«
»Was soll das Gerede? Ich dachte, ich hätte dir diese Sache verboten. Triffst dich vielleicht heimlich und hinter meinem Rücken mit dem Knechterl? Dann kannst aber was erleben, das verspreche ich dir. Ich hab’ es dem Toni schon gesagt. Freilich würde es mich hart ankommen, ihn entlassen zu müssen. Als Großknecht wird er kaum zu ersetzen sein. Aber ich gebe es net zu, daß er sich ins gemachte Nest setzt und da Bauer spielt.«
»Das würde der Toni nie tun«, versicherte das Madel ihm mit Nachdruck. »Du kennst ihn doch und weißt, daß er ein anständiger Mensch ist. Bitt’ schön, Vater, gib uns halt eine Chance. Du wirst sehen…«
»Das Hüttel scheint gut über den Winter gekommen zu sein«, sagte Valentin und zeigte seiner Tochter so deutlich, daß er ihr überhaupt nicht zugehört hatte. »Ist das erste Mal, daß ich in diesem Jahr hier auffi steige. Wie es ausschaut, treiben sich da heimlich Unbefugte herum.« Er deutete auf ein Taschentuch, das im hohen Gras
lag. Noch ehe Valerie reagieren konnte, hatte der Bauer es aufgehoben und betrachtete es nachdenklich. »Ich mein’ fast, das ist deins. Bist vielleicht hier droben gewesen?«
»Freilich net, was soll ich denn da?« Sie gab sich Mühe, unbeteiligt zu wirken, doch der Bauer nahm ihr das nicht ab.
»Gewiß hast dich mit dem Toni da verabredet, damit ich es net spannen soll.« Er lachte gehässig. »Zu dumm, um ihre sieben Sachen beisammen zu halten. Aber will ihren Vater austricksen.« Er versetzte ihr eine Ohrfeige und fuhr sie an: »Los, ab ins Hüttel. Und daß mir hinterher alles nur so blinkt. Ich komme in zwei Stunden und hole dich ab.« Seine Augen wurden schmal, und seine Stimme klang drohend, als er noch hinzufügte: »Wehe dir, wennst dann net allein bist…«
Valerie verschwand rasch in der Hütte. Der Schlag brannte auf ihrer Wange, doch es war nicht der Schmerz, der ihr zu schaffen machte, sondern die Demütigung, die damit verbunden war. Immer wieder zeigte der Vater ihr, daß er sie nicht für voll nahm.
Das Madel war fast fertig mit der Arbeit, als sich jemand der Sennhütte näherte. Sie hörte den festen Schritt, denn sie immer und überall erkannt hätte, und machte einen langen Hals, um aus dem Fenster schauen zu können. Tatsächlich, Valerie hatte sich nicht getäuscht, es war Toni, der da kam. Erschrocken ließ sie das Staubtuch fallen und eilte nach draußen.
»Schatzerl, da bist ja. Ich hab’ dich schon überall gesucht.« Er wollte sie in seine Arme ziehen, aber sie wehrte ihn ab und mahnte: »Du mußt sofort verschwinden, Toni, der Vater kann jeden Moment kommen, um mich abzuholen. Und wenn er uns zusammen sieht, dann…«
»Was soll schon passieren? Schließlich weiß er Bescheid über uns. Und er kann sich doch vorstellen, daß wir zwei zusammenhalten. Ich finde, das sollten wir ihm beweisen.«
»Ach, Toni, du weißt doch, daß das nix bringt. Es wird nur wieder neuen Streit und Unfried geben. Und das will ich net.«
Der Bursch schaute seine Liebste forschend an. »Ist es dir das net wert? Wollen wir uns weiter ducken und verstecken?«
Noch ehe Valerie etwas dazu sagen konnte, vergrub Toni die Hände in den Hosentaschen und machte sich davon. Sie wußte, daß sie ihn enttäuscht hatte, und das tat ihr sehr Leid. Aber sie hatte einfach zu große Angst, daß der Vater Toni wirklich vom Hof wies, wenn er sie beide hier oben zusammen antraf. Und das wollte Valerie unter allen Umständen vermeiden. Selbst um den Preis, daß ihr Liebster ihr gram war…
*
Max Brinkmeier schaute überrascht auf, als sein Vater das Sprechzimmer betrat. »Stimmt was net? Hast Beschwerden?« wollte er wissen, doch Josef winkte ab. »Mir geht es gut, keine Sorge. Ich wollte dich nur ans Mittagsmahl erinnern. Du weißt doch, daß die Afra es gar net mag, wenn einer zu spät kommt. Außerdem würde ich gerne etwas mit dir bereden.«
»Ich komme gleich, bin fast fertig.« Der junge Landarzt erledigte noch die letzten Eintragungen in den Patientendateien, dann verließ er seine Praxis und stieg die Treppe zur Wohnung seines Vaters hinauf. Josef und Afra standen in der guten Stube und machten beide erwartungsvolle Gesichter. Max stutzte.
»Hab’ ich was vergessen? Irgendein Jubiläum vielleicht?«
»Na, das net. Aber wir haben eine Überraschung für dich, Doktor«, ließ die Hausperle sich vernehmen. »Und die gibt es fei noch vor dem Essen.« Sie warf Brinkmeier senior einen gespannten Blick zu, dieser lächelte und reichte seinem Sohn dann einen verschlossenen Umschlag.
»Was hat denn das zu bedeuten? Hab’ ich am End’ einen Oscar gewonnen?« scherzte Max ein wenig lahm.
»Mach’ es halt auf, dann wirst schon sehen.« Josef nickte Afra zu, die unruhig von einem Fuß auf den anderen trat. »Es war die Idee von der Tina, aber organisiert hab’ ich alles. Und du mußt dir keinerlei Gedanken machen, deine Vertretung steht, zwei Wochen hast zu deiner freien Verfügung. Na, was sagst?«
»Urlaub auf einer Sennhütten bei Wimbach? Aber wie kommt ihr denn auf so einen Einfall, ich meine…« Der junge Mann klang alles andere als begeistert. »Das ist freilich nett von euch, aber es kommt net in Frage. Ich kann doch jetzt nicht einfach so mal für zwei Wochen verschwinden. Das geht net.«
»Freilich geht es. Du hast keine andere Chance, Doktor, und Ausreden gelten überhaupt net«, rief Afra resolut. »Dein Vater hat sich sehr angestrengt, um das möglich zu machen. Der Haselbeck übernimmt die Vertretung und wird sich mit deinem Vater abwechseln. Das kannt net abschlagen, weil du nämlich in Urlaub fahren mußt. Wenn einer eine Erholung nötig hat, dann du. Und wir werden dafür sorgen, daß du sie bekommst.« Sie nickte nachdrücklich. »Jetzt wird gegessen!«
Nachdem Afra die Stube verlassen hatte, fragte Max seinen Vater: »Ist das auch deine Meinung? Denkst wirklich, so ein Urlaub könnte mir helfen? Ich seh’ darin gar keinen Sinn.«
»Wir haben uns alle ein paar Gedanken gemacht, Bub. Dein Bruder war auch der Meinung, daß du mal abschalten mußt. Wir wissen schließlich, wie sehr dich die Abreise von der Julia getroffen hat. Es hätte wenig Sinn, einfach so weiterzumachen wie bisher. Du merkst doch selbst, daß du die Lust an der Arbeit einbüßt. Also fahr nach Wimbach und spann’ mal ein bissel aus. Du wirst sehen, hernach geht es dir besser.«
Der junge Landarzt wirkte noch immer unschlüssig, doch er war nicht mehr völlig ablehnend. Allerdings bat Max sich aus, daß er erst mal über diese Reise nachdenken wolle. Sein Vater gestand ihm das eher widerwillig zu. Und Afra war ganz dagegen.
»Was gibt’s denn da noch zu überlegen? Höchstens, ob du net vielleicht die Anna Stadler mitnehmen solltest…«
Brinkmeier senior bedachte die Hauserin mit einem strafenden Blick, doch Max ging gar nicht auf ihre Worte ein, er schien mit den Gedanken ganz woanders zu sein. Bevor er am Nachmittag zu den Hausbesuchen aufbrach, meinte er aber: »Ich glaube, ich sollte dieses nette Geschenk annehmen. Schließlich habt ihr alle euch was dabei gedacht. Und womöglich wird mir so ein Tapetenwechsel wirklich gut tun…«
»Recht so, Max, das wirst net bereuen«, war Josef überzeugt.
Bereits am nächsten Morgen machte Max Brinkmeier sich also auf den Weg nach Wimbach. Die kleine Gemeinde lag etwa fünfzig Kilometer von Wildenberg entfernt in einem malerischen Tal. Die liebliche Landschaft sagte dem jungen Mann auf Anhieb zu. Ein wenig hob sich seine eher trübe Stimmung, während er den Blick über die Schönheiten der majestätischen Bergwelt gleiten ließ. Die himmelhohen Gipfel des Tennengebirges im Norden wirkten ein wenig nähergerückt, der Untersberg grüßte dagegen aus der Ferne. Es war ein sonniger Sommertag, die Vögel zwitscherten fröhlich in der klaren Bergluft. Max fühlte sich wohl, er dankte seiner Familie im stillen, daß sie ihn quasi zu diesem Urlaub genötigt hatte. Als er der schmalen Dorfstraße zum Hof der Familie Eggerer folgte, konnte er auch einen ersten Blick auf die Sennhütte oberhalb des Tales werfen. Winzig klein wirkte sie aus seiner Perspektive, umgeben vom Grün der Matten und Wildwiesen und traulich beschützt von den gedrungenen Gestalten der Bergkiefern. Die Hütte stand für sich allein, doch Max war überzeugt, daß er sich dort nicht einsam fühlen würde. Er wohnte mitten in der Natur, und das hatte ihm schon immer gefallen.
Als der junge Mediziner wenig später auf dem Eggerer-Hof am Klingelstrang zog, öffnete ihm die Hoftochter. Valerie begrüßte den Gast freundlich und bat ihn ins Haus.
»Mein Vater ist net daheim, aber wir erwarten ihn bald zurück. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch das Hüttel zeigen. Der Weg ist leicht zu finden, es ist net besonders weit.«
»Ja, wenn es Ihnen nicht zu viele Umstände macht, nehme ich Ihr freundliches Angebot gerne an«, erwiderte er.
»Also, dann gehen wir.« Valerie verließ das Haus und zog die Tür hinter sich ins Schloß. In diesem Moment bremste der Jeep des Bauern im Wirtschaftshof. Valentin Eggerer sprang heraus und eilte auf Dr. Brinkmeier zu. Er drückte ihm die Hand und meinte überfreundlich: »Sie können nur der Doktor aus Wildenberg sein. Stimmt’s oder hab’ ich recht? Ja, dafür hab’ ich schon ein Naserl. Ich hoff’, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Ist ja net so übermäßig weit, net wahr?«
Max lächelte schmal, die aufgesetzte Freundlichkeit des Bauern war ihm eher unangenehm. Nur um etwas zu sagen, erklärte er: »Ihre Tochter wollte mir gerade den Weg zum Hüttel zeigen.«
»Die Valerie? Na, so weit kommt es noch.« Valentin lächelte jovial. »Das gehört sich nun wirklich net. Und am End’ landen Sie noch ganz woanders. Den besten Orientierungssinn hat das Madel nämlich net.« Er lachte. »Na, na, das mache ich schon selbst. Kommen Sie nur, Herr Doktor, kommen Sie!«
Max hätte sich gerne von der Hoftochter verabschiedet, doch diese war schon wieder im Haus verschwunden. Sie wollte in die Küche huschen, als ihr Bruder ihr in der Diele entgegenkam und fragte: »Was hast denn, Valerie? Bist sauer?«
»Das kann man wohl sagen. Eben ist der Logiergast angekommen. Und der Vater hat mich vor ihm blamiert. Mei, ich halt’ das nimmer lang aus. Er behandelt mich wie einen Deppen.«
»Nimm’s net so schwer«, riet er ihr. »Wie ist der Logierer denn so? Nett?«
»Weiß ich nicht, er macht einen ganz sympathischen Eindruck. Aber du wirst ihn ja kennenlernen, er ißt doch bei uns.«
»Ja, stimmt. So ein bissel frisches Blut kann nix schaden, oder? Vielleicht nimmt der Vater sich dann in den nächsten zwei Wochen mal zusammen.«
Valerie verzog den Mund. »Schön wär’s, aber ich glaub es net.«
Valentin Eggerer bestritt das ganze Gespräch, während er den Mediziner aus Wildenberg zur Sennhütte führte. Sehr geschickt fragte er Max aus und freute sich im stillen wie ein Schneekönig, weil seine heimlichen Absichten unter einem guten Stern zu stehen schienen. Als er eine Weile später auf den Hof zurückkehrte, nahm er sofort Valerie beiseite und schärfte ihr ein: »Du bist ganz besonders lieb und nett zu dem Brinkmeier, hörst? Er ist noch einschichtig. Stell’ dir nur vor, was das für eine Partie wäre. So einen Schwiegersohn, denn würde ich mir fei gefallen lassen. Also reiß dich am Riemen, Madel. Und enttäusch’ mich net, hörst?«
Die Hoftochter wollte widersprechen, aber der Alte hörte ihr gar nicht mehr zu. Er überlegte bereits, wie er den promovierten Wunschschwiegersohn zu seinem geschäftlichen Vorteil nutzen könnte. Valerie wußte nicht, was sie tun sollte.
»Ich kann doch dem Vater net folgen. Wenn ich diesem Doktor schöne Augen mache, wird der Toni gewiß den Hof verlassen. Er ist eh sauer auf mich. Ach, Mama, ich weiß wirklich nimmer ein noch aus«, beschwerte sie sich bei der Bäuerin.
Maria Eggerer beschloß daraufhin, einmal ein ernstes Wort mit ihrem Mann zu reden. Sie hatte sich bislang immer vor Valentin gefürchtet. Wenn er anfing zu brüllen, wurde sie ganz starr vor Schreck. In diesem Fall aber ging es schließlich um das Lebensglück ihrer Tochter. Und da wollte die Bäuerin notfalls auch mal über den eigenen Schatten springen. Schlimm genug, daß der Bauer seinen Sohn wie einen Knecht behandelte und in seiner Familie nur seine Untergebenen sah. Wenn er nun auch noch versuchte, Valerie unglücklich zu machen, dann ging das eindeutig zu weit. Der Meinung war Maria jedenfalls.
Als sie das Arbeitszimmer ihres Mannes betrat, warf dieser ihr nur einen knappen Blick zu. Er saß über der Buchhaltung, und das war eine Beschäftigung, bei der er nicht gestört werden wollte.
»Valentin, ich muß dir was sagen«, begann die Bäuerin verschämt. Da ihr Mann nicht reagierte, fuhr sie etwas lauter fort: »Du weißt doch, daß die Valerie und der Toni sich gut sind. Wie kannst unserer Tochter da anschaffen, zu unserem Logiergast besonders freundlich zu sein? Ich finde das recht ausgeschamt, wo doch wohl feststeht…«
»Sapperlott, jetzt hab’ ich mich verrechnet.« Der Bauer musterte seine Frau ärgerlich. »Und du hast dich ebenfalls verrechnet, Maria, wennst dir einbildest, daß ich mir was von dir anschaffen laß’. Was da auf dem Hof passiert, das bestimme immer noch ich. Und es kommt überhaupt net in Frage, daß unsere Tochter einen Knecht heiratet. Das verbiete ich!«
»Valentin, bitte, hör’ mir mal zu.« Maria schlug nun sanftere Töne an, sie hoffte, endlich einmal wieder zu ihrem Mann vorzudringen. Doch sein Herz war verhärtet.
»Ich hab’ keine Zeit, also schleich di in deine Kuchel, wo du hingehörst«, knurrte er nur und beachtete sie dann überhaupt nicht mehr. Eine Weile blieb sie noch neben dem Schreibtisch stehen wie eine Bittstellerin. Dann verließ sie leise die Stube und ging hinauf in den ersten Stock zur Kammer ihrer Tochter.
»Hast mit dem Vater geredet?« wollte diese wissen. Die bekümmerte Miene der Mutter gab ihr bereits Antwort, noch bevor diese erklärte: »Es hat keinen Sinn, dein Vater läßt net vernünftig mit sich reden. Ich sag’ dir, was wir machen: Du kümmerst dich net um das, was er von dir verlangt. Kannst freundlich zu unserem Logiergast sein wie zu allen anderen. Und was den Toni und dich angeht; ihr zwei haltet fest zusammen. Versprichst mir das?«
»Aber, Mama, was…«
»Jetzt hörst mir einmal ganz genau zu, Tschapperl: Dein Vater ist ein verstockter und harter Mensch geworden. Er war früher anders, aber es hat keinen Sinn, sich
darüber noch Gedanken zu machen. Ich gebe es nicht zu, daß du wegen seiner Verbohrtheit und Sturschädeligkeit unglücklich wirst. Wenn ihr es gar nimmer aushaltet hier auf dem Hof, dann gehst fort mit dem Toni. Ich hab’ eine schöne Summe gespart, die soll euer Startkapital sein. Nichts ist mir wichtiger, als daß du dein Glück im Leben findest, Valerie.«
»Mei, Mama, ich dank’ dir von Herzen. Aber das wird gewiß net nötig sein. Ich will bleiben und mich durchsetzen, auch wenn ich mich fürcht’. Aber der Hof ist mein Daheim. Der Toni und ich, wir werden es schon schaffen.«
»Ich wünsche es euch von Herzen, Tschapperl. Sollten allerdings alle Stricke reißen, dann kannst auf mich zählen. Ich wollte nur, daß du das weißt…«
*
Max Brinkmeier richtete sich derweil in der Sennhütte oberhalb des Eggerer-Hofes häuslich ein. Bald fand er Gefallen an dem urigen Häusel, das doch keinen Komfort vermissen ließ. Und die Umgebung war einfach herrlich.
Zum Abendessen folgte Max dann dem schmalen Steig, der
hinunter zum Hof führte. Und dabei schaute er sich aufmerksam um, denn die Sonne ging gerade in gleissenden Rottönen unter. Noch war der Feuerball nicht ganz hinter dem Horizont verschwunden und goß sein warmes Licht über der majestätischen Bergwelt aus. Die Spitzen der umgebenden Berge stachen wie schroffe Kare aus purem Gold in den klaren Himmel. Irgendwo sang melancholisch eine Amsel. Und als er sich dem Hof näherte, war das leise Muhen des Viehs auf den Weiden zu hören. Idyllisch war es, beinahe wie in Wildenberg aber doch wieder anders. Max mußte seinem Vater in Gedanken recht geben; so ein kleiner Ortswechsel tat einem einfach gut. Der Kummer, der das Herz des jungen Arztes recht schwer machte, ließ sich zwar nicht so leicht abstreifen wie ein schmutziges Hemd. Aber in der fremden Umgebung wurde er zumindest von den neuen Eindrücken ein wenig in den Hintergrund gerückt. Und das sah Max bereits als Fortschritt an.
Wieder war es Valerie Eggerer, die ihn ins Haus ließ und dabei freundlich meinte: »Sie brauchen net allerweil am Klingelstrang zu ziehen, Herr Doktor Brinkmeier. Kommen Sie nur eini, unsere Tür ist eh nie abgeschlossen.«
»Das werde ich mir merken. Aber ich hab’ eine Bitte: Nennen Sie mich halt Max. Schließlich bin ich da im Urlaub.«
»Sie sind wohl überarbeitet und möchten eine Weile nix von Ihrem Beruf wissen«, vermutete sie. »Also schön, ich will daran denken. Und jetzt kommen Sie bitt’ schön, das Essen steht schon auf dem Tisch.«
»Valerie? Wegen heut Mittag; es war mir ein bissel peinlich, wie Ihr Vater Sie einfach beiseite gedrängt hat. Ich hätte mir gerne den Weg zum Hüttel von Ihnen zeigen lassen. Aber Ihr Vater ist wohl ein recht… bestimmender Mensch, oder?«
Sie warf ihm einen überraschten Blick zu. Dieser nette Landarzt schien ein sensibler Mann zu sein. Er hatte wohl ein besonderes Gespür für seine Mitmenschen. Valerie vertraute Max Brinkmeier spontan und ließ ihn deshalb wissen: »Der Vater ist so, daran haben wir uns alle schon gewöhnt. Er läßt nix gelten und kennt nur seinen eigenen Willen. Aber das braucht Sie ja net zu kümmern, Sie sind schließlich bloß für zwei Wochen da.« Sie hatte das auf eine Weise gesagt, die deutlich ausdrückte, sie beneidete Max. Und er hatte Mitleid mit dem hübschen jungen Madel, das ganz offensichtlich nicht glücklich war…
Valentin Eggerer begrüßte den Logiergast wie einen alten Freund und nötigte ihn, sich neben Valerie zu setzen. Das war Max peinlich, er ließ es sich aber nicht anmerken. Beim Abendessen lernte er den Rest der Familie kennen und konnte feststellen, daß die Eggerer freundliche und sympathische Menschen war. Doch eine gedrückte Stimmung lag über allem, was geredet wurde. Es war beinahe, als sei der Altbauer so etwas wie ein böser Albdruck, der allen Bewohnern des Erbhofes das Leben unnötig schwer machte…
Bald nach dem Essen verabschiedete Max sich, was Valentin Eggerer gar nicht gern sah. Er schlug vor, noch ein wenig zusammen fernzusehen, aber der junge Mann lehnte ab.
»Ich möchte hier ganz abschalten, und dazu gehört für mich eben kein Fernsehen. Dann bis morgen.« Er wandte sich zum Gehen, als er aus dem Augenwinkel heraus gewahrte, wie der Bauer sich in die Herzgegend fasste. Dr. Brinkmeier wandte sich noch einmal um, da ließ Valentin rasch die Hand sinken.
»Haben Sie es sich anders überlegt, Herr Doktor?« wollte er gleich wissen. »Vielleicht doch ein bissel Gesellschaft?«
»Nein, das nicht. Aber ich würde Sie gerne etwas fragen, Herr Eggerer; sind Sie in Behandlung wegen Ihrer Herzbeschwerden?«
Der Angesprochene zeigte sich verblüfft. »Jetzt, woher wissen Sie denn das? Ich hab’ ja noch mit keinem Menschen darüber geredet. Sie sind mir fast ein wengerl unheimlich, Doktor.«
»Dazu gehört net viel. Ihre charakteristische Bewegung. Wenn ich Sie recht verstehe, waren Sie noch net beim Arzt. Wäre es Ihnen recht, daß ich Sie kurz untersuche?«
»Ich weiß net… Das ist doch nicht nötig.«
»Seit wann haben Sie Beschwerden? Bitte, entspannen Sie sich.« Max hörte den Brustraum des Bauern ab. »Ich habe keine Instrumente, aber meinen Notfallkoffer könnte ich morgen mitbringen, der liegt immer in meinem Auto. Das klingt nach einem Herzfehler. Der Blutfluß ist verstärkt, ich vermute, Ihr Blutdruck ist chronisch erhöht.«
»Ich bin doch kein Notfall. Und das bissel Stechen hat nix zu sagen«, wehrte Valentin Eggerer ab. Die Vorstellung, herzkrank zu sein, war ihm total zuwider. Davon mochte er nichts wissen.
»Sie könnten aber einer werden, wenn Sie so leichtsinnig sind. Falls es Ihnen zuwider ist, daß ich Sie untersuche, würde ich Sie bitten, zu Ihrem Hausarzt zu gehen.«
»Ich… will es mir überlegen. Und jetzt ist das Thema für mich erledigt.« Er lachte unbehaglich. »Sie sind doch bei uns im Urlaub. Da will ich Sie net zur Arbeit verführen.«
Max winkte ab. »Ein Arzt ist immer im Dienst. Aber wie Sie wollen, es ist Ihre Entscheidung. Kann ich denn morgen meinen Notfallkoffer mitbringen? Das verpflichtet Sie zu nix.«
»Also gut, wie Sie wollen. Ein rechter Quälgeist sind Sie schon, Herr Doktor.«
»Ja, mag sein, allerdings nur zum Besten meiner Patienten…«
Als Max wenig später den Erbhof verlassen wollte, wartete Valerie am Gartenzaun auf ihn. Sie fragte: »Darf ich Sie zum Hüttel bringen? Ich hab’ eben ein bissel gespitzt und ihr Gespräch mit dem Vater mitbekommen. Ihm fehlt doch nix Ernstes?«
»Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ist Ihr Vater denn nicht in ärztlicher Behandlung?«
»Na, davon will er nix wissen. Ärzte sind für ihn alle Scharlatane.« Sie lächelte. »Das dürfen Sie bitte net persönlich nehmen. Aber der Vater glaubt nun mal, daß er allerweil alles im Griff haben muß. Er würde es nie zugeben, wenn es ihm schlecht geht, er krank ist.«
»Das habe ich mir schon gedacht. Ihr Vater ist wohl ein Patriarch der alten Schule, Valerie. Ich hatte beim Essen das Gefühl, daß Sie alle ein bissel… Na, wie soll ich es ausdrücken? Daß Sie alle unter seiner Fuchtel stehen.«
»O ja, leider.« Die hübsche Hoftochter seufzte schwer. »Der Vater wird das Zepter auf dem Hof nie aus der Hand geben. Er bestimmt einfach über alles. Meinen Bruder behandelt er wie einen Knecht. Und mir will er verbieten, den Burschen zu heiraten, den ich lieb hab’. Es ist schon ein rechtes Kreuz mit ihm, das können Sie mir glauben.«
»Aber Sie sind doch volljährig. Warum gehen Sie net einfach fort und leben Ihr eigenes Leben?«
»Daran haben der Toni, das ist mein Liebster, und ich schon oft gedacht. Aber es wäre net recht. Sehen Sie, Max, mein Bruder sagt, der Hof ist unser Erbe, das kann man net einfach in den Wind schlagen. Wir haben ebenso das Recht, auf dem Hof zu leben wie der Vater. Und der Meinung bin ich auch.«
»Das klingt vernünftig. Aber es bedeutet auch eine Menge Kummer für Sie, net wahr?«
»Ja, leider…«
Sie waren bei der Sennhütte angekommen, Valerie drückte Max zum Abschied die Hand und gab zu: »Mir ist noch nie ein Mensch wie Sie begegnet, wissen Sie das? Sie sind erst ein paar Stunden da bei uns und wissen schon über alles Bescheid. Mei, wenn der Vater nur ein klein wenig von Ihnen hätte, Max, dann wäre das Leben auf dem Eggerer-Hof schöner, das können Sie mir glauben.«
*
Julia Bruckner versorgte zusammen mit Dr. Grete Sörensen einen Kranken, der vor einigen Tagen operiert worden war, und dessen Verbände nun gewechselt werden mußten. Dabei sprachen die beiden Ärztinnen nur fachlich miteinander. Julia vermied es, ein persönliches Wort mit Grete Sörensen zu wechseln.
Seit die junge Dänin sich auf Holy Spirit aufhielt, hatte sie bereits für eine Menge Wirbel und Aufregung gesorgt. Sie hatte gegen Schwester Mary intrigiert, hatte versucht, Tom Kennedy auf ihre Seite zu ziehen, um Dr. Bruckner von der Station zu vertreiben. Und sie hatte Julia das Leben schließlich so schwer gemacht, daß diese ihr Heil in der Flucht nach Wildenberg gesehen hatte.
Aus all diesen Gründen war Julia nicht gerade gut auf ihre Kollegin zu sprechen. Nachdem sie ihre gemeinsame Arbeit beendet hatten, wandte sie sich wortlos ab und wollte gehen, doch Grete bat: »Warten Sie, Julia, ich möchte mit Ihnen reden.«
Nur widerwillig blieb sie stehen. »Was wollen Sie?«
»Gehen wir ins Ärztebüro, da sind wir ungestört. Bitte, es bedeutet mir wirklich viel.«
»Also gut, von mir aus«, gab Dr. Bruckner nach.
Grete Sörensen war eine sehr schöne Frau, doch hinter ihrem makellosen Aussehen verbarg sich ein höchst unsicherer Mensch, dessen Handlungsweise nicht immer nachzuvollziehen war. Nun quälte sie offenbar etwas, und es fiel ihr nicht leicht, es in Worte zu fassen. Julia kam ihr nicht entgegen, sie sah keinen Grund, zu dieser Frau freundlich zu sein, die ihr bereits so viel angetan hatte.
»Ich schäme mich für mein Verhalten Ihnen gegenüber. Schließlich ist es meine Schuld, daß Sie die Station verlassen haben. Und all die Aufregung, die daraus resultiert hat…«
»War das nicht Ihre Absicht? Sie haben doch darauf hingearbeitet, mit Tom Kennedy allein zu sein.«
»Das stimmt so nicht. Ich gebe zu, daß ich am Anfang den Ehrgeiz hatte, Sie zu überflügeln. Aber was dann passiert ist, das lag nicht in meiner Absicht. Die Dinge haben sich irgendwie verselbständigt, alles ist mir über den Kopf gewachsen. Ich wollte nicht, daß es zu alldem kommt, ehrlich!«
»Wozu erzählen Sie mir das?«
»Na ja, ich habe gehofft, daß wir vielleicht besser miteinander auskommen, wenn ich…«
In diesem Moment wurde die Tür zum Ärztebüro aufgerissen, und Tom Kennedy rief: »Julia, kommen Sie sofort mit, ein Notfall!«
Ohne weiter auf Dr. Sörensen zu achten folgte sie dem Schotten, der bereits zum OP eilte.
»Was ist denn los? Was ist passiert?« fragte sie in seinen Rücken, doch er reagierte erst, als sie den kleinen, einfach eingerichteten Operationssaal der Station erreichten.
»Der Junge ist von einer Schlange gebissen worden. Buhla hat es gesehen, konnte es aber nicht verhindern.«
Julia trat an den OP-Tisch, auf dem das Baby der Köchin lag. Der Kleine war mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen, Dr. Kennedy hatte ihn operiert und gerettet. Aus Dankbarkeit hatte Buhla ihrem Kind den Namen Tom gegeben.
»Wie ist sein Zustand?« wollte Julia knapp wissen.
»Kritisch. Arme und Beine sind bereits taub, die Atmung stockt.« Der Schotte spritzte dem Kind ein Gegengift, während seine Kollegin bemüht war, den Kreislauf zu stimulieren. Die Köchin stand fassungslos neben ihnen und murmelte immer wieder: »Ich begreife nicht, wie das passieren konnte. Ich begreife es einfach nicht…«
»Der Blutdruck sackt ab, Herztöne unregelmäßig.« Dr. Bruckner zog eine neue Spritze auf. »Wir müssen ihn stabil kriegen.«
»Seien Sie nicht zu großzügig mit dem Analeptikum, es wird durch das Gegengift in seiner Wirkung verstärkt.«
»Das weiß ich selbst«, murmelte Julia abweisend. Sie massierte das Herz des Babys, dessen Schlag allmählich wieder gleichmäßiger wurde. Tom Kennedy warf ihr einen schwer zu deutenden Blick zu. Es dauerte noch eine Weile, dann ging es dem kleinen Patienten allmählich besser. Doch die Gefahr war noch nicht völlig gebannt. Dr. Bruckner beschloß, beim kleinen Tom zu wachen. Sein großer Namensvetter beruhigte Buhla und schickte sie schlafen. Die Köchin ging nur widerwillig, viel lieber wäre sie doch bei ihrem Baby geblieben.
»Wir sagen Ihnen sofort Bescheid, wenn sich etwas ändert«, versprach der schottische Arzt freundlich.
»Wieso lassen Sie sie nicht hier? Sind Sie um Ihr Frühstück besorgt?« fragte Julia ironisch, nachdem Buhla gegangen war.
»Ich finde es sinnlos, wenn sie sich auch die Nacht um die Ohren schlägt. Reicht es nicht, daß wir beide das tun?«
»Ich brauche keine Gesellschaft. Von mir aus können Sie auch schlafen gehen«, erwiderte Julia unfreundlich.
»Wollen Sie nicht endlich aufhören, mich für Ihre eigene Entscheidung zu bestrafen?« fragte er da direkt. »Ich habe Sie nicht entführt, Sie haben Wildenberg freiwillig verlassen. Und ich finde es nicht sehr anständig von Ihnen, mich jetzt zum Sündenbock zu machen. Ihr schlechtes Gewissen Max Brinkmeier gegenüber ist einzig und allein Ihre eigene Angelegenheit.«
»Sie machen es sich leicht. Ich habe nix anderes erwartet.«
»Julia, nun hören Sie mir mal zu. Ich habe es mir noch nie im Leben leicht gemacht. Als ich von Schottland weg bin, da habe ich schon ein wenig das Gefühl gehabt, als würde ich fliehen. Und vielleicht stimmt das auch. Aber Holy Spirit ist nicht der Ort, an dem man sich vor dem Leben verstecken kann; im Gegenteil. Und ich gebe zu, daß ich schon ein wenig stolz darauf bin, Sie wieder hierher zurückgeholt zu haben. Sie gehören auf diese Station, ohne Sie ist das kein besonderer Ort. Aber mit Ihnen…«
»Reden Sie keinen Schmarrn.« Sie erhob sich und trat an die Wiege, in der der kleine Patient schlief. »Die Temperatur fällt weiter. Scheint so, als hätten wir es geschafft.« Sie setzte sich wieder zu Tom Kennedy und gab zu: »Sie haben Recht, das weiß ich selbst. Auf die Dauer hätte ich ohne meine Arbeit hier nicht leben und glücklich werden können. Sicher, ich habe auch gerne mit Max zusammengearbeitet. Aber das hier ist etwas anderes. Ich hatte nur versucht, es zu vergessen.«
»Und ich habe Sie daran gehindert.«
»Das haben Sie, allerdings.« Sie schaute ihn nachdenklich an. »Sieht so aus, als ob unsere Zusammenarbeit doch von längerer Dauer sein wird.«
»Das hoffe ich sehr.«
»Grete hat mir übrigens mal wieder ein Friedensangebot gemacht. Sie behauptet, daß Sie von nun an kollegial mit uns zusammenarbeiten will. Aber ich traue ihr nicht.«
»Vielleicht meint sie es ehrlich. Die Erfahrung, auf dieser Station ganz auf sich selbst gestellt zu sein, scheint noch nachzuwirken.«
»Ja, mag sein. Trotzdem werde ich zu ihr auf Distanz bleiben. Ich möchte nicht noch einmal so überreagieren. Was aus ihrer letzten Intrige alles erwachsen ist, überblicke ich im Moment noch nicht einmal. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden, wie man so schön sagt. Und ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt möglich sein wird, den Schaden wiedergutzumachen.«
Tom Kennedy schaute Julia bedrückt an. »Max Brinkmeier liebt Sie, das sollten Sie wissen. Wenn Sie ihm Zeit geben, wird sich zwischen Ihnen wieder alles einrenken, davon bin ich überzeugt.«
»Das klingt so, als ob Sie es mir wünschen.«
»Nun, das habe ich nicht gesagt. Aber ich kenne Ihr Sweetheart jetzt und kann mir vorstellen, wie es zwischen Ihnen beiden aussieht. Und ich bin ganz ehrlich: Ich beneide diesen Mann…«
*
Einige Tage vergingen für Max Brinkmeier in angenehmer Gleichförmigkeit. Der junge Mediziner stand morgens zeitig auf, denn er wußte, daß die Sonnenaufgänge in den Bergen besonders eindrucksvoll waren. Die Mahlzeiten nahm er weiterhin auf dem Eggerer-Hof ein, außer wenn er eine längere Wandertour vorhatte. Dann aß er seine Wegzehrung in der freien Natur, was ihn an die Kinderzeit und die Schulausflüge damals erinnerte.
Nach und nach entspannte Max sich und spürte, wie seine Seele zur Ruhe kam. Noch immer war ihm das Herz schwer, wenn er an Julia dachte. Doch Wut und Verbitterung wichen allmählich einem Gefühl des Hinnehmens. Er konnte nichts an seiner Lage ändern, er mußte einfach hoffen, daß die Dinge sich irgendwann wieder in seinem Sinne wandelten. Und bis dahin mußte er abwarten.
Die tiefe Liebe, die Max für Julia im Herzen trug, gewann wieder die Oberhand. Und schließlich schaffte er es, ohne Verbitterung an sie zu denken.
Die erste Woche von Max’ Aufenthalt in Wimbach neigte sich ihrem Ende zu. Er dachte daran, seinen Vater anzurufen, verwarf diesen Einfall dann aber wieder. Immerhin war er hier, um mal abzuschalten und Abstand zu gewinnen. Und dazu gehörte auch eine gewisse Isolation, fand der junge Landarzt. Zudem gefiel es ihm, lange Stunden allein in der schönen, sommerlichen Natur zu verbringen. Doch er sollte nicht mehr sehr lange allein bleiben, auch wenn Max dies noch nicht ahnte…
Am Samstag hatte der junge Mann eine Kraxeltour eingeplant und sich deshalb gleich nach dem Frühstück auf dem Erbhof mit einer Wegzehrung zurück zu seiner Sennhütte begeben. Wie stutzte er aber, als er die Tür offen fand. Und das nicht etwa, weil er vergessen hatte, sie zu schließen. Denn drinnen wartete jemand auf ihn, mit dem Max ganz und gar nicht gerechnet hatte.
»Ja, Anna, wo kommst denn du her? Ich glaub’, ich träume!«
Anna Stadler, die schöne Apothekerin von Wildenberg, lachte fröhlich auf. »Ich hab’ dich überraschen wollen. Hoffentlich bist mir net bös’. Aber ich dachte mir, wenn du es dir hier so gut gehen läßt, dann sperre ich meine Apotheke eben mal für ein paar Tage zu und tue es dir gleich. Schlimm?«
»Überhaupt net, im Gegenteil. Ich freue mich über deine Gesellschaft. Allerdings gibt es hier nicht viel Komfort. Vielleicht solltest dich lieber auf dem Eggerer-Hof einmieten, da hättest ein großes Bad, ein bequemes Bett…«
»Du willst mich wohl los werden«, beschwerte Anna sich. »Wenn ich dir net hier Gesellschaft leisten darf, dann fahre ich eben wieder heim.«
»Schon gut, ich freue mich, wennst bleibst. Aber ich will net schuld an Rückenschmerzen oder einem knurrenden Magen sein.«
Anna lachte. »Keine Angst, ich bin überhaupt nicht anspruchsvoll. Was hast denn heut vor? Wollen wir kraxeln gehen?« Sie schaute ihn offen an. »Oder willst lieber allein sein? Noch hab’ ich mein Sackerl net ausgepackt…«
»Ich freue mich, daß du da bist, Anna. Ganz ehrlich. Und wennst Lust hast, gehen wir wirklich kraxeln.«
Sie strahlte. »Ich zieh’ mich rasch um, dann kann es auch schon losgehen.«
Wenig später machten die beiden sich dann auf den Weg. Max hatte bereits eine Felswand ausgeguckt, die sich von einem geübten Kletterer leicht bezwingen ließ. Anna schaute sich immer wieder um und stellte begeistert fest: »Wunderschön ist es hier! Den Ort hast gut ausgesucht, der kann sogar mit unserem Wildenberg konkurrieren.«
Max mußte schmunzeln. »Es war die Idee meines Vaters, er hat mich quasi in die Verbannung geschickt, weil ich freiwillig doch net weggefahren wäre.«
»Dann solltest deinem Vater dankbar sein«, riet Anna ihm.
Sie schafften die Strecke in zwei Stunden und blieben noch eine Weile bei dem Aussichtspunkt, der einen herrlichen Rundblick bot. Immer wieder entdeckte Anna etwas, das sie Max zeigen mußte.
»Schau nur, wie nah der Königssee ist, wunderbar! Und die Bergwälder sehen hier ganz anders aus. Ist das da unten der Eggerer-Hof? Mei, der wirkt ja wie ein Spielzeug. Ach, Max, ist es net einfach herrlich hier? Die Luft ist so klar, die vertreibt einem die dunklen Gedanken, gelt?« Sie biß sich auf die Lippen, als ihr klar wurde, daß sie doch recht unbedacht daher geredet hatte. »Sei mir net bös’, ich hab’ das nur ganz allgemein sagen wollen.«
»Ich versteh’ dich schon, Anna. Und ich kann dir net widersprechen. Seit ich hier bin, geht es mir besser, ich hocke nimmer herum und grübele den ganzen Tag. Und der Eggerer, ich glaub’, der hat ein Herzproblem. Es juckt mich in den Fingern, ihn gründlich zu untersuchen und zu therapieren. Doch der Bauer ist ein sturer Bock und mag net.«
Als er ihrem Blick begegnete, bemerkte er das befreite Lächeln um ihren schön geschwungenen Mund. »Das hättest noch vor einer Woche net gesagt. Ich freu’ mich, daß du langsam auch wieder Freude an deinem Beruf findest, Max. Das bedeutet, es geht dir wirklich besser. Du überwindest deinen Kummer allmählich.«
»Ich geb’ mir jedenfalls Mühe.« Er lächelte schmal. »Pack’ mer’s wieder? Wenn wir nicht bald absteigen, verpassen wir das Nachtmahl bei den Eggerers. Und ich find’, das wär’ schade.«
»Du willst mich wohl immer noch auf dem Bauernhof unterbringen und nur ab und an besuchen«, frotzelte sie.
Max ging nun auf ihren Ton ein. »In meiner Junggesellenbude bin ich halt der König. Und freche
Madeln haben da gar nix zu suchen.«
»Und liebe Madeln?«
Er grinste. »Darüber mache ich mir lieber keine Gedanken.«
Valentin Eggerer reagierte überhaupt nicht erfreut darauf, daß Max in Begleitung erschien. Und als er Anna als seine Freundin vorstellte, verschloß sich die Miene des Bauern vollends.
Die hübsche Blondine unterhielt sich angeregt mit der Hoftochter, die beiden verstanden sich auf Anhieb. So verlebten Anna und Max einen lustigen Abend auf dem Erbhof und waren bester Dinge, als sie schließlich aufbrachen. Nur eines schien Anna zu irritieren.
»Wieso hast denn behauptet, ich wäre deine Freundin? Das verstehe ich net«, fragte sie Max.
»Sei mir net bös’, es war nur ein kleiner Trick, um den Eggerer ruhig zu stellen. Seit ich hier bin, versucht er mich mit seiner Tochter zu verkuppeln. Ich weiß aber, daß die einen anderen liebhat. Und jetzt wird er es wohl aufgeben.«
»Ach so. Die Valerie ist nett, ihr Bruder auch. Und die Kinder sind allerliebst, so wohlerzogen. Nur der Alte paßt irgendwie net zu den anderen. Er ist allerweil so mürrisch gewesen. Oder lag das nur an meiner Anwesenheit?«
»Der Bauer ist ein sturer Hund, der seine Familie terrorisiert und nix gelten läßt. Die haben es net leicht mit ihm.«
»Max, warten Sie bitt’ schön!« Es war Valerie, die den beiden gefolgt war, und wissen wollte: »Was soll denn nun werden mit dem Vater? Die Mama sagt, er hat Beschwerden, will sich aber nicht untersuchen lassen. Sie haben doch gesagt, daß er zum Doktor muß. Können Sie net noch einmal mit ihm reden?«
Max hob die breiten Schultern. »Ich kann es versuchen, aber nützen wird es gewiß nix. Schließlich kann man niemanden zwingen, vernünftig zu werden. Geht es ihm denn schlechter?«
Valerie nickte zustimmend. »Er streitet es ab. Und eben ist er in die Wirtschaft gegangen. Die Mama macht sich Sorgen. Alkohol ist doch gewiß net gut für sein Herz, gelt?«
»Kaum. Weißt was, Valerie? Ich rede morgen nach dem Frühstück noch einmal mit deinem Vater. Dann bringe ich meinen Koffer mit und untersuche ihn auch. Einverstanden?«
Das Madel atmete auf. »Recht schönen Dank, Max. Es ist mir ja Leid, Sie im Urlaub damit zu behelligen, aber…«
»Ist schon recht, das ist schließlich mein Beruf. Dann bis morgen.« Er wandte sich zum Gehen, Anna stellte fest: »Du bist ja wieder ganz der Alte. Mei, das ist wirklich erfreulich.«
*
In den nun folgenden Tagen verbrachten Anna und Max ihre gesamte Zeit zusammen. Sie unternahmen lange Bergtouren und genossen die schönen Sommertage in vollen Zügen. Doch leider ging nun auch die zweite Urlaubswoche für den jungen Landarzt allmählich zu Ende. Anna stellte es bedrückt fest.
»Ich wünschte, wir könnten noch länger bleiben«, sinnierte sie an ihrem letzten Abend. »Dafür würde ich sogar noch eine Woche auf dem schmalen Gästebett in Kauf nehmen. Oder zwei…«
Max lachte. »Du hast dich tapfer gehalten. Deine Feuertaufe als Sennerin hast fei hinter dir.«
»Kunststück, in Gesellschaft eines netten Senners…« Anna suchte den Blick des jungen Mannes, nun wurde sie ernst. »Sag einmal, Max, meinst, du hast es überwunden und kannst wieder arbeiten wie vorher? Wenn net, solltest vielleicht wirklich noch bleiben. Der Sommer ist lang, und auf dem Hüttel fühlst dich doch wohl. Ich denke, es hat keinen Sinn, etwas übers Knie zu brechen, was einfach seine Zeit braucht.«
Er nickte langsam. »Ich hab’ auch schon darüber nachgedacht. Aber ich glaube, das würde nix bringen. Außerdem will ich den Vater net über Gebühr strapazieren. Es ist mir eigentlich gar nicht recht, daß er sich mit dem Kollegen Haselbeck abwechselt. Ich möchte diese Ausnahme net noch in die Länge ziehen.« Er lächelte Anna zu und drückte leicht ihre Hand. »Es ist lieb von dir, daß du dir Sorgen um mich machst. Aber ich glaube, das ist nimmer nötig. Langsam komme ich auf die Beine.«
»Das ist schön, ich hab’ mich nämlich wirklich um dich gesorgt«, gab sie da ein wenig verschämt zu.
In diesem Moment meldete sich Annas Handy. Max hatte mit Absicht darauf verzichtet, seines mitzunehmen, er wollte nicht erreichbar sein. Nun seufzte er: »Die Zivilisation hat uns wohl wieder. Hoffentlich nix Unangenehmes.«
»Die Nummer kenne ich gar net«, murmelte die junge Frau mit einem Blick auf das Display, dann nahm sie den Anruf entgegen. Sie hörte kurz zu, sprach ein paar knappe Worte und beendete gleich darauf das Gespräch. Zu Max, der sie fragend anschaute, sagte sie: »Drunten auf dem Eggerer-Hof ist was passiert. Das war die Valerie, sie bittet dich, sofort zu kommen. Offenbar hatte ihr Vater einen Zusammenbruch…«
Auf dem Erbhof waren alle in heller Aufruhr, als Anna und Max wenig später eintrafen. Die Bäuerin lief unruhig in der Diele hin und her, Thomas saß bei seinem Vater, der in der guten Stube auf dem Sofa lag, Monika versuchte, ihre Schwiegermutter zu beruhigen. Und die Kinder schlichen wie Schatten herum.
Max betrat die gute Stube und wollte vom Jungbauern wissen, was geschehen sei. Dieser erklärte: »Es hat einen Streit gegeben, der Vater hat sich schrecklich aufgeregt. Es ging wieder mal um die Valerie und den Toni. Er hat geschrien wie net gescheit und wollte sogar handgreiflich werden. Dann ist er von einem Augenblick zum nächsten einfach umgefallen. Damit hat er uns wirklich einen Heidenschrecken eingejagt.«
Der junge Landarzt stellte seinen Notfallkoffer ab. Er mußte nur einen Blick auf den Kranken werfen, um Bescheid zu wissen. »Ruft sofort einen Krankenwagen, er muß ins Spital. Sieht nach einem Infarkt aus.«
Thomas nickte wortlos, man sah ihm an, daß diese Worte ihn geschockt hatten. Nachdem er gegangen war, bat Max Anna, ihm zu helfen. Er tat nun alles, um den Patienten zu stabilisieren.
»Ich lege einen provisorischen Herzkatheter. Bis der Notarzt eintrifft, wird ihn der stabil halten. Hoffen wir nur, daß es net zu lange dauert. Mist aber auch, hätte ich mein tragbares EKG nur mitgenommen. Das könnten wir jetzt gut gebrauchen.«
»Wir schaffen es auch so«, versicherte Anna ihm mit Nachdruck. »Du schaffst es, Max, ich weiß es.«
Er lächelte ihr flüchtig zu, dann machte er sich konzentriert an die Arbeit, und es gelang ihm auch, bis zum Eintreffen des Krankenwagens, den Patienten stabil zu halten. Der Kollege aus der Stadt lobte
die Vorarbeit, er wirkte sichtlich beeindruckt. »Sie haben dem Mann das Leben gerettet, Kollege. Respekt.«
Max wollte davon nichts hören. »Ich habe nur meine Arbeit gemacht«, stellte der bescheidene Mediziner klar. »Hoffentlich wird er durchkommen.«
»Ich danke Ihnen von Herzen, Herr Doktor«, sagte Maria Eggerer da mit tränenschwerer Stimme. »Wäre der Valentin nur net immer so unvernünftig. Wenn er auf Sie gehört hätte…«
»Keiner hat ahnen können, daß so etwas geschieht, Frau Eggerer. Machen Sie sich jetzt net zu viele Gedanken. Ihr Mann kommt schon wieder auf die Beine.«
»Wir fahren ins Spital«, beschloß Thomas. »Mama, du bleibst lieber da, das ist zu anstrengend für dich. Monika, kümmere dich bitt’ schön um die Mama. Die Valerie und ich bleiben im Spital, bis wir etwas erfahren. Dann bis später.«
Nachdem die Geschwister die Stube verlassen hatten, stellte die Jungbäuerin lakonisch fest: »Manchmal hat der Thomas direkt was von seinem Vater. Ich hoffe sehr, das wird bei ihm net zur Gewohnheit werden…«
Obwohl Max Brinkmeiers Erstversorgung dem Kranken das Leben gerettet hatte, zog sich die Behandlung im Spital doch sehr lange hin. Valentin Eggerer wurde operiert, zwei Stents wurden in die betroffenen Herzkranzgefäße eingesetzt, um zu verhindern, daß diese wieder verklebten und einen weiteren Infarkt auslösten. Der Eingriff dauerte länger als zwei Stunden.
Für Valerie war es schwer, dies zu ertragen. Sie zeigte sich überaus erleichtert, als Toni im Spital eintraf. Hilfesuchend schmiegte sie sich in die Arme des geliebten Burschen und murmelte: »Ich fürchte, es ist alles meine Schuld. Mit meinem sturen Beharren hab’ ich den Vater zur Weißglut gereizt. Und jetzt hab’ ich ihn vielleicht sogar auf dem Gewissen.«
»Schmarrn, keiner trägt die Schuld an dem, was passiert ist. Außer vielleicht deinem Vater. Wir haben ihm schließlich nix schlimmes antun wollen. Daß er sich dermaßen aufregt, war falsch und total überflüssig.«
»Ja, das weiß ich natürlich. Trotzdem hab’ ich ein schlechtes Gewissen. Er wird es mir gewiß nachtragen und hernach noch strenger zu mir sein. Ach, Toni, ich wünschte, wir hätten geschwiegen. Den ewigen Unfried halte ich nimmer aus. Und daß der Vater jetzt auch noch so krank ist…«
»Wir können uns doch net auf ewig verstecken«, hielt er ihr ärgerlich entgegen. »Jetzt machst aber mal einen Punkt. Dein Vater hat sich alles selbst zuzuschreiben.«
»So kann ich net denken, trotz allem. Er kann halt nicht anders, das ist seine Art, daß er allerweil alles bestimmen will. Und das haben wir schließlich gewußt«, murmelte sie matt.
Toni stand auf und wandte sich ärgerlich von seiner Liebsten ab. Daß diese sich nicht nur alles von ihrem Vater gefallen ließ, sondern diesen nun auch noch in Schutz nahm, ging ihm zuwider. Er ärgerte sich, daß er Valerie nicht von Anfang an vor die Wahl gestellt hatte, sich zueinander zu bekennen oder gemeinsam den Hof zu verlassen. Nun war die Situation nicht gerade einfacher geworden…
Endlich erschien ein Arzt. Er wandte sich an Thomas und ließ ihn wissen: »Es geht Ihrem Vater den Umständen entsprechend. Wir konnten ihn stabilisieren, allerdings nur auf niedrigem Niveau.«
»Und was bedeutet das?« fragte der Jungbauer ratlos.
»Es kommt jetzt darauf an, wie Ihr Vater sich von dem Eingriff erholt. Wir mußten ihm mehrere Stents setzen, der Infarkt war mittelschwer. Es ist möglich, daß er fürs Erste auf der Intensivstation bleiben muß. Aber das hängt natürlich davon ab, wie sein Zustand sich weiter stabilisiert. Momentan kann ich Ihnen net mehr sagen. Sie müssen einfach abwarten.«
Der Jungbauer bedankte sich und wandte sich an seine Schwester. »Ich rufe rasch die Mama an, damit sie Bescheid weiß. Hernach fahren wir heim. Oder magst noch länger bleiben?«
Valerie schaute zu Toni, der hinter einem Fenster stand und nach draußen blickte. Er wirkte noch immer verärgert. »Ich fahre mit dem Toni zurück. Wir haben noch was zu besprechen.«
»Ist recht.« Thomas warf seiner Schwester einen ernsten Blick zu und mahnte sie: »Du solltest weder dir noch dem Toni Vorwürfe machen. Was geschehen ist, war wirklich nur die Schuld vom Vater. Er muß endlich einsehen, daß wir erwachsen sind und er mit Brüllen gar nix erreichen kann. Vielleicht geht er ja jetzt mal in sich, Zeit wird er dazu genug haben…«
*
Toni wunderte sich, als Valerie neben ihn trat.
»Ich dachte, du bist mit deinem Bruder heimgefahren.«
»Ich wollte mich erst bei dir entschuldigen, Toni. Du hast ja Recht, mit allem. Das weiß ich freilich ganz genau. Aber die Situation ist für mich so schwierig. So lange ich zurückdenken kann, hat der Vater über mein Leben bestimmt. Ich will net sagen, daß ich das gut gefunden hätte; im Gegenteil. Aber ich bin es eben so gewöhnt. Es fällt mir schwer, mich von dieser Vorstellung zu lösen.«
»Aber das mußt, du bist erwachsen. Ich will net sagen, daß du zwischen mir und ihm wählen sollst. Es wäre nicht recht, dich dazu zu zwingen. Aber du mußt vor deinem Vater zu mir stehen, ohne wenn und aber. Nur dann können wir uns durchsetzen. Er glaubt doch, wenn er nur laut genug brüllt, wirst wieder kneifen und er hat gewonnen. Ich wette, dieses Spiel, das spielt er schon, solange du denken kannst und einen eigenen Willen hast.«
Sie konnte ihm nicht widersprechen. Bekümmert stahl Valerie sich in die Arme ihres Liebsten und bat: »Sag du mir, was ich tun soll, ich vertraue dir, Toni.«
»Das wäre auch net recht. Du mußt selbst entscheiden. Wennst mich liebhast, dann steh’ zu mir. Dann werden wir es irgendwann auch schaffen, uns gegen deinen Vater durchzusetzen. Aber du mußt es wirklich wollen. Nur dann können wir es schaffen.«
Das Madel nickte, doch das Herz war Valerie sehr schwer. Nun begriff sie erst, wie weit die Herrschaft des Vaters über ihr Leben ging. Sie hatte sich immer von ihm unterdrückt, ja geknechtet gefühlt. Daß sie aber durch den ständigen Druck verlernt hatte, für ihre eigenen Wünsche einzustehen, das war arg. Und sie fragte sich bedrückt, ob es ihr tatsächlich wieder gelingen konnte, etwas gegen den Vater durchzusetzen…
Freilich konnte davon zunächst einmal keine Rede sein. Einige Tage vergingen, an denen Valentin Eggerer noch keinen Besuch haben durfte.
Max Brinkmeier und Anna Stadler fuhren ins Spital von Berchtesgaden, bevor sie sich auf dem Heimweg nach Wildenberg machten. Sie sprachen mit dem behandelnden Arzt und konnten die Eggerers danach beruhigen.
»Der Zustand Ihres Mannes bessert sich langsam aber nachhaltig«, erzählte Max der Bäuerin. »Sie müssen sich net sorgen, in spätestens drei Tagen darf der Patient auch Besuch haben. Dann können Sie selbst mit ihm reden.«
»Ich danke Ihnen von Herzen, Herr Doktor. Was Sie getan haben, werden wir Ihnen fei nie vergessen. Möchten Sie denn net noch ein bissel bleiben? Wir würden Ihnen gerne eine kostenlose Woche droben im Hüttel schenken, sozusagen als kleines Dankeschön.«
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Frau Eggerer, aber ich muß wieder zurück zu meiner Praxis. Ich wünsche Ihrem Mann alles Gute. Und achten Sie darauf, daß er sich in Zukunft mehr schont. Nach einem Infarkt kann er fei nimmer so mitarbeiten wie bisher. Aber wie ich die Sache sehe, ist die Nachfolge auf Ihrem Hof ja bereits aufs beste geregelt.«
Maria Eggerer seufzte leise. »Ja, das wäre sie schon seit einer Weile gewesen. Wenn der Valentin nur net so ein schlimmer Sturschädel wäre. Ich hoffe sehr, der Herzkasper hat ihn von seiner sturen Haltung geheilt…«
Doch der Wunsch der Bäuerin sollte sich nicht erfüllen, zumindest nicht auf Anhieb. Als Maria ihren Mann einige Tage später das erste Mal im Spital besuchen durfte, gab dieser sich knurrig und griesgrämig wie eh und je.
»Was wollt’s denn alle da? Man kann ja ersticken bei der Menschenmenge«, beschwerte er sich. »Ihr spekuliert wohl schon darauf, mich zu beerben, gelt? Aber da geht nix, ich werde hundert Jahre alt, das hab’ ich mir fest vorgenommen!«
»Und das wird dir gewiß auch gelingen«, spöttelte Thomas und sagte zu seiner Schwester: »Komm, lassen wir die Eltern allein. Der Vater klingt schon wieder recht gesund.«
Nachdem die Geschwister den Raum verlassen hatten, mahnte Maria ihren Mann: »Sei doch net so unfreundlich zu den Kindern, hast sie schon wieder vor den Kopf gestoßen. Wir haben uns alle große Sorgen um dich gemacht. Und dir fällt nix besseres ein, als zu granteln.«
»Lieg du einmal da mit solchem Zeug im Herzen und laß dir allerweil Vorschriften machen, dann kriegst auch den Verleider«, brummte der Kranke. »Und daheim geht alles drunter und drüber weil der Bauer fehlt. Mei, oh, mei, das ist alles nur die Schuld von der Valerie. Das Madel hat mich dermaßen gereizt…«
»Jetzt machst aber einen Punkt, Valentin Eggerer«, forderte Maria da ärgerlich. »Die Valerie hat nix gemacht, sie will nur den Burschen heiraten, den sie liebhat. Und es gab net den geringsten Grund für dich, dermaßen aufzufahren.«
»Red keinen Schmarrn, ich hab’ jeden Grund, mich aufzuregen. Sie will mir einen Knecht als Bauern verkaufen, aber das kommt nicht in Frage. Aus den beiden wird nix!«
»Wennst net endlich vernünftig wirst und nachgibst, verlierst deine Tochter und deinen Großknecht. An den Gedanken solltest dich besser schon mal gewöhnen. Die Valerie wird net auf ihr Lebensglück verzichten, bloß weil du allerweil deinen Willen durchsetzen mußt. Wennst das willst, bitte. Aber ich warne dich, Valentin, das werde ich dir fei net verzeihen.«
Der Bauer bekam schmale Augen. »Sag einmal, wie redest denn du überhaupt mit mir? Meinst, bloß weil ich im Spital liege, kannst mich wie einen Hans Wurst behandeln?«
»Ich rede so mit dir, wie ich es längst hätte tun sollen, dann wäre vielleicht alles anders gekommen. Wir haben uns viel zu lange von dir unterdrücken lassen. Die Kinder sind erwachsen, die haben ihren eigenen Willen, ihre Pläne. Wennst heimkommst, dann solltest versuchen, sie auch so zu behandeln. Auf Dauer kann es nämlich anders nimmer funktionieren.«
»Und was stellst dir vor? Soll ich mich vielleicht von einem Knechterl regieren lassen?« spöttelte er bissig.
»Der Thomas ist schon lange der Bauer auf unserem Hof, er macht die meiste Arbeit, hat aber nix zu sagen. Ich finde, das sollte sich ändern. Und was den Toni angeht, ich glaube net, daß der was an seiner Stellung auszusetzen hat. Er hat die Valerie lieb und es net verdient, wie ein Heiratsschwindler oder Hochstapler behandelt zu werden.«
»Du nimmst dir ganz schön was raus, Maria. Sei froh, daß ich net so kann wie ich will. Aber das wird sich wieder ändern. Und hernach mußt net glauben, daß ich mir alles von euch gefallen lasse; im Gegenteil.« Er hob die Stimme und polterte: »Wenn ich wieder gesund bin, ziehe ich andere Seiten auf. Ihr werdet noch zu spüren kriegen, daß ich net zum alten Eisen gehöre!«
*
Josef Brinkmeier freute sich von Herzen, als sein Sohn Max heimkehrte. Der junge Landarzt wirkte erholt und ausgeglichen und fast wieder so wie in alten Zeiten. Sein Vater stellte es erleichtert fest. Die Hauserin Afra kochte zur Feier des Tages ein besonders feines Mahl, und Josef packte die Gelegenheit beim Schopfe und lud neben Tina und Lukas auch Anna Stadler zu diesem Essen ein. So saß eine fröhliche Runde am Tisch, Max berichtete von seinen Tagen in Wimbach und ließ auch die Geschichte von despotischen Bauern nicht aus.
»Der Max hat dem Eggerer das Leben gerettet«, erklärte Anna überzeugt. »Er hat hochkonzentriert gearbeitet, es war eine Freude, ihm dabei zuzusehen.«
»Du hast aber net nur zugesehen, sondern auch geholfen«, warf der Mediziner ein. »Und dabei hast dich net eben ungeschickt angestellt, wenn wir schon dabei sind, uns gegenseitig zu loben.«
»Du bist zu bescheiden, Max«, stellte Tina fest. »Du hast wirklich was auf dem Kasten als Mediziner, das hast schon öfter als nur einmal bewiesen. Und wenn man was kann, dann sollte man es sich auch ab und an mal gefallen lassen, daß die anderen einen loben. Das ist doch nix Schlimmes.«
Dr. Brinkmeier wiegte leicht den Kopf, sagte aber nichts. Er mochte es einfach nicht, gelobt zu werden. Wenn er mit seiner Arbeit das gewünschte Ziel erreichte, war er bereits zufrieden.
»Auf alle Fälle war deine kleine Reise ein voller Erfolg«, stellte Lukas nun zufrieden fest. »Es geht dir wieder gut. Und der Vater wird sich gewiß freuen, daß du ihn entlasten kannst.«
Josef nickte. »Ich gebe es net gerne zu, aber ein bissel hab’ ich schon meinen Lehnstuhl vermißt. Zum Glück war die Sprechstunde net so voll wie sonst. Die Erntezeit hat begonnen. Da gehen die Leut’ nur im äußersten Notfall zum Doktor.«
»Ich dank’ dir, Vater, daß du eingesprungen bist.« Max blickte in die Runde. »Zur Feier des Tages trinken wir noch ein Glasel Wein zusammen, einverstanden? Ich bin doch froh, wieder daheim zu sein, das könnt ihr mir glauben.«
»Und wir sind ebenfalls froh.« Lukas lächelte seinem Bruder zu. »Weißt schon, was ich meine, gelt?«
In diesem Moment wurde drunten am Klingelstrang gezogen. Max beschloß: »Ich schaue rasch nach, wer es ist, muß sowieso wegen dem Wein in den Keller.«
Vor der Haustür stand allerdings jemand, mit dessen Besuch der junge Landarzt nicht gerechnet hatte. Es waren Valerie Eggerer und ihr Freund Toni, der einen großen Präsentkorb bei sich trug. Die Hoftochter wirkte ein wenig verlegen, als sie erklärte: »Wir wollten Sie net stören, Max, aber wir waren im Spital und haben auf dem Rückweg einen kurzen Stop eingelegt. Die Mama schickt Ihnen das. Sie hat sich doch bedanken wollen, und wo Sie net länger geblieben sind… Hoffentlich mögen Sie Hausgeschlachtetes.«
Max nahm Toni den Korb ab und bedankte sich herzlich. Dann überredete er das junge Paar, noch auf ein Glas Wein zu bleiben. Anna freute sich besonders, das nette Madel wiederzusehen, gleich fingen die beiden ein Gespräch an. Der junge Landarzt wollte aber auch gerne wissen, wie es ihrem Vater ging. Da wurde Valerie auf einen Schlag ernst.
»Mei, ich fürchte, er hat sich überhaupt net geändert«, berichtete sie mit leiser Stimme. »Die Mama hat im Spital offen mit ihm geredet, sie wollte ihm klar machen, daß er sich jetzt schonen muß und den Jungen das Ruder überlassen. Aber davon hat er nix wissen wollen.«
»Aber deinem Vater muß doch klar sein, daß er in Zukunft nimmer so arbeiten kann wie bisher. Das haben ihm die Kollegen im Spital ganz sicher gesagt.«
»Schon, aber er hält sich net daran. Wissen Sie noch, wie ich Sie gebeten habe, mal mit dem Vater zu reden, weil er sich net hat untersuchen lassen? Da habe ich Ihnen gesagt, daß er alle Ärzte für Scharlatane hält. Und auch daran hat sich wohl nix geändert. Der Vater läßt sich einfach nichts sagen.«
»Das ist allerdings arg«, urteilte Josef Brinkmeier. »Aber ich würde mir an Ihrer Stelle net zu viele Gedanken machen, Valerie. Auch wenn Ihr Vater ein Sturschädel ist, der nie im Leben eine Einsicht hat; sobald er wieder auf dem Hof arbeiten will, wird er merken, daß sein Körper die Grenzen setzt.«
»Findest das net ein bissel riskant, Vater?« Max wirkte unzufrieden. »Das ist sozusagen die Holzhammermethode. Und die kann den Eggerer schneller wieder ins Spital bringen, als er das für möglich hält.«
Brinkmeier senior hob leicht die Schultern. »Es gibt da ein altes Sprichwort, das meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf trifft: Wer net hören will, muß fühlen. Manchmal ist eine solch schmerzliche Erfahrung mehr wert als alle gutgemeinten Ratschläge zusammen.« Er wandte sich an Toni. »Sie müssen nur darauf achten, daß der Bauer sich net gleich wieder übernimmt. Ein zweiter Infarkt könnte böse ausgehen…«
Die Worte von Max’ Vater gingen Valerie nicht aus dem Kopf. Und als sie ihren Vater am nächsten Tag wieder im Spital besuchte, faßte sie sich ein Herz und bat ihn: »Sei vernünftig, Vater, bitte, und hör auf das, was die Ärzte dir raten. Willst mir das versprechen? Ich bitt’ dich von Herzen!«
Valentin war an diesem Tag etwas zugänglicher als sonst, er gab nun zu: »Der Doktor sagt, ich darf vielleicht schon bald heim. Aber ich muß so eine Reha machen, damit mein Zustand sich weiter verbessert. Und in der Zeit kann ich eh nix tun auf dem Hof. Ja, mei, ich gehöre jetzt wohl zum alten Eisen, bin zu nix nutze, mit net einmal sechzig Jahren, das ist bitter.«
»Aber, Vater, das stimmt doch net!« Das Madel sprach nun sehr eindringlich zu dem Kranken. »Weißt, ich hab’ immer gedacht, du bist viel zu streng zu uns, und daß du uns allerweil wie Deppen behandelt hast. Aber ich weiß jetzt, daß du es net bös’ gemeint hast. Es ist halt deine Art. Und weil du uns wichtig bist, sollst uns noch lange erhalten bleiben. Deshalb mußt dich wirklich schonen. Der Thomas und der Toni machen die Arbeit, auf die kannst dich verlassen, das weißt doch.«
»Ich fürchte mich ein bissel vor dem Austrag«, sagte der Bauer da. »Mein Lebtag hab’ ich den Hof geführt. Und jetzt mit einem Mal nur im Lehnstuhl hocken? Ich glaub’, das kann ich net.«
Valerie war richtig stolz, denn zum ersten Mal in ihrem Leben redete der Vater so mit ihr, behandelte sie wie eine Erwachsene. »Das mußt ja auch net. Der Thomas hat gestern gesagt, daß du die besten Geschäfte abschließt. Ich glaube, er wäre froh, wennst das auch weiterhin machst. Und außerdem könntest öfter mal mit der Mama verreisen. Sie hat fei auf viel verzichten müssen in all den Jahren…«
»Und du bildest dir ein, daß ich zu deiner Hochzeit mit dem Toni meinen Segen gebe?« polterte er da, aber es klang schon recht halbherzig. »Ich will, daß du einen gescheiten Burschen heiratest, einen, der dir was bieten kann.«
»Der Toni kann mir ja was bieten. Er hat mich von Herzen lieb, ich glaube, das ist am wichtigsten. Und faul ist er ja auch net gerade, das kannst nicht behaupten.«
»Na ja, wir werden sehen…« Valentin schloß die Augen, denn zu viele Zugeständnisse mochte er an einem Tag auch wieder nicht machen. »Ich bin recht müd’ und mag jetzt schlafen.«
»Ist schon recht, Vater. Ich schaue morgen wieder nach dir.« Mit einem zufriedenen Lächeln verließ das Madel wenig später das Spital in Berchtesgaden und fuhr wieder heim nach Wimbach. Zum ersten Mal, seit Valerie denken konnte, hatte der Vater sie nicht nur angeschnauzt und ihr Befehle erteilt, sondern sie wie einen erwachsenen Menschen behandelt. Es bestand also doch noch Hoffnung, daß die Verhältnisse auf dem Erbhof sich in absehbarer Zeit endlich normalisieren würden…
*
Julia Bruckner lächelte, als Buhla erschien, ihren kleinen Sohn wieder in einem Tuch auf dem Rücken eingebunden. »Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, Frau Doktor. Ohne Sie und den roten Riesen würde mein Tom jetzt nicht mehr leben.«
»Wir sind alle froh, daß es deinem Baby wieder gut geht«, versicherte sie. »Du trägst es jetzt wieder?«
»O ja, ich werde Tom nicht mehr aus den Augen lassen. Dieser eine Schrecken hat mir gereicht. In einer Stunde ist übrigens das Essen fertig.«
Julia nickte und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. »Ich werde pünktlich sein, versprochen.« Eine Weile arbeitete sie konzentriert, dann schloß sie die letzte Krankenakte, zufrieden, daß nun wieder alles auf den neuesten Stand gebracht war. Julias Abwesenheit hatte sich auch auf diesem Gebiet ausgewirkt.
Bevor die Medizinerin das kleine Ärztebüro verließ, um ihre Runde zu machen, griff sie nach dem Telefon und wählte Max’ Nummer. Sie hatte es in den vergangenen Tagen bereits einige Male versucht, aber niemanden erreicht. Im stillen fragte Julia sich, was das zu bedeuten hatte. War Max weggefahren? Oder wich er absichtlich ihren Anrufen aus?
Sie mußte sich keine weiteren Gedanken machen, denn nun meldete sich am anderen Ende der Leitung jemand. Doch es war zu Julias Enttäuschung nicht Max, sondern sein Vater. Sie zögerte kurz, bevor sie ihren Namen nannte.
Josef Brinkmeier stellte freundlich fest: »Julia, das ist nett. Gewiß magst den Max sprechen. Leider ist er aber net daheim, macht Hausbesuche. Kann ich was ausrichten?«
»Ach nein, das ist net nötig. Ich rufe ein andermal an«, beschloß sie und wollte sich verabschieden. Doch Josef hatte etwas dagegen. Offen fragte er Julia: »Wie geht es dir? Bist mit dir selbst und deiner Entscheidung im reinen? Oder magst net darüber reden? Das könnte ich schon verstehen.«
Sie seufzte leise; Max’ Vater kannte sie eben ziemlich gut. »Im reinen bin ich damit noch lange net. Ich glaube, es würde mir gut tun, mit Ihnen darüber zu reden. Aber ich will Sie net mit meinen Problemen belästigen.«
»Das tust gewiß net. Ich höre dir zu, Julia.«
»Ja, wissen Sie, eigentlich wollte ich Wildenberg nicht verlassen. Es war mein fester Wille und Entschluß, zu bleiben. Ich hab’ den Max endlich heiraten wollen. Und das wünsche ich mir auch jetzt noch. Meine Gefühle für ihn haben nix mit meiner Entscheidung zu tun, wieder nach Holy Spirit zurückzukehren.«
»Das habe ich auch net vermutet. Daß ihr zwei euch liebhabt, weiß ich ganz genau. Und der Max weiß es auch.«
»Wirklich? Ich habe ihn schrecklich enttäuscht, das macht mir sehr zu schaffen. Aber ich hab’ auch gespürt, daß mir in Wildenberg etwas fehlt. Ich hab’ Angst bekommen, daß ich mit dem Max nimmer so glücklich sein könnte wie früher, weil ich eben etwas sehr Wichtiges einfach aufgegeben habe. Und als Tom Kennedy mir dann erzählt hat, daß die Station kurz vor dem Aus steht, da konnte ich nimmer in Wildenberg bleiben.«
»So ähnlich habe ich mir das schon gedacht. Und ich glaube, der Max weiß auch Bescheid. Er kennt dich schließlich besser als jeder andere Mensch, net wahr?«
»Glauben Sie denn, daß er mir verzeihen kann?« kam es zögerlich von Julia.
»Das mußt ihn schon selbst fragen. Aber wenn ich dir raten darf, Julia, dann wartest noch mit diesem Gespräch. Es ist dem Max sehr schlecht gegangen, er hat sogar daran gedacht, seinen Beruf aufzugeben. Ohne dich hatte das Leben für ihn einfach keinen Sinn mehr. Er war jetzt zwei Wochen in Urlaub, und ich glaube, er hat sich wieder gefangen. Aber du solltest ihm noch Zeit lassen, in euer beider Interesse, verstehst?«
Julia erschrak, als sie das hörte. Schuldbewußt gestand sie ein: »Ich habe net geahnt, daß es ihn so schwer treffen würde. Das ist wirklich schlimm… Gut, dann halte ich mich an das, was Sie mir geraten haben. Aber eine Bitte hätte ich noch; der Max soll wissen, daß ich weiterhin alles versuchen werde, damit wir irgendwann ein gemeinsames Leben führen können. Ohne ihn werde ich auch hier auf Dauer net bleiben können. Aber wie eine Lösung ausschauen könnte, das weiß ich leider noch net…«
»Ich werde es ihm sagen, Julia«, versprach Josef. »Und ich beneide dich net. Es ist ein schwerer Zwiespalt, in dem du da steckst. Ich wage zu bezweifeln, daß es dafür überhaupt eine Lösung geben kann. Etwas wirst aufgeben müssen, ganz egal, wie du dich entscheidest. Und ob du mit dieser Entscheidung dann leben kannst, ja mei, das muß sich erst noch erweisen…«
Nachdem Julia das Telefonat beendet hatte, saß sie eine ganze Weile in tiefe Gedanken versunken in dem kleinen Ärztebüro. Sie hatte gehofft, sich mit Max versöhnen zu können. Sie sehnte sich schrecklich nach dem Mann, dem ihr Herz gehörte. Und das schlechte Gewissen ihm gegenüber machte ihr nach wie vor sehr zu schaffen.
Nach dem Gespräch mit Josef fühlte die schöne Ärztin sich nicht erleichtert; im Gegenteil. Nun, da sie wußte, wie sehr Max unter ihrer neuerlichen Trennung gelitten hatte, verstärkte sich ihr schlechtes Gewissen noch. Und sie fühlte sich innerlich ganz zerrissen…
»Kommen Sie? Es gibt Mittagessen.« Tom Kennedy, der in die offene Tür getreten war, ohne daß Julia es bemerkt hatte, lächelte schmal. »Oder leben Sie momentan mal wieder nur von Luft und Liebe, Frau Kollegin?«
»Reden Sie keinen Schmarrn«, murrte sie und erhob sich. »Von Liebe kann keine Rede sein. Ich wollte mit Max telefonieren, habe aber nur seinen Vater erreicht. Und der hat mir geraten, mich noch eine Weile bedeckt zu halten. Wie es aussieht, hat meine Rückreise nach Afrika mehr Porzellan zerschlagen, als ich befürchtet habe. Aber was erzähle ich Ihnen davon? Sie sind ja sowieso an allem völlig schuldlos.«
»Habe ich das behauptet?«
Julia stutzte. »Ja, das haben Sie! Oder wissen Sie es nicht mehr? Als ich mich bei Ihnen beschwert habe, war Ihr einziger Kommentar, ich müsse mit meinen Entscheidungen allein zurechtkommen. Das habe ich mir gemerkt.«
Sie durchquerten den großen Krankensaal, der nicht sehr belegt war. Momentan stand über die Hälfte der Betten leer, das Fieber, das in den letzten Wochen viele Kranke nach Holy Spirit gebracht hatte, schien im Abklingen begriffen. Eine alte Frau mit einem Bruch sprach Julia an und wollte wissen, wann sie nach Hause durfte. Die Medizinerin bat sie, noch Geduld zu haben.
»Frau Imwan hat einen gewalttätigen Mann. Er kann zwar nicht mehr arbeiten, aber um sie zu schlagen reicht es noch«, sagte sie zu Tom, der die breiten Schultern hob.
»Wasser auf Ihre Mühle?«
Julia schenkte sich eine Erwiderung, der Schotte gab zu: »Ich fühle mich in gewisser Weise schon schuldig an Ihrem Unglück. Sie sollten wissen, daß ich mit Ihnen fühle. Und wenn die Existenz der Station nicht daran hängen würde, hätte ich Sie nicht aus Ihrem Idyll gerissen.«
»Sehr nett, davon kann ich mir was kaufen.«
»Nun warten Sie mal; ich sage das nicht, um mich bei Ihnen einzuschmeicheln. Es würde mich echt ärgern, wenn dieser Eindruck entsteht. Mir geht es nur darum, ehrlich zueinander zu sein. Ich finde, das ist sehr wichtig.«
»Ja, mag sein. Apropos Ehrlichkeit…« Julia hatte Grete Sörensen bemerkt, die sich in ihrer Nähe
herumdrückte und ganz offensichtlich lauschte. Tom steuerte auf sie zu, nahm ihren Arm und zog sie hinter sich her in den Speisesaal. Die Dänin wehrte sich und protestierte: »Was soll denn der Quatsch? Lassen Sie mich sofort los!«
»Ich habe Sie aber gerne in meiner Nähe, Grete«, erklärte Tom da ruhig. »Dann kann ich besser kontrollieren, was Sie erlauschen und was nicht…«
Dr. Sörensen machte sich mit einer heftigen Bewegung von ihrem Kollegen los, bedachte Julia mit einem giftigen Blick und fauchte: »Na, wunderbar! Da haben sich ja die beiden Richtigen wieder gefunden. Herzlichen Glückwunsch!« Damit rauschte sie geladen von dannen.
»Ganz die Alte«, stellte Julia lapidar fest. »Hätte mich auch gewundert, wenn sie sich wirklich mal ändern würde.«
Tom nickte. »Tja, die Menschen ändern sich eben eher selten. Scheint keinen Hunger zu haben, die Kollegin…«
*
Zwei Wochen später durfte Valentin Eggerer das Spital in Berchtesgaden verlassen. Seine ganze Familie holte ihn ab; Maria, Thomas und Monika mit den Kindern, Valerie und auch Toni. Der Großknecht hatte sich ausschließen wollen, aber das ließ Valerie nicht zu.
»Wenn du net mitkommst, bleibe ich auch daheim«, hatte sie ihn vor die Wahl gestellt. »Ich dachte, wir machen von jetzt an alles zusammen.«
Toni wollte noch immer nicht so recht. »Ich möchte net, daß es gleich wieder einen Streit gibt. Kennst doch deinen Vater. Nachher heißt es wieder, es wäre meine Schuld gewesen. Da bleibe ich lieber auf dem Hof, dann sieht er mich noch früh genug.«
»Also schön, dann fahre ich auch nicht mit.«
»Valerie, ich bitt’ dich…« Toni warf ihr einen widerwilligen Blick zu. »Ich möchte net, daß wegen mir immer eine Mißstimmung bei euch herrscht.«
Das Madel schüttelte ärgerlich den Kopf. »Weißt was, Toni? Du redest einen richtigen Schmarrn daher. Hat es vielleicht in den letzten Wochen eine Mißstimmung gegeben? Der Thomas und du, ihr habt prima zusammengearbeitet. Wenn der Vater das sieht und ihm klar wird, daß er sich wirklich auf euch verlassen kann, dann wird er den Hof übergeben. Und dann können wir auch heiraten. Aber das geht net, wennst dich versteckst und nimmer zu mir stehst. Oder hast schon vergessen, was wir ausgemacht haben?«
Der Bursch lächelte schmal. »Also schön, du hast mich überredet. Ich fürchte, in unserer Ehe werde ich kaum die Hosen anhaben.«
»Na und? Ist doch wurscht. Wer die bessere Idee hat, der soll bestimmen«, meinte Valerie unbekümmert und freute sich, als Toni ihr ein verliebtes Busserl schenkte.
So erschien die Familie Eggerer recht guter Laune und vollzählig im Spital. Und diesmal beschwerte Valentin sich nicht über den »Menschenauflauf«. Er gab sich im Gegenteil nett und verträglich, und man hörte kein rauhes Wort von ihm.
»Er spielt Theater«, war Thomas überzeugt. »Wart’ nur ab, bis wir daheim sind, Monika. Da wird er wieder die Sau rauslassen.«
Die Jungbäuerin war anderer Meinung. »Ich hab’ den Eindruck, als ob dein Vater sich verändert hätte. Er sieht net nur älter aus und hat abgenommen. Es hat für mich den Anschein, als sei er wirklich in sich gegangen.«
Thomas schüttelte mit Nachdruck den Kopf. »Das kannst mir net erzählen. Solange ich ihn kenne, hatte er noch nie eine richtige Einsicht. Der kann sich gar net verändern. Und wenn er mir net persönlich das Gegenteil beweist, werde ich bei meiner Meinung bleiben.«
Monika warf ihrem Mann einen zweifelnden Blick zu. »Also, weißt, Thomas, manchmal erinnerst mich doch sehr an deinen Vater. Die gleiche Sturschädeligkeit.« Er wollte widersprechen, sie nickte. »Und zugeben willst es auch net, um keinen Preis…«
Zurück auf dem Erbhof ließ Valentin Eggerer es sich nicht nehmen, einmal durch alle Ställe zu gehen und durch alle Stuben im Haus. Danach bat er seine Frau, Thomas und Toni zu ihm zu schicken. »Die Madeln können von mir aus auch dabei sein«, gestand er seiner Frau zu, die noch abwartete. »Es geht sie ja schließlich ebenfalls an, was ich zu sagen hab’.«
Maria nickte und wirkte recht zufrieden. Was sie kaum noch zu hoffen gewagt hatte, schien nun endlich eingetreten zu sein. Ihr Mann wurde auf seine alten Tage vernünftig. Die Bäuerin konnte ihr Glück kaum fassen. Bevor sie aber die gute Stube verlassen konnte, richtete Valentin noch einmal das Wort an sie.
»Etwas hab’ ich dir noch zu sagen, Maria. Wegen der Sach’ damals mit dem Knecht, dem Himi; ich weiß schon, daß du da keine Absichten hattest. Der Himi hat dich verehrt, und ich bin fast narrisch geworden vor Eifersucht. Ich hätte es dir net zum Vorwurf machen sollen über all die Jahre, das war falsch. Aber vielleicht können wir die Sach’ ja jetzt noch vergessen.«
»Für mich ist das nie wichtig gewesen. Ich wäre auch net auf die Idee gekommen, daß du mir da was vorwirfst, weil der Himi mich überhaupt net interessiert hat. Schließlich waren damals unsere Kinder noch klein, und wir waren erst ein paar Jahr’ verheiratet. Weißt, Valentin, ich hab’ mich über all die Jahre oft gefragt, warum du so hart und abweisend geworden bist. War das wirklich nur diese dumme Geschichte damals? Das kann ich gar net glauben.«
Der Bauer senkte den Blick. »Es war vielleicht der Anlaß. Aber eigentlich ist es meine Eifersucht gewesen. Ich hab’ allerweil Angst gehabt, dich wieder zu verlieren, Maria. Und wenn einer in deine Nähe gekommen ist, dann hab’ ich rot gesehen.«
Sie schüttelte leicht den Kopf, ehrlich verwundert. »Hab’ ich dir denn jemals einen Grund geliefert?«
»Das net. Aber um eifersüchtig zu sein, da braucht man gar keinen Grund. Es war halt so ein Gefühl, das mir gesagt hat, ich bin vielleicht net gut genug für dich.«
»So ein Schmarrn! Meinst, ich hätte dich dann geheiratet? Aber mit Strenge und Kälte hast nur das Gegenteil erreicht. Mei, Valentin, wennst nur früher einmal so offen und frei mit mir geredet hättest, dann wär’ das Leben auf unserem Hof fei sehr viel schöner und einfacher gewesen, das kannst mir glauben.«
Der Bauer wirkte bekümmert, er atmete tief durch und bat: »Laß uns das doch vergessen. Wir wollen es wenigstens versuchen. Was ich falsch gemacht habe, das will ich an euch wieder gutmachen. Gib mir halt die Möglichkeit dazu, Maria. Dann beweise ich dir, daß jeder Mensch sich ändern kann, wenn er nur will.«
»Also schön, an mir soll es net liegen. Ich hole jetzt die Kinder, dann kannst beweisen, daß du dich tatsächlich ändern magst. So ganz glaube ich nämlich auch noch nicht daran…«
Auch Thomas war und blieb skeptisch. Als sein Vater ihn wissen ließ, daß er beabsichtige, den Hof offiziell zu übergeben, meinte der Jungbauer nur: »Das glaube ich erst, wenn ich die Urkunde in Händen halte.«
»Mei, Thomas, sei halt net so«, bat Monika ihren Mann. »Der Vater zeigt guten Willen. Er wird sich schon an das halten, was er dir versprochen hat. Oder traust vielleicht deinem eigenen Vater nimmer?«
»Laß nur gut sein, Monika, ich kann den Thomas schon verstehen«, erklärte Valentin da zur Überraschung aller. »Ich hab’ dir Unrecht getan, Bursch, das weiß ich selbst. Vielleicht verstehst es, wenn ich dir sage, daß mein Vater mich seinerzeit ebenso behandelt hat. Aber eine Entschuldigung ist das wohl net, das weiß ich schon.«
Der Jungbauer vergrub die Hände in den Hosentaschen und murrte: »Du hast net nur mir Unrecht getan. Die ganze Familie hast ewig unterdrückt.« Monika wollte ihn unterbrechen, aber Thomas beharrte: »Das muß jetzt mal gesagt werden. Wenn sich da wirklich was ändern soll, dann wollen wir auch ehrlich zueinander sein. Die Valerie hast wie ein kleines Kind behandelt und ihr einfach verboten, den Toni zu heiraten. Dabei ist sie schon lange erwachsen. Sie hätte einfach tun können, was sie will. Aber eben das konnte sie nimmer, weil sie das ganze Leben von dir geknechtet worden ist. Und jetzt, wo du krank bist, denkst, es ist so leicht einen Frieden zu schließen?«
»Ich weiß, daß es nicht leicht wird«, gestand Valentin seinem Sohn zu. »Und ich weiß auch, daß du recht hast, wennst dich zornig gibst, mir Vorwürfe machst. Schließlich hab’ ich viele Fehler gemacht. Und wenn ich ehrlich sein soll, hätte ich mich wohl kaum geändert ohne diesen Herzkasper.«
Thomas nickte. »Wenigstens bist in dem Punkt ehrlich.«
»Ich bemühe mich. Also, ihr wißt jetzt, wie die Dinge liegen. Ich möchte dem Thomas den Hof übergeben. Und du, Toni, wirst ein Wohnrecht erhalten. Das stellt dich über die anderen Knechte, als kleine Auszeichnung sozusagen. Ob der Thomas dich als gleichberechtigten Partner anerkennt, das überlasse ich dann ihm. Weil es sein Hof sein wird, wenn ich im Austrag bin. Seid ihr damit einverstanden?«
Der Jungbauer gab nicht gleich eine Antwort, während Toni klarstellte: »Die Idee mit dem Wohnrecht ist nett gemeint, aber das braucht’s net. Daß ich die Valerie liebhab’ und heiraten möchte, hat mit meiner Arbeit auf dem Hof fei nix zu tun.«
»Sei net so bescheiden«, mahnte Maria den Burschen. »Du bist fleißig, wir haben uns immer auf dich verlassen können. Daß der Bauer dir jetzt eine kleine Anerkennung zukommen läßt, ist net mehr als recht.« Sie warf ihrem Mann einen fragenden Blick zu, dieser verstand schon, was sie meinte.
»Was jetzt eure Hochzeit angeht, ja mei, so ganz recht ist es mir net, das muß ich zugeben. Ich hab’ mir halt für die Valerie einen Hoferben gewünscht, der ihr was bieten kann. Aber wenn sie nun mal keinen anderen will als dich, Toni, dann werde ich euch nimmer länger Steine in den Weg legen.«
Valerie fiel dem Vater um den Hals und drückte ihn. »Ich dank dir von Herzen!« Sie lächelte verschämt. »Ist es net seltsam; seit der Max Brinkmeier bei uns gewesen ist, da hat sich alles zum Guten gewandt.«
»Dem Doktor müssen wir noch danken«, warf Valentin ein. »Er hat mir das Leben gerettet.«
»Ist schon geschehen.« Maria nahm die Rechte ihres Mannes in ihre Hände und drückte sie leicht. »Und jetzt solltest dich ein bissel ausruhen, Valentin. Denk dran, was der Doktor im Spital gesagt hat. Du hast versprochen, dich daran zu halten.«
»Und das habe ich auch vor.« Er lächelte zufrieden. »Jetzt, wo ich mit mir selbst und meiner Familie wieder im reinen bin, laß ich es mir gerne gutgehen und leg’ die Füß’ hoch. Und so ein Austrag, der hat fei auch seine Vorteile. Zum Beispiel, daß wir zwei in Zukunft öfter mal verreisen können. Na, Maria, was sagst dazu? Bist dabei?«
»Freilich, nur zu gern.« Sie hängte sich bei ihm ein. »Aber die erste Reise, die geht jetzt in dein Bett. Du mußt nämlich noch eine ganze Weile kürzer treten. Und dafür sorge ich!«
»Und was sagst jetzt?« fragte Monika ihren Mann, nachdem die Eltern die Stube verlassen hatten. »Dein Vater hat sich geändert, das kannst nimmer bestreiten.«
Thomas lächelte schmal. »Laß mal ein paar Wochen vergehen. Dann werden wir erleben, wie ihm der Austrag schmeckt. Und ich kann mir beim besten Willen net vorstellen, daß er allerweil so friedlich bleibt wie heute…«
*
»Die große Ernte wäre eingefahren. Und der neue Traktor wird nächste Woch’ geliefert.« Toni warf dem Jungbauern einen anerkennenden Blick zu. »Hast alles im Griff, Thomas. Darauf kannst stolz sein.«
Der neue Bauer vom Einöd-Hof lächelte zufrieden, als er zugeben mußte: »Es hat sich wirklich alles so entwickelt, wie wir gehofft haben. Damit hab’ ich net gerechnet, das muß ich eingestehen. Daß der Vater auf die Dauer mit dem Austrag zufrieden sein würde, erscheint mir jetzt noch rätselhaft.«
»Die Krankheit hat ihn verändert. So was soll vorkommen.«
»Habt ihr denn jetzt einen Hochzeitstermin festgelegt, die Valerie und du?« wechselte der Bauer das Thema.
»Nächsten Monat soll es soweit sein.« Toni schüttelte leicht den Kopf. »Ich kann es noch immer net recht fassen. Wenn ich dran denke, wie lange das aussichtslos ausgeschaut hat. Und jetzt müssen wir uns nimmer verstecken. Das ist für mich so wie ein kleines Wunder. Weißt, dein Vater hat mich gestern sogar gelobt. Das ist in all den Jahren, die ich jetzt auf diesem Hof arbeite, noch nie vorgekommen.«
»Ja, mei, der Alte schafft es immer noch, uns zu überraschen.«
Am frühen Abend unternahmen Valerie und Toni noch einen gemeinsamen Spaziergang. Es war ein sehr warmer Tag gewesen, der Abend aber brachte angenehmere Temperaturen, und ein kühler Wind wehte vom Gebirge her. Hand in Hand schlenderte das junge Paar über den schmalen Steig, den sie früher oft genommen hatten. Er führte hinauf zur Sennhütte. Diese lag nun wieder verwaist da, doch als heimlicher Treffpunkt hatte sie ausgedient.
»Morgen müssen wir zum Hochwürden, die Trauung besprechen«, sagte Valerie. »Bist einverstanden, wenn wir groß feiern? Ich möchte gern alle Verwandten und Freunde einladen. Nach allem, was wir zusammen durchstehen mußten, finde ich, haben wir uns das verdient.«
Toni drückte ihr ein Busserl auf die blühenden Lippen, zögerte aber mit einer Antwort. Und als sie wissen wollte, was los sei, gab er ein wenig verschämt zu: »Ich glaube net, daß wir uns so ein großes Fest leisten können, Schatzerl. Was ich gespart hab’, das reicht vielleicht…«
»Toni, ich bitt’ dich!« Die hübsche Hoftochter schüttelte nachsichtig den Kopf. »Die Hochzeit richtet fei der Brautvater aus. Ich hab’ schon mit ihm gesprochen, und er ist damit einverstanden.«
»Ich weiß net…« Der Bursch ließ ihre Hand los und wirkte recht bekümmert. »Das gefällt mir net. Ich bin nun mal nur ein Knecht und kein Bauer. Ein so großes Fest, das geht mir zuwider. Es wäre mir viel lieber, wenn wir nur im kleinen Rahmen…«
»Aber mir net! Zählt denn das gar nicht?«
Er blieb stehen und schaute sie streng an. »Valerie, du hast gewußt, wer und was ich bin, als wir beschlossen haben, zu heiraten. Ich will mich net für etwas anderes ausgeben, nur um Eindruck auf die Leut’ zu machen. Das ist nicht meine Art. Entweder heiraten wir im kleinen Rahmen oder aber – gar net.«
Sie starrte ihn ungläubig an, dann rief sie: »Dann eben net! Meinst vielleicht, ich will genauso einen sturen Kerl wie meinen Vater heiraten. Wennst mir so kommst, kannst die Hochzeit vergessen!« Damit wandte sie sich auf dem Absatz um und eilte erbost davon. Toni wußte nicht, was er davon halten sollte. Mißmutig stopfte er die Hände in die Hosentaschen und marschierte zurück zum Erbhof. Nachgeben wollte er aber in keinem Fall, denn er glaubte sich schließlich im Recht.
Valerie eilte in ihre Kammer und warf sich heulend aufs Bett. Sie konnte einfach nicht glauben, wie verbohrt Toni sich ihr gegenüber benommen hatte. Als eine schmale Hand sich auf ihren Rücken legte, blickte sie auf und direkt in das besorgte Gesicht ihrer Mutter, die sie hatte heimkommen sehen.
»Was ist denn los, Valerie? Habt ihr gestritten?«
»Gestritten? Der Toni war gemein zu mir! Stell dir vor, er will keine große Bauernhochzeit. Und wenn ich mich net nach seinen Wünschen richte, dann mag er auch nimmer heiraten. Mei, Mama, ich bin so unglücklich! Die ganze Zeit haben wir uns gegen den Vater behaupten müssen. Und jetzt, wo alles gut sein könnte, da fängt der Toni an, sich genauso damisch zu benehmen. Das ist doch net zu fassen!«
Maria Eggerer machte eine nachdenkliche Miene. »Schau, Tschapperl, in den vergangenen Monaten, da habt ihr zwei fest zusammenhalten müssen, weil so viel Druck von außen kam. Und jetzt, wo das nimmer der Fall ist, zeigt sich halt, daß ihr net immer einer Meinung seid. Ihr müßt erst einmal lernen, euch auch zu streiten. Das gehört nun einmal dazu, wenn man sein Leben zusammen verbringen will.«
»Ich mag mich aber net streiten«, murrte Valerie und schneuzte sich. »Wir können doch vernünftig über alles reden und die beste Lösung suchen. Wozu soll so ein Streit denn gut sein? Davon haben wir schließlich genug gehabt für alle Zeiten.«
Maria seufzte leise. Wie es schien, hatte Valerie tatsächlich nie gelernt, sich auseinander zu setzen. Der Vater hatte sie stets zu allem gezwungen. Und nun versuchte sie einfach, jedem Konflikt auszuweichen. Aber das konnte auch nicht funktionieren.
»Was meinst, Mama? Soll ich nachgeben, um des lieben Friedens willen? Ich kann es net ertragen, wenn der Toni bös’ auf mich ist. Aber ich möchte halt so gerne eine große Bauernhochzeit feiern. Das war schon immer mein Traum.«
»Dann solltest daran auch festhalten.«
»Aber ohne Bräutigam geht das schlecht. Und der Toni hat gesagt, wenn wir es net so machen, wie er will, dann heiraten wir eben überhaupt net. Ich will ihn aber nicht verlieren.«
»Wenn du immer nachgibst, wirst auf die Dauer unglücklich werden, Valerie. So kann eine Ehe net funktionieren. Deshalb kann ich dir nur eines raten: Du solltest auf deinem Standpunkt beharren. Und hernach setzt ihr zwei euch auseinander, solange bis ihr eine Lösung gefunden habt, mit der ihr leben könnt…«
Der Hoftochter gefiel dieser Vorschlag ganz und gar nicht. Sie schlich in den kommenden Tagen um ihren Verlobten herum wie die Katze um den heißen Brei. Zu gerne hätte sie nachgegeben, um sich mit Toni versöhnen zu können. Aber er gab sich zugeknöpft und kam ihr keinen Schritt entgegen. Allmählich packte das Madel da die kalte Wut. Und als Toni am Abend lieber ins Wirtshaus ging, statt mit ihr zusammen zu sein, sagte sie ihm einmal ganz deutlich die Meinung: »Ich bin net dein Depp, Toni Preisler, daß du es nur weißt! Wennst lieber mit deinen Spezln zusammenhocken willst, bitte. Aber dann mußt dich auch nicht wundern, daß ich mal mit einem anderen ausgehe. Es gibt nämlich net nur einen Burschen, dem ich gefalle.«
»Was? Das kann doch wohl net dein Ernst sein«, regte der Bursch sich da auf. »Das kommt überhaupt net in Frage!«
»Ach ja? Und wer will mir das verbieten?« fragte sie lauernd.
»Na, ich! Schließlich sind wir immer noch verlobt. Und ich dulde es net, daß du mit anderen herumziehst.«
»Davon, daß wir zwei verlobt sind, merke ich wenig. Und einen ewigen Verlobten, der was gegen das Heiraten hat, den brauche ich auch net, daß du es nur weißt!«
»Dann heiraten wir eben. Der Termin steht noch. Und ich hab’ keine Lust, mir noch länger von dir auf der Nasen herumtanzen zu lassen. Nach der Trauung bestimme ich, wo es langgeht!«
»Da spiele ich net mit, das kannst vergessen.« Valerie verschränkte die Arme vor der Brust und erklärte entschieden: »Ich lasse mich nimmer unterdrücken, die Zeiten sind vorbei. Entweder ist bei uns zwei jeder gleichberechtigt oder aber du kannst es vergessen.«
»Dagegen habe ich nix. Aber natürlich nur, wennst mich net zu irgendeinem Schmarrn zwingen willst.«
»Schmarrn? Damit meinst wohl eine große Bauernhochzeit.«
»Eigentlich net«, erwiderte er da zu ihrer Verblüffung. »Schau, Valerie, ich hab’ mir das alles noch mal in Ruh’ durch den Kopf gehen lassen. Es stimmt schon, was du gesagt hast, daß der Brautvater die Hochzeit ausrichtet. So ist es Tradition bei uns in Bayern. Und dagegen ist ja auch nix einzuwenden. Wennst also auf einem großen Fest bestehst, dann will ich nachgeben. Aber in Zukunft bereden wir solche Sachen vorher. Es stört mich, wennst einfach zu deinem Vater rennst, und der macht dann den Geldsack auf. So geht das net, hast mich?«
»Warum bist nur so verbohrt, Toni? Wenn wir zwei verheiratet sind, dann gehört dir das alles hier zur Hälfte, dann hast die gleichen Rechte und Pflichten wie mein Bruder. Und ich verstehe net, was daran schlimm sein soll, wenn das auch ein paar Vorteile bedeutet.«
»Das kannst auch net verstehen, weil es dir nie an etwas gefehlt hat. Dein Vater war zwar ein Patriarch, aber materiell hast nix entbehren müssen. Meine Eltern sind arm, ich hab’ nix lernen können und mußte mich als Knecht verdingen. Das ist nichts Schlechtes und ich schäme mich deshalb auch nicht. Aber es fällt mir halt schwer, etwas anzunehmen, das mir wie ein Almosen vorkommt. Deshalb hab’ ich auch so empfindlich reagiert, verstehst mich jetzt?«
»Gewiß.« Sie stahl sich in seine Arme und seufzte leise. »Mei, Toni, wir zwei haben es net leicht miteinander, gelt?«
»Das ist aber doch normal.« Er verschloß ihre blühenden Lippen mit einem innigen Busserl und stellte dann fest: »Feiern wir also so, wie du magst. Wen hast denn alles eingeladen?«
»Viele Leut’. Es wird gewiß ein schönes Fest.«
»Davon bin ich überzeugt. Aber zwei Gäste darfst unter keinen Umständen vergessen, denn denen verdanken wir indirekt ja unser Glück. Weißt, wen ich meine?«
»Freilich.« Sie lachte. »Die Anna und den Max! Die zwei stehen auf meiner Liste an allererster Stelle…«
*
»Ich würde gerne abreisen. Hier halte ich es nicht mehr aus. Und jetzt, wo die Kollegin Bruckner wieder da ist, fühle ich mich sowieso total überflüssig.« Dr. Grete Sörensen ging unruhig im Bereitschaftsraum des Buschhospitals auf und ab. Es war mitten in der Nacht, Tom Kennedy hatte Dienst. Er war nicht erstaunt gewesen, als die junge Frau aufgetaucht war. Schon seit Tagen spürte der sensible Mann, daß sie etwas quälte. Und wie sich nun zeigte, hatte er sich nicht geirrt.
»Sie waren doch am Anfang ganz scharf darauf, diese Klinik zu übernehmen«, hielt der Schotte ihr gelassen entgegen. »Woher der plötzliche Umschwung? Nur weil Sie gemerkt haben, daß es hier nicht nach Ihren Regeln läuft?«
»Das ist es nicht. Alles, was ich tue, ist falsch. Ich habe einen Dauerplatz im Fettnäpfchen. Außerdem ist mir klar geworden, daß Sie und die Kollegin Bruckner ein gutes Team sind. Sie brauchen mich nicht, ich störe nur.«
»Vielleicht haben Sie Recht.« Tom nahm einen Brief aus einer der Schreibtischschubladen, die er benutzte, und erklärte weiter: »Ein Freund aus Glasgow hat mir geschrieben. Wir haben in der Klinik gut zusammengearbeitet und waren auch privat befreundet. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. Und nun denkt er darüber nach, ebenfalls für eine Weile in die Entwicklungshilfe zu gehen…«
Grete war blaß geworden, verkniffen wollte sie wissen: »Und wann kommt er her? Das war es doch, was sie mir sagen wollten.«
»Nun, ich habe ihm noch nicht geantwortet. Vielleicht wäre es besser, ihm abzuraten. Ob er für die Arbeit hier überhaupt geeignet ist, erscheint mir eher fraglich.«
»Aber Sie haben doch gerade behauptet, daß er beruflich etwas auf dem Kasten hat. Oder habe ich das falsch verstanden?«
»Nein, haben Sie nicht. Ich meine es aber nicht aufs Berufliche bezogen. Mir ist nicht ganz klar, wie er sich in unser Team einfügen würde.« Er musterte sie dabei auf eine schwer zu definierende Weise, was dazu führte, daß Grete sich beschwerte: »Sie spielen auf mich an. Ich bin jetzt wohl der Buhmann auf dieser Station. Was immer geschieht, ich trage die Schuld daran. Und Sie werden Ihrem Kollegen abraten, herzukommen, damit ich nicht über ihn herfalle und ihn fertigmache, nicht wahr? Das wollten Sie doch andeuten.«
Tom Kennedy schüttelte leicht den Kopf. »Wissen Sie, Grete, Sie sind eine gute Ärztin, das kann Ihnen niemand absprechen. Aber Sie sind einfach zu dünnhäutig. Wer austeilt, der muß auch einstecken können. Vielleicht denken Sie mal darüber nach…«
Sie starrte ihn erbost an, dann machte sie auf dem Absatz kehrt und wollte den Raum verlassen, als Tom noch eine Frage an sie richtete: »Bleiben Sie oder gehen Sie? Mein Angebot, weiterhin einmal die Woche Ihre Probleme aufzuarbeiten, steht weiterhin.«
Sie drehte sich noch einmal um und fauchte: »Ihr Angebot können Sie sich sonstwo hinstecken! Ich bleibe! Und Ihre Hilfe brauche ich nicht, darauf kann ich verzichten!« Damit verschwand sie endgültig.
Dr. Kennedy lächelte zufrieden. Er nahm den Brief seines Freundes aus dem Umschlag und las ihn noch einmal durch. »Fürs Erste bleibst du besser, wo du bist, David. Holy Spirit ist momentan nämlich ein ziemlich heißes Pflaster…«
Julia Bruckner schlief auch noch nicht. Sie hatte den ganzen Abend überlegt, was sie tun sollte. Zu gerne wollte sie endlich wieder mit Max reden, wenigstens seine Stimme hören. Aber Josef hatte ihr ja geraten, sich noch bedeckt zu halten. Eigentlich hatte sie diesen Ratschlag beherzigen wollen. Die Sehnsucht in ihrem Herzen aber machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Und schließlich entschied sie sich, in die Offensive zu gehen.
In Holy Spirit herrschte tiefste Nacht, während in Wildenberg eben erst der Abend angebrochen war. Es war Sonntag, Max hatte den Nachmittag mit Anna Stadler verbracht. Gemeinsam waren sie ein wenig gekraxelt und hatten dann noch zusammen mit Afra und Josef zu Abend gegessen.
Als das Telefon anschlug, war Anna gerade allein im Zimmer. Max holte eine Flasche Wein aus dem Keller, weshalb die schöne Apothekerin beschloß, den Anruf entgegen zu nehmen. Vielleicht handelte es sich ja um einen Notfall.
»Stadler, hallo?« Sie lauschte angestrengt in den Hörer, doch außer einer Menge Störgeräuschen war nichts zu hören. Als sie bereits auflegen wollte, meldete sich Julia doch noch.
»Hier ist Bruckner, ich würde gerne den Max sprechen.«
Anna blieb die Luft weg. Sie schloß die Augen und brauchte ein paar Sekunden, um antworten zu können. Und was sie dann sagte, das klang alles andere als freundlich. »Ja, Sie haben Nerven! Ich fasse es net! Wie kommen Sie dazu, nach allem, was Sie dem Max angetan haben, hier anzurufen?«
»Anna, ich bitte Sie, das werde ich ganz bestimmt net mit Ihnen diskutieren. Ich möchte den Max sprechen.«
»Ja, das kann ich mir denken. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, daß ich Ihnen auch noch dazu verhelfe. Das ist eine einzige bodenlose Unverschämtheit, wissen Sie das? Nachdem Sie abgehauen sind, ist es dem Max total mies gegangen. Gelitten hat er wie ein Hund. An nix hatte er mehr eine Freude, nix hat ihn aufmuntern können. Er hat sogar daran gedacht, alles hier aufzugeben und fortzugehen, weil ihm das Leben so sinnlos erschienen ist. Und jetzt, wo er endlich wieder ein bissel Spaß an seinem Beruf hat und langsam wieder der Alte wird, da tauchen Sie aus der Versenkung auf und wollen ihm erneut schaden. Das ist net zu glauben.«
»Nun machen Sie aber mal einen Punkt, Anna«, forderte Julia ärgerlich. »Sie mischen sich da in Dinge ein, die Sie überhaupt nix angehen.«
»So? Denken Sie? Dann will ich Ihnen mal was sagen. Der Max und ich, wir waren zusammen im Urlaub, auf einem Sennhüttel bei Wimbach. Wir verstehen uns wirklich gut. Er ist jetzt wieder glücklich. Und ich werde alles tun, um zu verhindern, daß Sie ihn erneut unglücklich machen und enttäuschen.«
Julia schwieg eine Weile, schließlich fragte sie leise nach: »Sie sind zusammen weggefahren? Das kann ich net glauben.«
»Glauben Sie es nur, weil es stimmt. Vielleicht machen Sie sich mal ein paar Gedanken darüber, daß man sein Leben net an zwei Orten gleichzeitig führen kann. Als Sie fortgegangen sind, da haben Sie sich gegen den Max entschieden. Sie können das drehen und wenden, wie Sie wollen. Aber es ist eine Tatsache. Und ich habe Ihnen schon einmal gesagt, daß ich alles tun werde, damit der Max Sie vergißt, wenn Sie ihn wieder verlassen.«
Dr. Bruckner wußte nicht, was sie davon halten sollte. Im Grunde hatte sie bereits etwas ähnliches erwartet. Schließlich wußte sie, daß Anna Stadler in Max verliebt war. Doch daß er sich mit einer anderen trösten würde, noch dazu so schnell, das konnte und wollte sie nicht glauben.
»Wenn Sie konsequent sind, dann lassen Sie Max jetzt in Ruhe«, riet Anna Stadler ihr noch, dann legte sie auf.
Julia ließ den Hörer sinken und blickte eine ganze Weile nachdenklich vor sich hin. Als gegen ihre Tür geklopft wurde, bat sie automatisch »Herein«. Es war Schwester Mary, die mit ihrem Gehgips nun schon wieder recht mobil war.
»Ich habe noch Licht bei Ihnen gesehen, Frau Doktor, und wollte fragen, ob Ihnen etwas fehlt.«
»Setz dich ein wenig zu mir, Mary, ich kann Zuspruch gebrauchen«, bat die junge Ärztin niedergeschlagen.
»Haben Sie Doktor Brinkmeier immer noch nicht erreicht?«
Sie schüttelte den Kopf. Und dann mußte sie unvermittelt weinen. Mary reichte ihr ein Taschentuch und strich ihr mitfühlend über den Arm. »Die Trennung war schlimm, nicht wahr? Als Sie nach Wildenberg gefahren sind, war ich sicher, daß wir Sie hier nie wiedersehen würden.«
Julia schneuzte sich und gab zu: »Ich wollte bei Max bleiben, wir wollten endlich heiraten. Ich habe es mir so sehr gewünscht! Und jetzt frage ich mich, ob ich nicht einen schlimmen Fehler begangen habe. Eben habe ich mit Anna Stadler gesprochen. Es war abzusehen, aber es hat mich doch geschockt zu erfahren, wie sehr sie sich nun anstrengt. Sie versucht alles, um Max für sich zu gewinnen. Und ich kann nix dagegen tun. Ich erreiche ihn ja nicht mal mehr telefonisch. Ach, es ist alles falsch gelaufen. Ich hätte in Wildenberg bleiben müssen. Jetzt habe ich Max vielleicht für immer verloren. Und ich weiß net, wie ich so weiterleben woll. Ich liebe ihn so sehr!«
Schwester Mary nickte. »Ja, das weiß ich. Schließlich haben wir zehn Jahre hier zusammengearbeitet. Und deshalb finde ich, sollten Sie nicht so verzweifelt sein. Dr. Brinkmeier liebt Sie ebenso. Was immer diese Anna Ihnen erzählt hat, es hat nichts zu bedeuten. Sie besitzen sein Herz – für immer.«
Die weisen Worte der farbigen Nonne taten Julia gut und beruhigten ihr aufgewühltes Herz ein wenig. »Ja, wahrscheinlich hast du recht, Mary. Aber ich weiß trotzdem nicht, was werden soll. Die Situation ist so schwierig. Ich sehe keinen Weg.«
»Sie werden ihn finden. Das haben Sie bisher doch immer geschafft«, war die Ordensfrau überzeugt. »Mit unserer und Gottes Hilfe wird es Ihnen gelingen.«
*
Dr. Max Brinkmeier schaute seinen Vater fragend an. »Magst net doch mitkommen? Die Eggerers sind nette Leut’, die würden sich gewiß freuen, dich kennenzulernen.«
»Schließlich bist der Vater vom Lebensretter«, spöttelte Afra, die ein wenig beleidigt war, weil man sie nicht auch eingeladen hatte, an der großen Bauernhochzeit auf dem Einöd-Hof teilzunehmen. »Sicher hättest da einen besonderen Stuhl mit einem Blütenkränzel bekommen…«
Josef warf der Hauserin einen strengen Blick zu und mahnte sie: »Wennst weiterhin so frech bist, muß ich mal andere Saiten aufziehen, Afra.«
»So? Und welche?«
»Vielleicht schicke ich dich in den Ruhestand und engagiere mir eine junge kurvenreiche Hauserin…«
»Ja, damit die Milch sauer wird«, brummte sie und verließ die Stube. Max mußte schmunzeln, sein Vater meinte: »Ich lasse der Anna und dir den Spaß und bleibe daheim. Falls ein Notfall eintritt, sollte im Doktorhaus doch jemand zu erreichen sein.«
»Also schön, wie du willst. Dann bringen wir dir aber wenigstens ein Kuchenpaket mit. Einverstanden?«
Brinkmeier senior lächelte zufrieden. »Sehr.«
Wenig später hatte Max Anna
Stadler in der Rosenapotheke abgeholt, und sie hatten sich gemeinsam auf den Weg nach Wimbach gemacht. Die hübsche Blondine trug ein traditionelles Festtagsdirndl, das ihr gut stand und ihre schlanke Figur vorteilhaft betonte. Max hatte ihr bereits ein Kompliment gemacht und gab sich während der Fahrt sehr aufgeräumt. Ein wenig plagte Anna doch das schlechte Gewissen. Sie dachte daran, Max von Julias Anruf zu erzählen. Aber wenn sie das tat, mußte sie auch zugeben, daß sie die junge Ärztin nicht sehr fair behandelt hatte. Und sie war fast sicher, daß Max ihr das übelnehmen würde…
»Bist so still, Anna. Hast was?« fragte er, als das Gespräch immer einseitiger wurde. »Doch keinen Kummer?« Er seufzte leise. »Ich fühle mich ein bissel schuldig, weil ich dich in letzter Zeit so sehr mit Beschlag belegt hab’. Da ist dein eigenes Privatleben freilich zu kurz gekommen, net wahr?«
Welches Privatleben? hätte sie ihn am liebsten gefragt. Seine Worte bewiesen ihr einmal mehr, daß er sich über ihre wahren Gefühle ihm gegenüber in keiner Weise im klaren war. Und sie hatte keine Lust, ihm ein Licht aufzustecken. In keiner Beziehung. Deshalb lächelte sie ihm lieb zu und versicherte: »Ich melde mich schon, wenn’s wo hakt. Heut’ möchte ich nur das Fest genießen und es mir so richtig gut gehen lassen. Und ich würde mich freuen, wennst öfter mal mit mir tanzt.«
»Nur zu gern.« Er erwiderte ihr Lächeln herzlich. »Darauf freue auch ich mich bereits…«
Auf dem Einöd-Hof herrschte an diesem Tag eine besondere Feststimmung. Bei dem schönen, warmen Wetter waren im Wirtschaftshof lange Bankreihen aufgestellt worden, an denen das Hochzeitsessen serviert wurde. Darüber wehten fröhlich die weiß-blauen Wimpel im Sommerwind. Es gab auch einen Tanzboden, eine kleine Combo spielte lustige Rhythmen, die in die Beine gingen. Das Brautpaar stand natürlich im Mittelpunkt des Interesses. Bildsauber schaute Valerie aus in ihrem traditionellen Hochzeitsdirndl mit einem duftigen Haarkranz, kurzem Schleier und traditionellen Haferlschuhen. Der Bräutigam, schneidig im dunklen Festtagsloden, hatte nur Augen für seine schöne Braut.
Freilich eröffneten die beiden den Tanz mit einem langsamen Walzer, wie es sich gehörte. Federleicht und anmutig lag Valerie in den starken Armen ihres Mannes, und es schien ihr fast so, als könne sie mit Toni mitten in den Himmel hinein tanzen. Bald gesellten sich weitere Paare hinzu, auch Anna und Max schlossen sich nicht aus. Der bunte lustige Reigen erfreute das Auge der älteren Generationen, die es lieber beim Zuschauen beließen.
Als die Tanzmusik eine Pause einlegte, kamen Valerie und Toni auf den Wildenberger Landarzt zu und bedankten sich noch einmal für alles, was er für sie getan hatte.
»Sie können sich gar net vorstellen, wie sehr unser Vater sich verändert hat, Max«, berichtete die Braut mit glänzenden Augen. »Wäre er am Infarkt gestorben, weil ihm keiner rasch genug hätte helfen können, dann hätten wir das nie erleben dürfen. Und das wäre doch wirklich sehr schade gewesen.«
Dr. Brinkmeier konnte ihr nicht widersprechen, und Anna wollte wissen: »Arbeitest du jetzt auch als Bauer auf dem Hof, Toni?«
»Er ist jetzt der zweite Bauer auf dem Einöd-Hof«, stellte Valerie heraus. »Aber so recht gewöhnt hat er sich noch nicht daran. Ich glaube, das braucht einfach seine Zeit.«
»So schwer fällt es mir nun auch net«, merkte der Bräutigam noch an. »Aber du hast mal wieder die Hauptsache vergessen, Valerie. Der Vater hat dir doch was aufgetragen…«
»Ja, freilich!« Sie schlug sich gegen die Stirn. »Sie können jederzeit nach Wimbach kommen und bei uns im Hüttel Urlaub machen, Max. Das hat der Vater beschlossen. Sozusagen ein Wohnrecht im Sennhüttel auf Lebenszeit. Das soll Ihnen zeigen, wie dankbar er für die Lebensrettung ist. Und du, Anna, kannst freilich immer mitkommen.«
»Mei, das ist aber ein großzügiges Geschenk. Da werde ich mich gleich einmal persönlich beim Bauern bedanken«, beschloß Max und ließ Anna kurz allein. Während sie auf seine Rückkehr wartete, dachte sie wieder an das Telefonat mit Julia Bruckner. Sie hatte nicht ganz die Wahrheit gesagt, um Julia abzuschrecken. Daß Max’ Gefühle für sie, Anna, sich nicht geändert hatten, wurde ihr langsam klar. Sie hatte sich nur etwas vorgemacht, da war der Wunsch wohl der Vater des Gedanken gewesen. Anna wurde nun aber klar, daß sie auf diese Weise gar nichts erreichen konnte. Irgendwann würde Max wieder mit Julia sprechen. Und dann würde Annas dumme kleine Lüge gewiß zur Sprache kommen. Das wollte sie nicht, deshalb beschloß sie, mit offenen Karten zu spielen.
Als Max an ihren Tisch zurückkehrte, setzte die Musik wieder ein. Doch Anna verspürte wenig Lust zu tanzen.
»Gehst ein bissel mit mir spazieren, Max? Ich würde gerne unserem Sennhüttel noch einen Besuch abstatten, bevor es dunkel wird«, bat sie ihn deshalb.
Er war zwar überrascht von ihrem Wunsch, zeigte sich dann aber einverstanden. Während sie dem schmalen Steig folgten, wuchs in Max der Verdacht, daß etwas nicht stimmte. Anna gab sich schon den ganzen Tag so einsilbig. Sie mußte etwas auf dem Herzen haben, sonst hätte sie nicht freiwillig auf das Tanzvergnügen verzichtet. Und er sollte sich nicht getäuscht haben.
Als sie die Sennhütte erreichten, sagte Anna: »Es war eine schöne Woche hier heroben. Daran werde ich noch oft zurückdenken. Willst denn noch öfter herkommen?«
»Ich dachte, wir machen mal wieder Urlaub hier«, meinte er unbefangen. »Ich habe die Tage mit dir nämlich auch genossen, Anna. Das weißt sicher.«
»Ja, mag sein. Trotzdem möchte ich dich nimmer begleiten. Es könnte ein Gerede aufkommen. Oder ich… mache mir vielleicht sogar selbst falsche Vorstellungen. Das wäre doch dumm, gelt?«
Er blieb stehen und schaute sie forschend an. »Was hast du nur? Bist schon den ganzen Tag so seltsam. Willst mir nicht verraten, was du auf dem Herzen hast, Anna?«
Sie lächelte schmal. »Dir kann man nix vormachen, Max. Und das will ich auch gar nimmer. Ich hab was Dummes getan, das mir jetzt nachhängt. Und ich würde gerne mein Gewissen erleichtern.«
»Du wirst doch keine Verabredung mit dem Burgmüller getroffen haben«, frotzelte er halbherzig, doch sie ging nicht auf seine Worte ein, gestand ihm: »Als ich am letzten Samstag bei dir war, da hat die Julia angerufen. Du bist gerade im Keller gewesen, hast eine Flasche Wein geholt.«
»Die Julia?« dehnte Max. Seine Miene verhärtete sich. »Was hat sie denn gewollt?«
»Sie wollte dich sprechen. Ich…« Sie fuhr sich mit einer nervösen
Geste durch ihr glänzendes Haar. »Weißt, ich bin ziemlich sauer geworden. Daß sie einfach wieder anruft, nach allem, was gewesen ist, das konnte ich kaum fassen. Ich glaube, ich war recht ruppig zu ihr. Und ich hab’ ihr geraten, dich endlich in Ruhe zu lassen. Als ich dann darüber nachgedacht hab’, da kam mir das schon irgendwie dumm vor. Ich weiß, ich hab’ mich zu was hinreißen lassen, das war net recht. Und im Grunde geht mich das ja auch gar nix an. Ich wollte einfach, daß du Bescheid weißt. Und ich hoffe sehr, du bist jetzt net zu sauer auf mich, weil ich mich eingemischt habe.«
Max schwieg eine Weile, seine Miene war verschlossen, er gestattete es Anna nicht, darin zu lesen. Und sie ließ ihm Zeit, sich ihre Worte noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen.
Schließlich ließ er sie wissen: »Ich mache dir keinen Vorwurf, das käme mir nie in den Sinn. Im Grunde genommen bin ich froh, daß die Julia mich net erreicht hat. Ich glaube, ich bin noch net soweit, daß ich wieder auf normale Art mit ihr reden kann. Und telefonische Vorwürfe sind ja auch nicht unbedingt erstrebenswert, net wahr?«
»Du bist mir net bös’?« Anna atmete auf. »Darüber bin ich sehr froh. Ich hatte nämlich Angst, daß ich vielleicht unsere Freundschaft zerstöre, wenn ich dir die Wahrheit sage. Aber es hat mich auch belastet, deshalb konnte ich net schweigen.«
»Du hast richtig gehandelt.« Er lächelte ihr zu. »In jeder Beziehung. Was mich betrifft, so wird noch einiges an Zeit vergehen müssen, bis ich wieder etwas von Julia hören will. Aber auf deine Gesellschaft möchte ich nimmer verzichten, Anna. Was ist, wollen wir uns noch ein bissel in den Festtrubel stürzen, bevor alles vorbei ist?«
Sie lachte befreit auf und nahm die Hand, die er ihr hinhielt. »Gern! Aber nur, wenn wir keinen Tanz mehr auslassen!«
»Oje, meine armen Füße.« Der junge Mediziner verdrehte die Augen. »Was tut man net alles für die Frauenwelt…«
So verlief das schöne Fest auf dem Einöd-Hof in Wimbach für alle Beteiligten zur vollsten Zufriedenheit. Valerie und Toni erlebten den wahrlich schönsten Tag ihres Lebens und genossen ihr Glück in vollen Zügen. Monika und Thomas tanzten ausgelassen wie ein frisch verliebtes Paar, und selbst Valentin mochte sich beim langsamen Walzer nicht ausschließen. Maria war ganz fasziniert von dem »neuen« Mann an ihrer Seite, der so gar nichts mehr mit dem griesgrämigen Patriarchen gemein hatte, der auf dem Erbhof mehr als gefürchtet gewesen war.
Und auch Anna und Max verlebten einen entspannten Tag und freuten sich beide, daß ihre Freundschaft den ersten Sturm so gut überstanden hatte. Und während der junge Landarzt seine schöne Begleiterin beim langsamen Walzer im Arm hielt, da gingen Annas Gedanken und Sehnsüchte einmal mehr auf Wanderschaft. Denn schließlich wußte man ja nie so ganz genau, was die Zukunft bringen konnte, und ob es nicht doch noch irgendwann eine Erfüllung für ihre heimliche Liebe geben würde…