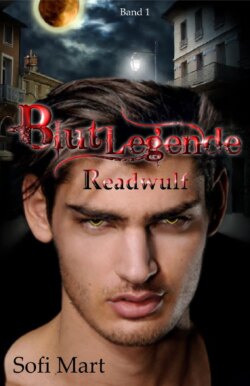Читать книгу Blutlegende - Sofi Mart - Страница 4
Kapitel 1
ОглавлениеUngewohnte Gerüche
Dem Mann, dessen Kopf zwischen Readwulfs Händen lag, blieb keine Zeit zur Gegenwehr. Seine Halswirbel knackten laut, bevor er leblos zurück in den Sessel sank. Readwulf hasste dieses Geräusch, das ihm wie auf einer Tafel kratzende Fingernägel durch den Rücken fuhr. Jetzt war es totenstill im Raum, nur das verglimmende Holz im Kamin knisterte. Einige Augenblicke verharrte Read reglos hinter seinem Opfer. Seine Augen leuchteten in der Dunkelheit. Die Anspannung fiel nur allmählich von ihm ab und auch das goldbraune Feuer um seine Iris wurde zögernd schwächer. Als es erlosch, verschwand er ebenso lautlos und unbemerkt, wie er gekommen war.
Regen prasselte auf Londons Straßen und ein kalter Wind rüttelte an den Dächern der Häuser.
Unter anderen Umständen hätte Readwulf in wenigen Sekunden an seinem Wagen sein können, der in einer dunklen, verlassenen Seitenstraße parkte. Dennoch passte er sein Tempo vorsichtshalber dem normaler Menschen an. So blieb es nicht aus, dass er bis auf die Knochen durchnässt wurde. Der immer heftiger werdende Wolkenbruch kam Readwulf vor, als wolle er hinter ihm alle Spuren verwischen und ihn von seiner Tat reinwaschen. Aber das wäre wohl selbst einer Sintflut nicht gelungen. Zahlreiche Leben hatte er in den letzten Jahren ausgelöscht. Wie viele genau, konnte er nicht sagen und gewiss würden seinem heutigen Opfer noch Dutzende folgen.
Der schrille Ton, der die Entriegelung der Autotür begleitete, riss Readwulf aus seinen Gedanken. Er schüttelte die durchnässten Haare, bevor er in den silbernen Jaguar einstieg. Dann zog er das Handy aus der Tasche und ließ seinen Daumen eilig über die Tastatur gleiten:
Balkeney hat abgesagt. Ich melde mich später wieder.
Die Nachricht verschickte er an den einzigen Mann, der mit dieser Mitteilung etwas anfangen konnte: Bruder Darius Fairfax. Der Geistliche war nicht nur sein Auftraggeber, sondern auch sein Ziehvater und damit der einzige Vater, den er kannte. Ihm verdankte er seinen Namen und sein Leben. Darius hatte ihn auf den Stufen des Klosters entdeckt und sich des Säuglings angenommen.
Readwulf legte den Kopf in den Nacken und schloss für ein paar Minuten die Augen, als er zu seinem Erstaunen bereits eine Antwort bekam. Gewöhnlich vergingen einige Tage bis Fairfax sich auf seine Nachrichten hin meldete. Er nahm das Telefon, blickte verwundert auf das Display und las:
Bleib ein paar Tage bei deiner Cousine, sie hat nach dir gefragt.
Was sich für Außenstehende auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Familienangelegenheit angehört hätte, versetzte Readwulfs Körper einen starken Adrenalinstoß. Schließlich wusste er, dass es sich hier um alles andere als den Besuchswunsch einer Verwandten handelte.
Ein neuer Auftrag in London, dachte er und betrachtete im Rückspiegel sein ihm fremd gewordenes Gesicht, bevor er den Wagen langsam in Bewegung setzte.
Kurz nach Mitternacht betrat Readwulf die Lobby des London Hilton on Park Lane Hotel. Als der Concierge ihn bemerkte, erhob sich der Mann von seinem Stuhl, hielt einen Umschlag hoch und rief: »Mr. Fairfax, es wurde soeben etwas für sie hinterlassen.«
Readwulf nahm seine Post entgegen, inspizierte kurz die leere Vorhalle und lehnte sich gespielt lässig an den Empfangstresen: »Vielen Dank, Albert. Gut, dass ich sie noch antreffe. Ein Termin hat sich verschoben, deshalb muss ich noch ein paar Tage in der Stadt bleiben. Ist mein Zimmer kommende Woche frei?«
»Selbstverständlich Mr. Fairfax. Ihre Suite steht Ihnen so lange zur Verfügung, wie sie wünschen«, säuselte der schmächtige Mann freundlich nickend und reichte ihm die Zimmerkarte.
Das Einchecken in Hotels war für ihn ebenso zur Routine geworden, wie seine Tarnung als erfolgreicher Geschäftsmann. Anfangs empfand er es als Abenteuer, in fremden Betten zu schlafen und etwas von der Welt zu sehen. Doch inzwischen langweilte es ihn. Der Tick, immer das gleiche Zimmer zu buchen, hatte sich wie beiläufig eingeschlichen. Es war für Readwulf von Vorteil, die Notausgänge von Zimmern zu kennen. Fairfax bevorzugte Zimmer, die man auch durchs Fenster verlassen konnte. Er war ein gern gesehener Gast, kultiviert und großzügig mit dem Trinkgeld. Eine Kombination die ihn beim Personal durchaus beliebt machte und eine gewisse, wenn auch erkaufte Loyalität mit sich brachte.
Kaum in der Suite angekommen, warf Readwulf den Umschlag mittig auf das Doppelbett und ging ins Badezimmer. Dort entledigte er sich seiner durchnässten Kleidung und zog sich einen Bademantel an. Wieder am Bett angelangt, nahm er seine Post an sich. Das Kuvert enthielt lediglich ein Foto.
»Eine Frau!«, stieß er erstaunt hervor und dabei kräuselte sich seine Stirn. Nicht, dass er Skrupel hatte, aber Frauen und Kinder befanden sich bislang nicht unter seinen Opfern.
In der Regel erhielt er alle notwendigen Informationen über seine Zielpersonen. Da gab es korrupte Anwälte und Richter, Mediziner, die illegal an Menschen experimentieren, und Politiker, die über Leichen gingen. Die machthungrigen Staatsdiener verachtete er am meisten. Sie zu töten ließ sich zumindest im Ansatz moralisch rechtfertigen. Nahm er nicht Leben um Leben zu schützen? Galt nicht das alte Sprichwort: Auge um Auge, Zahn um Zahn? Hatten sie nicht alle den Tod verdient? Schließlich war es bisher weder der Polizei noch den Gerichten gelungen, ihnen die Taten offiziell nachzuweisen.
Diesmal war der Inhalt des Umschlages spärlich: Nur ein Foto, keine Akte?
Intuitiv drehte Readwulf das Bild um. Auf der Rückseite fand er lediglich eine Londoner Adresse. Der darüber liegende rot durchgestrichene Kreis war das vereinbarte Zeichen. In der Ausführung gewährte Darius ihm freie Hand. Anfangs hatten die Zielpersonen entweder einen tragischen Autounfall oder erlagen den Folgen eines unglücklichen Sturzes. Mit der Zeit wurde Readwulf kreativer. Ein paar Mal kam ihm das hohe Alter seiner Opfer oder deren allergische Reaktionen zugute.
Nachdem er das Papier erneut umdrehte, betrachtete er die vermeintliche Verbrecherin intensiver. Jemand hatte sie schräg von unten geknipst, als Bewerbungsfoto würde man es sicher nicht verwenden können. Zudem stand sie hinter einer leicht spiegelnden Fensterscheibe. Readwulf schätze sie auf Anfang zwanzig. Die blond gelockten Haare fielen über schmale Schultern. Das Gesicht war unscharf, doch sah sie für ihn eher wie ein Engel als der Teufel aus. Er schüttelte den Kopf und legte das Bild auf den antiken Sekretär. Er hatte genug von diesem Tag. Auch wenn solche Aufträge seit Jahren zu seinem Leben gehörten, ans Töten gewöhnte er sich nie. Die anschließende heiße Dusche tat ihm gut und einen Minibar-Whisky später sank er müde in die schneeweißen Hotellaken.
***
Mein Wecker klingelte um sechs Uhr, doch sofort aufstehen - keine Chance! Seit Monaten fühlte ich mich morgens wie erschlagen, als würde ich Nacht für Nacht einen Marathon laufen.
Zweimal drückte ich die Schlummertaste, bevor ich mich gegen halb sieben widerwillig aus meinem Bett quälte. Der Weg ins Bad führte am Zimmer meiner neuen Mitbewohnerin Cloé vorbei. Sie wohnte nur bei mir, weil ich für die Miete der Wohnung in einem Londoner Vorort nicht länger allein aufkommen konnte. Cloé Winter war die Einzige, die sich auf meine Anzeige vom schwarzen Brett im Imperial College London gemeldet hatte. Ihr übermäßiger Duftwassergebrauch folterte meine feinen Geruchsnerven bereits drei Wochen lang. Mir blieb jedoch keine andere Wahl, als es zu ertragen - vorerst zumindest.
Mein Badezimmer entschädigte für alles, Natursteinkacheln und dazu ein klassischer Mosaikfußboden. Der gemauerte Waschtisch wurde von einem runden Designer Waschbecken gekrönt. Ich nahm die elektrische Zahnbürste aus der Ladestation und stellte ihre Automatik auf fünf Minuten. Gedankenversunken blickte ich in den Spiegel.
»Oh bitte!«, zischte ich beim Anblick meiner mal wieder völlig zerzausten Haare. Der Schaum der Zahnpasta landete dabei unausweichlich auf dem Spiegel. Dieses `Kunststück´ beherrschte ich nahezu täglich und es brachte meine beschaumten Lippen zum Lächeln.
Die Fußbodenheizung war angenehm, aber unnötig. Ich hatte nie kalte Füße wegen meiner permanent erhöhten Körpertemperatur. Die konstanten 42 Grad hätten jedem anderen Menschen sicher schwer zugesetzt oder ihn unter bestimmten Umständen womöglich getötet. Ich jedoch war bereits seit meiner Geburt so unerklärlich heiß. Die Schneidezähne fest aufeinander gepresst, putze ich fleißig weiter. Das Wasser ließ ich währenddessen laufen. Verschwendung war eine dumme Angewohnheit, das wusste ich, aber irgendwie beruhigte mich dieses Geräusch.
Das Piepsen der Zahnbürste, die sofort danach den Dienst einstellte, beendete mein allmorgendliches Zahnpasta-Scharmützel. Gut so, denn ich musste pünktlich sein. Unbedingt! Schließlich hatte ich nicht umsonst über ein halbes Jahr auf diese Chance hingearbeitet.
Miss Miller, die gute Seele unserer Fakultätsbibliothek, war mir in den letzten Monaten sehr lieb geworden. Sie hielt mir stets den kleinen Tisch in der einzigen Nische des Lesesaals frei. Manchmal kam mir schon der Gedanke, dass die Bibliothek mein zweites Zuhause sei.
Viele Tage und Nächte hatte ich dort verbracht, die zahlreichen Stunden im Labor nicht eingerechnet. Und nun, an diesem Vormittag, musste ich mich beweisen. Mein Leben würde endlich eine konkrete Richtung erhalten und ich würde meine Zukunft wenigstens ein Stück mitbestimmen können.
Prof. Barclay Stonehaven, ich glaubte, er sei schottischer Abstammung, hatte mich für die ausgeschriebene Forschungsstelle in der Rechtsmedizin vorgeschlagen. Forensik und medizinische Forschung hieß zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ein Blick auf die Uhr mahnte mich zur Eile. Mir blieben nur noch elf Minuten, um zur U-Bahnstation `Golders Green’ zu gelangen. Also rein in die Jeans, T-Shirt drüber und mit dem Kamm grob durch die Haare. Noch ein wenig Wasser ins Gesicht und über den Spiegel, um die letzten Schaumspuren zu beseitigen, Tasche geschnappt und ab die Post.
Bis zur Uni musste ich etwa eine halbe Stunde Fahrzeit mit der U-Bahn über mich ergehen lassen. Im Sommer war das kaum auszuhalten. So ziemlich jedem fiel es schwer, diesen Mief einzuatmen. Mir jedoch blieb fast die Luft weg. Ich nahm einhundert mal mehr wahr, welch ekelerregender Dunst sich in dieser stickigen Bahn ansammelte. Jetzt, Mitte Juni, war es besonders schlimm!
In letzter Minute erreichte ich den Bahnsteig. Menschen drängten sich in die bereits überfüllte U-Bahn. Ich vermutete langsam, ganz Borough wolle um diese Uhrzeit in die City fahren. Mein Gesicht vergrub ich, so gut es ging, in meinen blonden Haaren. »Ein Hauch Citrus mit Gestank«, schimpfte ich leise vor mich hin, während ich als Letzte in die Bahn stieg.
***
Sie stand dicht an die Tür gedrängt, da die U-Bahn hoffnungslos überfüllt war. Ihre wilde Lockenpracht wirkte wie immer ungebändigt. In den vergangen Tagen hatte er sich einen Überblick über ihre Gewohnheiten verschafft. Wann und wohin sie das Haus verließ, selbst über ihre Schlafgewohnheiten war er bereits bestens im Bilde. Besonders über ihren bereits geflickten Jogginganzug, wohl ihr liebstes Kleidungsstück, konnte man wahrlich streiten. Er hatte schon viele schöne Frauen gesehen und konnte nicht sagen, dass diese heraus stach. Jedoch die ausgesprochen femininen Züge - Schmollmund, kleines Kinn und hohe Wangenknochen - beeindruckten ihn. Einzig ihre Augen hatten eine unnatürliche Färbung. Sie waren tief grün. Ihr Schimmer jedoch erinnerte ihn an einen dichten Tannenwald, auf den gerade die ersten Sonnenstrahlen des Tages fielen. Diesen faszinierenden Gedanken schob er rasch beiseite und rang um Konzentration. Derartig romantisch-verklärte Gedanken waren ihm bisher völlig fremd. Auch wenn er sich jetzt wieder im Griff hatte, dieser Job würde ihm noch einiges abverlangen.
Seine Augen suchten eindringlich nach Antworten. Wieso ausgerechnet diese junge Frau sein Ziel sein sollte, verstand er nicht. Gefährlich sah sie nicht aus mit ihrer grazilen Figur. Sie trieb wohl Sport, doch einem Mann konnte sie kaum zu Leibe rücken. Im Gegenteil, sie wirkte verloren und unsicher in der Menge an Fahrgästen und ihr Gesicht verzog sich immer wieder zu einer angewiderten Grimasse.
Im Griff hat sich die Kleine nicht, dachte Readwulf spöttisch und begann ihre Umhängetasche nach Waffen oder ähnlichem zu durchleuchten. Unizeugs und was zum Schreiben, Schlüssel, Taschentücher und ein Portemonnaie. Komm schon, wo?
Für gewöhnlich entlarvte er seine Zielpersonen auf den ersten Blick. Niemand konnte etwas vor ihm verbergen. Readwulf scannte weiter und bemühte sich, ihren wohlgeformten Körper zu ignorieren. Nichts!, bemerkte er rasch und wieder drängte sich die Frage in den Vordergrund: Wieso ausgerechnet sie?
Entkommen konnte dieses unsicher wirkende Frauenzimmer ihm nicht. Er beschloss also, sie noch eine Weile zu beobachten und hinter ihr Geheimnis zu kommen.
Ohne einen Grund würde Bruder Darius ihm niemals einen solchen Auftrag erteilen. Ein bisschen freute er sich sogar über seine Aufgabe, das würde eine willkommene Abwechslung in seinem sonst sehr strukturierten Leben werden.
***
Wieso starrt der so?
Als ich den Blick dieses dunkelhaarigen Schönlings in der Bahn kreuzte, überkam mich ein eiskalter Schauer. Eigentlich vermied ich es, Menschen direkt in die Augen zu blicken. Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, war mir mehr als unangenehm. Leider aber Alltag und schon durch meine Größe von einem Meter neunundsiebzig vorprogrammiert.
»Wieso starrt der so? Verdammt!«, grummelte ich nochmals in mich hinein. Als wenn das etwas nützen würde! Dieser Kerl wirkte durch und durch unverschämt und aufdringlich, er störte sich nicht einmal an den verstohlenen Blicken anderer Fahrgäste.
Wie ein Röntgengerät!
Demonstrativ drehte ich ihm den Rücken zu. Auch das half mir nicht, der Situation zu entkommen. Ich spürte seine durchdringenden Blicke überall auf meinem Körper. Gänsehaut machte sich auf meinen Unterarmen breit. Was dachte dieser Mann sich nur dabei? Es brodelte in mir. Die Bahnfahrt war auch ohne diesen aufdringlichen Übergriff schon ätzend genug.
Zu gern wollte ich mich in diesem Moment umdrehen, über ein Dutzend Fahrgäste springen und meine rechte Hand gnadenlos ihren Weg in sein noch makelloses Gesicht schlagen. Zorn stieg in mir auf und ich wurde steif. Um Entspannung ringend atmete ich tief ein. Ein großer Fehler bei meiner sensiblen Nase! Glücklicherweise stoppte die Bahn ihre Fahrt rechtzeitig und öffnete die Türen.
Luft! Endlich! Oh verdammt, ich muss hier raus!
Das war knapp! Wegen diesem blöden Kerl hätte ich um ein Haar die `South Kensington´ in West London verpasst.
Zum Campus ging es noch ein kleines Stück durch den Hyde Park.
»Hmm…Kurzurlaub für meine Nase«, murmelte ich, als mir schockierenderweise etwas auffiel: Der Geruch vorhin - Gestank klar, aber gepaart mit einer seltsam vertrauten Note.
***
Ich war noch immer sehr angespannt, als ich die Tür zum Hörsaal erreichte. Gleich musste ich die Ergebnisse meines wissenschaftlichen Projektes der vergangen sechs Monate vorstellen. Mit dieser Arbeit wollte ich mich für die ausgeschriebene Forschungsstelle qualifizieren.
Prof. Stonehaven war zwar mein Mentor und das schien von Vorteil, die Stelle wurde jedoch direkt von Dr. Nail, dem Leiter der Forschungseinrichtung, vergeben.
Jeder in meinem Studiengang wollte diesen Job, nicht nur weil er Ruhm und Geld versprach. Nein, das bloße Mitwirken am Forschungsprojekt des Forensik-Teams unter der Leitung von Dr. William Nail öffnete alle Türen und man konnte sich tatsächlich überall für seine Assistenzzeit bewerben. Doch für mich ging es um so viel mehr.
Weltklasse Jules...
Ich öffnete rasch die Tür, bevor ich es mir doch noch anders überlegen konnte. `Augen zu und durch, das schaffst du schon!’, sprach ich mir heimlich Mut zu. Meine Füße fanden den Weg zum Rednerpult. Mein Magen drehte sich um, als ich in die gespannten Gesichter von Dr. Nail und seinem gesamten Team schaute. Damit fühlte ich mich überfordert! Wieso konnte mich denn niemand vorwarnen? Wenn ich mich nun blamierte, dann vor der versammelten Fachkompetenz unserer Campuselite.
»Autsch!«, hallte es in meine Ohren. Das hatte ich jetzt nicht laut gesagt, oder doch? Die Antwort bekam ich sofort. »Juliette, hast du dir wehgetan?«, hörte ich Nathan fragen.
Nathan war bereits Assistenzarzt. Die Freundlichkeit in seiner Stimme milderte die Anspannung meines Nervenkostüms ein wenig ab.
»Nein, nicht wirklich«, entgegnete ich und sortierte eilig die Unterlagen aus meiner Tasche.
»Nun, wir hören!«, kam im Anschluss fordernd von Dr. Nail. Ohne weiter auf die verunsichernden Stimmen meines verklärten Unterbewusstseins zu achten, atmete ich einmal tief durch. Anschließend gab ich geordnet und scharfsinnig meine Erkenntnisse der letzten sechs Forschungsmonate preis. Gebannt hörte und schaute man mir zu. Alle Aufregung war umsonst.
Ich sah es deutlich in Prof. Stonehavens Gesicht. Stolz zeichnete sich ab, fast schon von väterlicher Natur. Zufriedene Mienen bei den Assistenzärzten, und auch die Forensiker wirkten beeindruckt. Ich hatte wohl selbst den von allen gefürchteten Dr. William Nail mit meiner Ausarbeitung zur Todeszeitpunktbestimmung mittels Fliegenlarven in meinen Bann ziehen können. Gut, zumindest sah er interessiert aus. Ein wichtiger Bestandteil meiner Ausarbeitung bezog sich auf den Fliegenlarvenkot und seine Zusammensetzung während der jeweiligen Entwicklungsstadien der Larven. Diesen Teil meines Vortrages verfolgte er aufmerksamer und machte sich dazu Notizen.
Komplett entspannte ich jedoch erst, als ich das Strahlen in Nathans Gesicht bemerkte. Er hatte mich in den vergangen sechs Monaten bei meiner Ausarbeitung unterstützt. Uns vorzustellen war Prof. Stonehavens geniale Idee gewesen.
Meine offizielle Bewerbung beendete ich mit den Worten: »Mein Dank gilt Nathan Dunn und seiner fachlichen Unterstützung.«
Ich schaute ihm fest in die Augen: »Dankeschön«, und mit einem smarten Lächeln sammelte ich meine Unterlagen zusammen.
Ein paar Tage würde ich noch auf die endgültige Entscheidung von Dr. Nail warten müssen, doch mich überkam zum ersten Mal an diesem Tag ein gelöstes Gefühl.
Prof. Stonehaven beglückwünschte mich, für seine Verhältnisse überschwänglich, und schüttelte mir die Hand. Stolz und nochmals dankbar fiel ich danach in Nathans Arme.
»Du bist der Allerbeste«, flüsterte ich ihm dabei ins Ohr.
»Und du bald meine persönliche Kaffeesklavin.«
Wenn das alles ist, verkniff ich mir lieber, denn so eindeutig zweideutig war unser Verhältnis dann doch nicht.
Prrring, klingelte es an der Tür. »Auweia, schon so spät?!«, bemerkte ich und schaute an mir herunter. Das Kleid offen und verdreht, barfuß - um mich herum ein Schlachtfeld aus Kleidung, Schuhen und Accessoires. Diesen Krieg hab ich eindeutig verloren.
Ein Blick in den Spiegel besiegelte meine Stylingniederlage. Meine Haare: das Grauen. Ich wollte eine Frisur: Schlimmer ging’s nimmer.
Wenigstens schminken musste ich mich nicht mehr. Etwas Lipgloss und Wimperntusche - fertig. Dem Kampf mit dem Farbkasten fühlte ich mich nicht im Ansatz gewachsen, das konnte nur schief gehen.
Prrring, Pring, Prrring.
»Jaha!«, schrie ich zur Tür. »Taub bin ich noch nicht!«
Ich öffnete, war jedoch noch im Gerangel mit dem Reißverschluss meines Kleides und humpelte auf einem Schuh. Den anderen hatte ich mir sehr vorteilhaft zwischen die Zähne geklemmt.
Nathan strahlte mich an: »Wow, ein Vogelnest, wie apart!«
»Sehr charmant, du Holzkopf«, nuschelte ich verlegen durch den Schuh zurück, noch immer im Clinch mit dem Reißverschluss liegend.
»Halt still, ich mach das.« Mit nur einer Hand-bewegung saß mein Kleid so, wie es geplant war. Auf dem Weg ins Bad zog ich mir rasch den anderen Schuh über. Dann entfernte ich unbeholfen die vorher so kompliziert eingesetzten Haarnadeln.
Also einmal wie immer. Ich schaute mir das Resultat im Spiegel an.
»Sei nicht sauer, Süße, dein Kleid ist dafür der Hammer«, hallte Nathans Stimme durch die Wohnung.
»Dann zieh ich es sofort wieder aus«, erwiderte ich gleichgültig, als ich den Flur entlang stolzierend versuchte, meinen zweiten Auftritt, besser hinzubekommen.
»Nein! Sei nicht blöd und komm jetzt endlich, Tess wartet im Auto in zweiter Reihe.«
Bevor ich noch etwas sagen konnte, packte Nathan mein rechtes Handgelenk, schnappte sich mit der Linken meine Schlüssel und zog mich aus der Wohnung. Mit Mühe konnte ich gerade noch die Tür schließen, bevor ich fast die Treppe runter flog: »Hey Mann, langsaaam!«
Der letzte Clubbesuch schien Ewigkeiten her zu sein, vom Tanzen ganz zu schweigen.
An diesem Abend konnte ich Nathan einen Drink zum Anstoßen nicht abschlagen. Die anstrengenden Nächte in der Bibliothek waren erst einmal vorbei. Endlich konnte ich wieder schlafen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Definitiv ein Grund zum feiern.
Tess begrüßte mich mit Küsschen und Glückwünschen, plapperte dann aufgeregt drauf los. Ein Moment, in dem ich herrlich abschalten konnte und mich insgeheim auf mein Bett später freute. Die komplette Fahrt in ihrem roten VW-Beatle bekam ich daher auch nicht richtig mit.
Kaum ausgestiegen, nahm Tess meine Hand und zog mich hinter sich her. Wie gewöhnlich stellte sich diese zierliche Frau nicht hinten an einer Schlange an.
Typisch!
Ich schmunzelte verlegen in der irrealen Hoffnung, unsichtbar zu sein. Der bullige Türsteher winkte uns durch und öffnete sofort das rote Absperrseil. Mit: »Dank dir Honey«, und einem umwerfenden Lächeln revanchierte sich der dunkelhaarige Wuschelkopf, der meine Hand fest umklammert hielt.
Theresa hasste es, wenn man sie so nannte. Sie war Nathans kleine Schwester und ein emotionales Feuerwerk. Woher sie diese Energie nahm, war mir ein Rätsel. Auch mich wickelte sie mit ihrer unbeschwerten Art um den kleinen Finger.
»Metropolitan?« Ohne meine Antwort abzuwarten, deutete Tess Nathan an, ihre Bestellung aufzugeben. Er fügte sich, und drei Minuten später stand ich mit einem Cocktail an der Bar.
Der Club war schummrig, aber erfüllt von bunten Lichtern. Bodennebel auf der großen Fläche vor mir ließ die Beine der tanzenden Menge fast bis zum Knie verschwinden. Die Latino-Rhythmen wummerten in meinen Ohren, aber meine Hüfte wippte von allein im Takt mit. Meine Augen passten sich den Lichtverhältnissen an.
Schön hier...
Weiter kam ich nicht mit meinen Gedanken. Tess packte mich erneut am Arm und zerrte mich ohne Rücksicht auf Verluste oder meinen kleinen Protest weiter hinein in die Menge.
»Hey!«
Einzig Nathans Umsichtigkeit verdankte ich es, dass sich der Drink nicht komplett über mein neues Kleid ergoss.
»Los, Süße, beweg dich, hab Spaß«, tänzelte Theresa um mich herum. Der dünne Stoff ihres purpurroten Kleides flatterte im Takt zu ihren Bewegungen. Ihre wasserblauen Augen leuchteten vor Begeisterung. Die Freude war ihr förmlich ins Gesicht geschrieben.
Da ich nicht gern auffiel, kam reserviertes und steifes Herumstehen nicht infrage. Also verwarf ich alle Zweifel über meine Tanzkünste und tat, was Tess mir befahl. Ich hatte tatsächlich Spaß und hörte auf, mir über alles und jeden den Kopf zu zerbrechen.
Tanzen, Tanzen und nochmals Tanzen! Endorphine durchströmten meinen Körper, ach, einfach alles, was der Enzymhaushalt hergab. Ich fühlte mich frei, leicht und absolut fantastisch.
Dank dir, verrückte, süße Tess.
***
Es war gewiss nicht leicht, unbemerkt in einen Club zu kommen, doch für Readwulf nicht im Ansatz eine Herausforderung. Er kletterte mühelos und äußerst elegant durch ein offenes Fenster im Damen-WC, um sich dann direkt vor zwei jungen Frauen aufzubauen.
Beide betrachteten gerade aufmerksam ihr Spiegelbild und musterten sich dazu noch gegenseitig. Amüsiert über diesen doch sehr frauentypischen Anblick, erklärte er mit seinem charmantesten Lächeln: »Bitte stören sie sich nicht an mir, meine Damen, sie sehen heute Abend bezaubernd aus.« Als die beiden Grazien mit weit offen stehenden Mündern herumfuhren, entsprach diese Aussage auch nur im Entferntesten der Realität.
Dass keine von beiden laut aufschrie, lag an Readwulfs umwerfendem Äußeren und der reglosen, freundlich-cool wirkenden Pose, die er unter dem Fenster, auf der anderen Seite des Raumes, einnahm.
Bevor eine von ihnen doch noch die Beherrschung verlor, trat Readwulf näher und nahm die rechte Hand der näher stehenden Blondine für einen perfekten Handkuss in Beschlag. Danach war die Rothaarige dran.
Natürlich hätte er die Begegnung mit den beiden Ladys vermeiden können, aber einen kleinen Scherz mit der Damenwelt gönnte er sich ab und an. Zu genau wusste er um seine Wirkung bei der holden Weiblichkeit und reizte diese schamlos aus.
Schmunzelnd verabschiedete er sich: »Guten Abend die Damen.« Dann verließ er pfeifend die Örtlichkeit.
Auf der Tanzfläche herrschte großes Gedränge. Es war stickig und heiß. Körper rieben sich aneinander. Nicht unbedingt der liebste Ort, an dem Readwulf sich aufhalten wollte. Seine Augen suchten die Menge systematisch ab: Hier ist sie nicht!
Check: junge Frau, Anfang 20, groß, schlank, langbeinig, Löwenmähne,
schwarzes Kleid, grüne Augen.
Langsam bewegte er sich durch die tanzende Menge. Selbst als er angerempelt wurde, blieb er ruhig und entspannt. Aufregung oder Nervosität waren Fremdworte für ihn.
Readwulf hatte alles im Griff. Immer!
Er blickte zur Bar hinüber und sah den filmreifen Beinaheabgang zur Tanzfläche, den seine Zielperson gerade so verhindern konnte.
»Ein kleines Schwarzes«, bemerkte er und verschwand zwischen den Clubgästen hinter seinem Opfer.
Keine Sekunde verlor er sie aus den Augen, auch nicht, als sie offensichtlich alle Hemmungen verlor und in der Musik aufging. Dieses Verhalten entsprach nicht dem Profil, welches er seit einigen Tagen von ihr anfertigte. Sie erschien ihm wie eine fremde Person. Was hatten diese anbetungswürdige Tänzerin und die unsichere kleine Studentin gemeinsam? Konnte er sich so getäuscht haben? Wieso interessierte ihn das jetzt auf einmal so über alle Maßen?
Sexy! Er zog die Augenbrauen leicht nach oben. Ihre Bewegungen wirkten animalisch, leicht und echt, kein bisschen aufgesetzt. »Kleine Raubkatze«, war alles, was ihm dazu noch einfiel.
Als er sich gerade zurückziehen wollte, stand sie plötzlich stocksteif in der Menge. Eine Drehung! Sie blickte ihm tief in seine dunklen Augen. Ja, sie schaute ihn an. Irrtum ausgeschlossen!
Wie konnte das sein? Hatte sie ihn doch in der U-Bahn bemerkt und jetzt wiedererkannt? Aber es war nahezu ausgeschlossen, dass sie ihn hier im Club entdeckte. Wieso starrte sie ihm jetzt so entgeistert direkt in die Augen? Fragen über Fragen häuften sich in seinem analytischen Verstand.
Sie konnte unmöglich wissen, was er plante. Woher auch? Readwulf ging nicht unvorsichtiger als sonst vor, wenn er eines seiner Opfer observierte.
Also was verdammt noch mal läuft hier schief? Er hielt ihrem festen Blick stand.
***
Stopp!
Ich atmete tief durch, mein Puls raste. Meine feine Nase lokalisierte diesen speziellen Geruch. Er schien nah zu sein, etwa zehn Meter entfernt. Ohne weiter Zeit zu verlieren, wirbelte ich einmal um die eigene Achse herum. Ich schaute direkt in seine fast schwarzen Augen, welche am äußeren Rand seiner Iris goldbraun zu leuchten schienen. Er sah verwirrt aus, starrte ziegenblöd zurück.
Bastard, diesmal bist du fällig!
Ohne einen weiteren Gedanken steuerte ich auf den mysteriösen Kerl zu. Nach circa drei Metern wurde jedoch mein Vorhaben von Nathan und meinem Metropolitan gestoppt.
»Hier, bevor alles Eis geschmolzen ist. Auf gute Zusammenarbeit! Prost!« Er hielt mir zwinkernd das Glas vors Gesicht.
Der Typ war natürlich weg, als ich wieder über Nathans Schulter blicken konnte. Dafür kam eine kleine Frau total aufgelöst den schmalen Korridor vom Notausgang herangestolpert.
Völlig fertig und außer Atem brüllte sie, so laut sie nur konnte, in den Raum: »Eine Tote!« Sie holte Luft und: »Da draußen hinter dem Container.« Als nichts passierte, schrie sie: »Hilfe! Schnell!«
Eine Tote. Hilfe? Und dann auch noch schnell? Ich beobachtete das Schauspiel unbeteiligt weiter. Wie hätte ich auch erklären sollen, dass ich diese Frau hören konnte, wo doch zwischen uns mindestens dreißig Menschen standen.
Endlich erbarmte sich einer der Gäste und eilte nach kurzer Absprache mit der jämmerlich wirkenden Gestalt zum DJ. Dieser reagierte sofort, die Musik verstummte und über das Mikrofon hallte es in den Raum: »Bitte bleiben sie alle, wo sie sind. Ruhe bitte! Wir haben alles unter Kontrolle.« Die Menge verstummte und eine kurze Pause später kam: »Sam, ruf sofort die Polizei!«
Das Wort ‚Polizei’ war zu viel für die Anwesenden. Bestimmt nahm die Hälfte von ihnen Drogen oder hatte welche dabei. Jedenfalls wollten alle nur noch weg und die vorher angemahnte Ruhe sprang augenblicklich in unaufhaltsame Panik um. Die aufgebrachte Menge spülte mich mit.
Gerangel, Geschubse, einige Ellbogen im Rücken und zertrampelte Füße später, war ich im Freien. Mit großen Augen stellte ich erstaunt fest, dass ich genau neben dem Container vor dem Hinterausgang zum Stehen kam. Ich konnte schaulustige Gaffer eigentlich auf den Tod nicht ausstehen, doch meine Neugier, die Tote mit eigenen Augen zu sehen, erwies sich als übermächtig.
Ich machte einen unauffälligen Schritt zur Seite, um hinter den Müllberg sehen zu können. Die Masse bekam von der leblosen Frau nichts mit, daher standen nur vereinzelte Beobachter ungläubig um den Schauplatz verteilt. Für die aber war es wohl die erste Leiche ihres Lebens, welche sich so unverhüllt vor ihnen auf dem Boden präsentierte.
Wie achtlos weggeworfen lag die junge Frau vor mir. Man hatte sich ihrer einfach entledigt. Herumgewirbelte Zeitungsblätter bedeckten ihr Gesicht. Sie war vollständig bekleidet, soweit ich das erkennen konnte. Sie trug eine blaue Bluse, einen schwarzen Rock und schwarze High Heels. Der rechte Schuh hing noch halb an ihrem Fuß, während der Linke direkt neben ihrem leblosen Körper lag.
»Oh mein Gott!«, schrie eine junge Frau im Arm ihres Freundes neben mir, als die Tür ins Schloss des Hintereingangs fiel. Der entstandene Windstoß fegte das Zeitungspapier hoch und legte das Gesicht der Toten frei.
»Das ist Gracy, wir haben…hatten Anatomie zusammen«, erkannte ich sofort. Eigenartig waren die noch weit aufgerissenen Augen. Ihr vorher hübsches Gesicht hatte sich im Tode so grausig verändert, dass selbst ich kurz bestürzt dreinschaute. Offene Blessuren konnte ich auch auf den zweiten Blick nicht erkennen.
»Woran ist sie gestorben?«, kam von dem vorher noch aufschreienden Mädchen neben mir. Blöde Frage!
Zynisch antwortete ich ihr: »Du meinst wohl eher, wer hat sie auf dem Gewissen.« Mit dieser schroffen Aussage und einem verächtlichen Blick verließ ich das Clubgelände in Richtung Straße.
Meine Suche nach Nathan und Tess war erfolglos. Im Gedränge wurden die beiden wohl in eine andere Richtung geschoben. Ich wollte nur noch nach Hause. Mir reichte es fürs Erste, die kamen auch ohne mich zurecht.
»Taxi? Taxi!«, rief ich, als eins an mir vorbeidonnerte. Nichts zu machen! Ich entschied mich sofort um und lief eilig die immer dunkler werdende Straße nach Borough hinunter. Nur zwei Kreuzungen weiter, bildete ich mir ein, dass ich nicht allein unterwegs war. Die Schritte hinter mir kamen geradewegs näher. Wenn ich langsamer wurde und stehen blieb, so tat man es mir gleich.
Umdrehen und losschreien, schoss es mir durch den Kopf. Ich fuhr herum, doch da war niemand zu sehen.
»Einbildung Jules, du spinnst doch langsam!«, ermahnte ich mich.
Immer schön locker bleiben Mädchen. Nee, da ist doch wer!
Diesmal nahm ich die Beine in die Hand und rannte so schnell ich konnte. Meine extreme Schnelligkeit beim Laufen konnte ich mir ebenfalls nicht erklären. In diesem Moment erwies sich dieser Umstand jedoch als großer Vorteil. Manchmal kam ich mir vor wie ein `Mutantenweib´, die reinste Hollywooderfindung. Alles in allem war ich es so leid, anders zu sein und keine Antworten für meine Unnatürlichkeiten finden zu können.
Alle Vernunft half mir nicht, ich fühlte mich verfolgt. Für den Weg vom Club nach Hause brauchte ich keine acht Minuten. Mit dem Auto musste man für die Stecke mindestens fünfzehn Minuten einrechnen. Das war vermutlich neuer Rekord, doch das interessierte mich gerade nicht.
Vor der Haustür fiel mir ein, dass Nathan meinen Schlüssel auf der Hinfahrt im Auto deponiert hatte. Da war es, mein schlechtes Gewissen. Ich hatte die Beiden einfach zurück gelassen. Die Strafe für meine Gedankenlosigkeit folgte auf dem Fuße: Kein Schlüssel! Ich muß Cloé wecken - hmm...
Selbst verzweifeltes Klingeln brachte nichts!
»Cloé, du taube Nuss«, fluchte ich laut.
Eine Autotür. Schritte. Tapsen. Ein kläffender Hund...
Die Geräusche konnte ich in meiner nun aufsteigenden Panik nicht mehr unterscheiden. Ich rannte in den Garten unserer kleinen Vorstadtvilla. Zum Glück ließ ich meist mein Schlafzimmerfenster im ersten Stock des Hauses einen Spalt offen stehen.
Ich zog den Rock meines Kleides ein Stück rauf und die hochhackigen Schuhe aus. Mit großem Schwung sprang ich an der Hauswand empor und landete nach dem dritten Versuch mit einem selbst für mich gewaltigen Satz hockend auf dem Fensterbrett. Die Scheibe schob ich ein Stück auf und zwängte mich durch den etwa vierzig Zentimeter hohen Spalt. Ich schloss das Fenster schloss hinter mir und verriegelte hastig das zweite rechts daneben. Noch bevor ich Luft holen konnte, um nach draußen zu schauen, erschrak ich fast zu Tode.
Drrring!
Das Telefon im Flur durchschnitt die Stille.
Gott, was war nur mit mir los, so schreckhaft kannte ich mich doch sonst nicht. Ich öffnete die Zimmertür und betrat den düsteren Flur, ohne das Licht anzuknipsen. Es war überflüssig, denn ich konnte nachts fast deutlicher sehen als am hellsten Tag des Jahres. Auch so eine Eigenheit, deren Hintergrund mir fehlte. Das Telefon gab keine Ruhe.
Dring…Drrring!
Plötzlich wurde das Licht eingeschaltet. Ich schrie und nur Sekundenbruchteile später auch Cloé, die mit ihrer Augenbinde um den Kopf im Pyjama hinter mir stand.
»Verdammt Cloé, ich dachte du bist nicht zu Hause!«
»Doch, wieso sollte ich nicht?«
»Ich habe vorhin Sturm geklingelt, als ich…« Ich unterbrach mich selbst und formulierte lieber eine realistischere Antwort: »…als ich dachte, ich hätte den Schlüssel verloren.«
»Ich hab dich nicht gehört!« Cloé deutete auf die blauen Ohrstöpsel in ihrer Hand. In diesem Moment war mir alles zu viel und ich winkte nur noch ab. Als meine Anspannung im nächsten Augenblick nachließ, schossen mir Tränen in die Augen.
»Hey, komm her!« Cloé breitete ihre Arme aus. Ihre Stimme klang so sehr nach Geborgenheit und Schutz, dass ich nicht anders konnte, als dieser netten Aufforderung nachzukommen. So lang war ich nicht mehr getröstet worden, wenn es mir nicht gut ging oder ich vor Einsamkeit nicht wusste, wohin mit mir. Ich vergaß alle Vorsicht und kassierte sofort die Quittung: »Wow, du bist so warm, hast du Fieber?«, fragte sie besorgt und vergewisserte sich dabei nochmals an meiner Stirn.
»Fieber? Nein. Ich bin nur den ganzen Weg vom Club nach Hause gerannt«, erwiderte ich und brachte mit einem Schritt zurück Abstand zwischen uns. Sie hakte nach: »Bist du sicher?«
»Klar bin ich das! Was soll die Frage?«, reagierte ich abweisend, gestützt durch eine in Falten gelegte Stirn und einen vernichtenden Blick. Schließlich war Angriff die beste Verteidigung. Dem Gegenüber das Gefühl zu geben, er spinnt sich etwas zusammen, hatte mir schon aus einigen brenzligen Situationen geholfen. Bei Cloé jedoch war ich mir unsicher. Sie wirkte weder überzeugt von meiner Ausrede, noch beeindruckte sie meine unfreundliche Haltung. Im Gegenteil, sie ignorierte meine unsanfte Aussage und fragte: »Willst du einen Tee? Soll ich dir eine heiße Milch mit Honig machen?« Bei dieser Frage musterte sie mich genau.
»Milch mit Honig bitte, aber nur wenn du auch eine mittrinkst.«
Cloé ging in die Küche und machte sich ans Werk. Ich folgte ihr zögerlich, setze mich aber dann rasch an den Küchentisch.
Meine Mitbewohnerin mit ihren höchstens ein Meter sechzig sah aus wie eine kleine Holländerin. Ihre hellblonden Haare hingen in zwei Zöpfen über den Schultern. Trotz ihrer schnellen Handgriffe hatte ich das Gefühl, eine kleine Ewigkeit allein am Tisch zu warten. Die Situation war für mich eigenartig. Sie jedoch verhielt sich, als sei nichts gewesen. Als sie sich endlich mit den zwei großen Milchtassen zu mir setzte, schaute sie mich fast schon bedauernd an.
Cloé erzählte, wie sie sich in London bei `Fabrizio RAINONE´ um eine Praktikumsstelle beworben hatte, um als Modefotografin Karriere zu machen. Sie sei sehr froh, das Zimmer bei mir bekommen zu haben und die Wohnung gefalle ihr gut. Ab und an nippte sie an ihrer noch dampfenden Tasse. Ich nicht. Milch trank ich nur lauwarm.
Sie verhielt sich so herzlich, dass ich fast schon ein schlechtes Gewissen bekam. Cloé wirkte nicht mehr so unnahbar und arrogant. Es schien, als hätte ich sie seit ihrem Einzug völlig verkannt.
Trotz ihrer Plauderei achtete sie darauf, nicht aufdringlich zu sein. Dazu lieb gemeinte Blicke und zwischendurch die Frage, ob mit mir wieder alles in Ordnung wäre.
Feinfühligkeit - eine Charaktereigenschaft die mir sehr zusagte. So kam schnell eine gewisse Vertrautheit zwischen uns auf. Wir saßen bereits einige Zeit in der Küche und es war mir, als redete sie zum ersten Mal mehr als nur drei Sätze mit mir.
Dann erzählte sie von ihrem Freund Luke, wie sehr sie ihn vermisste und dass die schreckliche Sehnsucht nach ihrem fünfjährigen Hund Jack, einem Jack Russel Terrier, kaum auszuhalten war.
Ob mich die ablenkende, sentimentale Stimmung animierte, weiß ich heute nicht mehr so genau. Nur noch, dass auch ich Cloé ein bisschen aus meinem Leben erzählte.
Ich berichtete ihr von Harry und Marie Ann, meinen Adoptiveltern, wie wunderschön wir auf den Falklandinseln gewohnt hatten. Meine Heimat, bis Mom so unerwartet an einem Herzinfarkt starb. Ich konnte mich nicht mal von ihr verabschieden, weil ich damals mit dem Abschlussjahrgang Italien erkundete. Harry stand Tag für Tag über ein halbes Jahr lang auf ihrem Lieblingshügel hinter unserem Haus und starrte trauernd auf die Brandung der kleinen Bucht.
Er sprach von da an kein Wort mehr mit mir, als wäre ich schuld an ihrem Tod. Wir hatten nie ein inniges Verhältnis zueinander, aber seit Mom nicht mehr lebte…In diesem Moment wurden meine Augen wieder wässrig. Seit damals - inzwischen mochten fast vier Jahre vergangen sein - sprach ich zum ersten Mal mit jemandem über meine tote Mutter und den Schmerz, der sich tief in mir verankert hatte.
»Cloé, ich geh jetzt besser schlafen«, unterbrach ich abrupt unsere traute Zweisamkeit. »Sei mir nicht böse, ich bin total erledigt«, fügte ich noch etwas heiser hinzu.
»Oh, du hast recht, es ist schon spät! Sorry, ich wollte nichts aufwühlen.«
»Hast du nicht! Schlaf gut und Danke«, erklärte ich unbeholfen und verschwand durch den Flur in mein Zimmer.
***