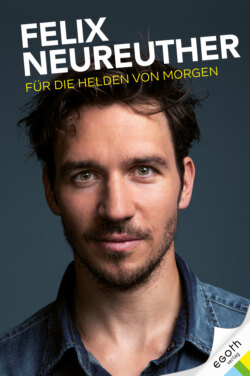Читать книгу Felix Neureuther - Stefan Illek - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EIN BLICK IN DIE GLASKUGEL TRISTAN HORX
ОглавлениеTristan Horx (* 8. Juli 1993 in Hamburg) ist als Sohn des Trendforschers Matthias Horx sozusagen mit der Zukunftsforschung aufgewachsen. Er versucht, aus Sicht der Jugend die Trends einer Gesellschaft vorauszusagen, die durch Digitalisierung, Mobilität, Lifestyle und Globalisierung stetig im Wandel ist, und er erforscht, was der Generation X, Y und Z folgen wird.
Tristan Horx ist Sprecher und Autor am Zukunftsinstitut. Seit 2018 ist er Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg und seit 2019 Kolumnist bei der Kronen Zeitung. Als Anthropologe sieht er seine Aufgabe darin, die Brücke zwischen Kreativität und Ökonomie in makrosozialen Fragen zu finden.
Wie schaut die Zukunft aus? Das ist eine Frage, die momentan noch viel öfter gestellt wird als ohnehin schon. Um die eigentlich unmöglich zu gebende Antwort vielleicht doch liefern zu können, gibt es sogar eine kleine, aber feine eigene Berufsgruppe – jene der Zukunftsforscher. Im deutschsprachigen Raum wird sie von der Familie Horx angeführt. Ich habe mich mit Tristan Horx unterhalten. Tristan bezeichnet sich selbst als Junior-Futurist und vertritt die Sichtweise der jungen Trend- und Zukunftsforschung. Seine Themen kreisen um die Generationsfrage (X/Y/Z, Millennials), New Work, Individualisierung, Lebensstile und Megatrends. Allein schon mit diesen Begriffen tu ich mir persönlich schwer. Aber Tristan ist ein echter Experte auf diesem Gebiet, studierte Kulturanthropologie, schreibt Zeitungskolumnen, produziert Filme, einen Podcast namens „Treffpunkt Zukunft“ und lehrt als Dozent Trendforschung an der SRH Hochschule Heidelberg.
Mit Tristan habe ich einerseits darüber gesprochen, wie es so weit kommen konnte, dass wir jetzt in vielen Bereichen so dastehen. Und wir haben gewissermaßen einen Blick in die Glaskugel gewagt. Zum Beispiel zu meiner Meinung nach immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Breiten- und Spitzensport. Dabei zeigt Horx gleich ein ganz zentrales Problem auf: „Der Spitzensport und der Breitensport befinden sich gewissermaßen in einem Streitverhältnis. Das Problem ist, dass der Spitzensport mittlerweile so explizit, abgehoben, gierig und dekadent geworden ist, dass Eltern und Kinder es gar nicht mehr wollen, beziehungsweise nicht für möglich halten, einmal dorthin zu kommen. Allein diese Gedanken tragen zur weiteren Überforderung der Eltern bei. Und ohne den Glauben und die Unterstützung der Eltern funktioniert das Ganze nicht.“
Es steht wohl außer Zweifel, wie wichtig die Rolle des Spitzensports in unserer Gesellschaft ist. Er sollte die Motivation für den Breitensport liefern. Doch das scheint nicht wirklich zu funktionieren, wenn man sich bei einem Sportereignis auf den Zuschauerrängen umsieht. Horx: „Wer in einem Fußballstadion ist, merkt schnell, dass da irgendetwas falsch gelaufen ist hinsichtlich der Vorbildwirkung. Ich persönlich habe noch selten so viele ungesunde Leute auf einem Haufen gesehen wie zum Beispiel in einem Fußballstadion! Sicher ist das eine Folge davon, dass das, was die Stars da unten auf dem Spielfeld machen, für die meisten einfach unerreichbar wirkt. Die Hemmschwelle Richtung Spitzensport ist riesig groß.“
Aber was muss im Spitzensport anders laufen, um den Breitensport wirklich hilfreich zu befeuern? Wie schaffen wir es, dass die Kinder durch den Sport, den sie im Fernsehen oder im Internet sehen, zum aktiven Sportmachen motiviert werden? Horx fordert mehr Bodenhaftung und mehr Nähe zu den „Normalsterblichen“. „Das Ziel muss sein, den Spitzensport wieder nahbarer zu machen. Das könnte vor allem über die digitalen Kommunikationsplattformen der Sportler passieren. Durch Social Media können Spitzensportler nahbarer werden. Oder durch direkten Kontakt zu den Kindern. Ich kann mich erinnern, dass in meiner Jugend plötzlich David Alaba in einem Park in Wien mitgekickt hat. Plötzlich haben die Kinder und Jugendlichen, die so etwas miterleben, einen ganz anderen Bezug. So bringst du sie dazu, das auch machen zu wollen. Die Sportler müssen weg davon, immer dieses Idealbild auf Plattformen wie Instagram zeichnen zu wollen. Man muss nicht immer nur super gut ausschauen. Andere Werte zählen! Der Sport ist eine extrem gute Möglichkeit, um Kindern Träume zu bieten!“
Allerdings stellt sich auch noch eine andere Frage im Zusammenhang mit den Eltern potenzieller Breiten- oder Spitzensportler. Da hat es mir während Corona teilweise die Nackenhaare aufgestellt. Da wurde wild diskutiert und sich beschwert, dass Mütter und Väter viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen mussten. Da bekommst du Kinder, dein eigenes Fleisch und Blut, was gibt es da Schöneres, als so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen? Natürlich gab es für viele Familien auch sehr belastende Umstände, aber in schicksalhaften Zeiten muss jeder zurückstecken. Ein „Mehr“ an Zeit mit den Kindern kann aber nicht zum Super-GAU mutieren. In welcher Gesellschaft leben wir denn, bitte? Das Ganze entwickelt sich in eine Richtung, die ich nur sehr, sehr schwer verstehen kann. Horx sagt zu diesem Thema: „Die Individualisierung der Eltern ist einfach zu weit gegangen. Die Eltern ranken ihre eigenen Bedürfnisse so hoch wie jene der Kinder. Wir sprechen dabei von einer Überindividualisierung. Man will Kinder, aber keine Kompromisse eingehen. Das ist ein unvermeidbarer Widerspruch. Das individuelle Wohl wird über das Gemeinwohl gestellt. Und das führt zu krassen Verhaltensformen in Sachen Egoismus und Eigensinn.“ Kräftig befeuert wird diese Überindividualisierung von den zahllosen Social-Media-Inszenierungen. „Ich würde zum Beispiel Instagram deshalb in dieser Hinsicht als ein Negativmedium bezeichnen“, meint Horx. Auch die Politik gibt da ebenfalls kein gutes Beispiel ab, jeder macht nur sein Ding, die Länder und Nationen denken ja auch nur an ihre Interessen und sehen nicht das große Ganze.
Das nächste Problem, das der Breitensport hat, ist die finanzielle Entlohnung, denn sie ist im Vergleich zu vielen Bereichen des Spitzensports geradezu lächerlich und verschwindend klein. Horx: „Die Entlohnungsstruktur ist nicht gegeben. Wenn dir etwas an der Gesellschaft liegt, dann wählst du das Engagement im Breitensport. Wenn es dir ums Geld geht, dann den Spitzensport. Dadurch gehen leider sehr viele mögliche Synergien verloren.“ Das aber heißt, dass sich die Entlohnung fürs Engagement im Breitensport verbessern muss. Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass die Eltern den Breitensport auf ihren ohnehin schon gestressten Schultern zu tragen haben. Das ist eine Tragödie, ein Vollversagen der Politik, die keinerlei Unterstützung liefert!
Die Gagen im Spitzensport aber müssen dieses teilweise pervers hohe Level verlassen. Die Leute können mit dieser absolut disproportionalen Entlohnung nichts anfangen und spüren die Abgehobenheit der Sportelite. Nicht von ungefähr antwortete während Corona eine italienische Krankenschwester auf eine Frage eines Reporters: „Ich bekomme 1.500 Euro pro Monat. Cristiano Ronaldo bekommt jeden Monat mehrere Millionen. Fragt doch Cristiano nach einer Lösung für all unsere Probleme!“
Ein nahes Ende der Millionen-Gagen vor allem im Fußball-Bereich sieht Horx aber nicht: „Da wurde über viele Jahre ein Monster geschaffen. Aussteigen und etwas ändern könnte man nur von innen, könnten also nur die Spieler selbst.“ An der Spitze dieser absoluten (finanziellen) Fehlentwicklung steht aber leider die olympische Bewegung. Und da blutet mein Herz bekanntlich ganz besonders stark. „Olympia war einmal eine kulturelle Universalerfahrung“, sagt Tristan Horx. „Mitmachen ist alles, das war das Credo. Das fühlt sich mittlerweile nicht mehr so an!“ Dass da einiges schiefgelaufen ist, zeigt sich daran, dass selbst traditionelle Wintersportländer wie Österreich und Deutschland ihre Bevölkerung nicht mehr überzeugen können, Olympia im eigenen Land haben zu wollen. „Die Finanz- und Korruptionsskandale haben in der breiten Gesellschaft zu einem massiven Vertrauensverlust in den Spitzensport geführt. Dazu kommen die zahllosen Dopingskandale. Der gesellschaftliche Deal ist gewissermaßen flöten gegangen.“ Das müsste eigentlich auch für den Fußball gelten angesichts einer WM-Vergabe nach Katar und vieler, vieler weiterer Korruptionsskandale auf höchster Ebene im Weltverband FIFA und im Europaverband UEFA. Allerdings genießt der Fußball auch hier eine absolute Sonderstellung. Horx sagt über dieses Phänomen: „FIFA und UEFA können noch so ein schrottiges Bild abgeben, Fußball-WM und Fußball-EM, das bekommst du nicht kaputt. Das ist noch immer eine sehr positive globale Form von Brot und Spielen. Da gibt es wahnsinnig tolle, weltzusammenführende Effekte. Und gerade in diesen Wochen und Monaten von Fußball-Großereignissen zeigt sich, dass der Sport und das Essen die zwei universellsten Erfahrungen sind, über die sich Menschen in aller Welt austauschen können.“
Umso trauriger ist es, wie es so weit kommen konnte, wie dermaßen viel kaputtgemacht werden konnte. Und es bleibt die Grundfrage: Wie kriegt man das hin, dass die Menschen wieder Vertrauen in sportliche Großereignisse, in die großen Sportverbände bekommen? Wie schafft man es, dass man wieder zurück zu den Wurzeln des Sports kommt, wieder die Herzen der Menschen erreicht?
Ansetzen muss man ganz klar mit einer Revolution des Bildungsbereichs. Genau dafür kämpfe ich ja auch mit meiner Felix-Neureuther-Stiftung, denn sie soll den Kids Freude an der Bewegung vermitteln. Allerdings läuft man da größtenteils gegen Betonmauern. Allein bis zum Frühjahr 2020 bin ich fünfmal topmotiviert ins Kultusministerium spaziert und hab dort versucht zu erklären, wie wichtig Bewegung für unsere Kinder ist. Und fünfmal bin ich rausgekommen und hab mich gefühlt wie ein kleiner, gebeutelter Bub. Weil ich das Gefühl hatte, dass sich einfach nichts bewegt. Deshalb schnappte ich für einen Termin beim Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder meinen Freund Uli Hoeneß an der Hand und sagte: „Uli, bitte komm mit.“ Immerhin dürfte da jetzt etwas anrollen. Die tägliche Sportstunde in unser System zu implizieren, scheint jedoch weiter ein Ding der Unmöglichkeit. Aber zumindest gibt es jetzt den Plan, dass sich die Kinder von den 50 Minuten einer Schulstunde immerhin fünf Minuten bewegen „müssen“, also eigentlich dürfen! Es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, dass die Kinder still dasitzen und ruhig halten müssen, ihnen der Stoff reingeprügelt wird und es keine Chance auf Bewegung gibt!? Tristan Horx meint zu diesen Zuständen: „Das ist eine Diskussion, die ich noch nie verstanden habe. Es ist doch klar erwiesen, dass die Kinder durch Bewegung in jeder Hinsicht leistungsfähiger werden. Nur leider wirkt hier die Kraft der Fakten anscheinend nicht. Da ist eine politische Blockade drinnen. Es liegt an diesem zähen Schulsystem, in dem wir Kinder weiterhin für einen Arbeitsmarkt ausbilden, den es seit 40 Jahren in dieser Art nicht mehr gibt. Abgesehen davon funktioniert die Talentförderung in den öffentlichen Schulen gar nicht.“
Bei all den negativen Folgen von Corona stellt sich in sämtlichen Bereichen des Lebens auch die Frage: Ist Corona nicht auch eine große Chance? – Wobei Corona noch eine Sache sehr, sehr deutlich gezeigt hat: Mit welchem Risiko wurde da seit vielen Jahren gewirtschaftet, wenn manche Unternehmen nicht einmal einen zweimonatigen Lockdown verkraften!? Also, ich persönlich könnte ja überhaupt nicht gut schlafen, wenn ich wirtschaftlich so am Limit kalkulieren würde. Horx: „Genau deshalb fordere ich neben Sportbildung auch Zukunftsbildung als verpflichtendes Schulfach! Wie kann es sein, dass manch 80-jährige Unternehmen nicht einmal ein paar Wochen Lockdown überleben? Dabei ist der Mensch eigentlich so, dass er Krisen mag. Mehr Krisenliebe würde uns guttun. Menschen entwickeln sich durch Krisen weiter. Nehmen wir den Teamsport als Beispiel. Da gibt es zehn Rückschläge und am Ende erreichst du dann dein Ziel. Die Menschheit ist durch Krisen immer gewachsen. Es war letztlich die Pest, die das Mittelalter beendete und die Renaissance einläutete. Hier wird jetzt ebenfalls etwas mobilisiert werden, da bin ich mir sicher!“
Horx sieht also die Chance Corona ebenfalls ganz deutlich. Und er setzt auch viel, viel Hoffnung in die neue Generation, die er sehr treffend als Generation C, also als Generation Corona bezeichnet. „Die Krise hat die kollektive Entschleunigung beschleunigt. Davor hatte es schon Tendenzen in diese Richtung gegeben. Aber davor hatte man auch das Gefühl, wenn man entschleunigt, wenn man einmal den Pause-Knopf drückt, dann überholen einen die Leute links und rechts wie wild. Der Rest zieht an einem vorbei, im Arbeitsmarkt, in der Bildung, im Sport. Diesmal war’s eine kollektive, gemeinsame Erfahrung, man war kein Außenseiter, wenn man eine Pause machte. Wenn du zu Hause festsitzt, dann ist das Spazierengehen oder Joggen plötzlich der Höhepunkt des Tages. Es war eine Rückbesinnung auf die Urwerte, eine Kurskorrektur. Corona hat nichts neu erfunden, aber das Augenmerk auf Schwächen des Systems gerichtet. Wirtschaftlich gibt es bereits Tendenzen, zum alten Spiel zurückzukehren. Spannend ist für mich zum Beispiel die Frage, ob die Kultur der Mega-Kreuzfahrten wieder aufersteht. Gibt es weiterhin genügend Idioten, die so etwas machen? Aber ich denke, dass wir auf einem guten Moment sitzen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Die Leute verstehen, dass man nicht wieder zurück in die Steinzeit gehen sollte, dass Qualität statt Quantität zählt.“
Ich denke auch, dass da draußen so viele coole, junge Menschen herumlaufen. Die trauen sich was, wie zum Beispiel die Bewegung „Fridays For Future“ zeigt. Aber ganz provokant gefragt: Wird es eine Generation, die sich von irgendwelchen selbsternannten Influencern sagen lässt, was richtig und wichtig ist, schaffen, die richtigen Lehren zu ziehen? Horx: „Bei den sogenannten Influencern hat Corona zu einer gewissen Desillusionierung beigetragen. Während Corona wurde es auch bei ihnen immer unrealistischer, dieses perfekte Leben vorzugaukeln. Diese Influencer werden mittlerweile mit viel Häme bedacht. Trotzdem: Es ist ein digital verseuchtes Spannungsfeld, in dem die Jugend aufwächst. Und die Manipulationsmöglichkeit ist natürlich vor allem bei den Kleineren, den Sechs- bis Achtjährigen, die schon ein Handy haben, gegeben. Gleichzeitig ist es aber eine sehr gut informierte, sehr schlaue und weltoffene Generation. Bessere Karten für eine weiblichere, gebildetere, weltoffenere Generation gibt’s doch nicht. Ich nenne sie die Generation C, die Generation Corona. Corona wird quasi ihr Ur-Trauma sein. Ich setze viel Hoffnung in sie. Da liegt ein Tonus Rebellion in der Luft, ein Zeitalter der Rebellion, wie sich bei Fridays For Future oder Black Lives Matter eindrucksvoll zeigt. Da werden seit 40, 50 Jahren eingefahrene soziale und politische Systeme in Frage gestellt. Weil es einfach nicht mehr geht, weil der gesellschaftliche Deal nicht mehr funktioniert. Und das Potenzial, jetzt etwas zu hinterfragen und auch zu verändern, ist definitiv da. Black Lives Matter war und ist zum Beispiel die größte Sozialbewegung der bisherigen Menschheitsgeschichte! Das wurde nur durchs Internet möglich.“
Okay, ein klarer Pluspunkt für das Internet und soziale Medien. Aber werden unsere Kinder nicht trotzdem vor allem durch die Digitalisierung vom Sportmachen abgehalten? Nehmen wir allein das Thema E-Sport her. Horx: „Ein genialer Marketingtrick, dass man das alles überhaupt Sport nennen darf. Sport ist meiner Meinung nach etwas ganz anderes. Das ist Antisport. Man sieht da Leute, die in dieser Szene nach oben kommen, die sich absolut nicht als Vorbilder für unsere Kinder eignen. Die Stars dort sind mehrheitlich keine Leute, die Menschenmassen inspirieren können. Das sind technikaffine, großteils verbitterte Leute, die mit dem Fame, ihrer Berühmtheit, nicht umgehen können. Ich kenn mich in dieser Szene einigermaßen aus und sehe dort aktuell eine Art Me-too-Bewegung. Denn da passieren zwischenmenschliche absolute No-Gos. Also auch sozial total fragwürdig.“
Viele Kinder scheinen es verlernt zu haben, sich auch einmal zu langweilen. Dabei ist Langeweile doch pädagogisch sehr wertvoll. Nach 20 Minuten Langeweile beginnt ein höchst interessanter kreativer Prozess. Irgendwie scheint es so, als würde man stattdessen den schnellen Kick auf dem Smartphone suchen und fördern anstelle des oft langen, harten Weges zum sportlichen Erfolg. Dabei ist es doch so, dass die Zufriedenheit viel, viel größer ist, wenn du lange auf etwas hinarbeitest. Im Sport bekommst du diesen Kick nicht so häufig. Aber wenn du dann da ganz oben stehst, dann ist der Kick einfach gewaltig! Horx: „Biochemisch und evolutionär sind wir Menschen einfach darauf programmiert, den kürzesten Weg zur Befriedigung zu wählen. Das Smartphone bringt diesen Minikick mit diesen ganzen Handyspielen sehr schnell. Social Media auch. Zum Beispiel durch diese leuchtenden, roten Zahlen, die dir auf Facebook sagen, dass jemand deinen Beitrag geliked hat. Die Aufgabe ist es, diesen Instinkt zu überwinden und lieber fürs Langziel, für den verspäteten, aber länger anhaltenden Kick zu arbeiten. Ein gutes Beispiel ist das im Langstreckenlauf und teilweise auch im Radsport bekannte Runner’s High, dieser Laufkick, den du aber nur dann bekommen kannst, wenn du davor zwei bis vier Wochen richtig leidest.“
Trotzdem täuscht der Eindruck nicht, dass gerade durch Instagram & Co. die sportliche Betätigung und die Gesundheit bei den Kids eine Schlüsselrolle spielt und weiter spielen wird. Schließlich will man ja gut ausschauen, wenn man Fotos von sich postet. Irgendwie seltsam, aber immerhin auch ein Anreiz für Bewegung. Wie sieht Horx die Rolle des Sports in der Zukunft? Ist Gesundheit wirklich nur die Abwesenheit von Krankheit? „Nein, es ist viel mehr. Und das ist mittlerweile allen klar. Würde ein Arzt quasi dein Gesundheitscoach sein und Geld dafür bekommen, wenn du als Patient einfach nur gesund bleibst, was würde er als erstes verschreiben? Ganz klar: Sport! Er ist die einfachste, zentralste Lösung in Gesundheitsfragen. Auch für die psychische Gesundheit. Social Media machen depressiv, das ist erwiesen. Du hast zwar virtuell 5.000 Freunde, aber das ist weder realistisch noch gesund. Ein wahres soziales Umfeld beschränkt sich im Durchschnitt auf maximal 200 Menschen. Teamsport bildet Gemeinschaften, bringt echte Kontakte. Es bleiben also zwei zentrale Erkenntnisse: Erstens, beim Sport vergisst du nach einer gewissen Zeit dein Smartphone. Und zweitens, Sport ist eine gemeinsame, kollektive Erfahrung.“
Und wie schaut’s mit „meinem“ geliebten Skisport aus? Hat der überhaupt noch eine Chance? Ist es ökologisch vertretbar, in Zukunft Ski fahren gehen zu wollen? „Der Skisport hat das Problem, als ökologisches Strafkind herangezogen zu werden. Ich sehe aber eine recht einfache Möglichkeit, das Ganze leicht umzudrehen, das Image ins Gegenteil zu wandeln. Was man von der Natur nimmt, soll man nicht eins zu eins, sondern deutlich mehr als eins zu eins zurückgeben! Dadurch würde der Imagewandel recht schnell und einfach gelingen. Die Stärke der Seilbahnindustrie ist verrückt. Da wäre es doch wohl kein Problem, 20 Prozent der Umsätze in die Erhaltung der Natur zu stecken. Man kann über den Skisport zeigen, wie schön die Berge sind. Und die Berge und die Natur dadurch gleichzeitig sogar stärken und fördern. So tut man quasi etwas Gutes, wenn man Ski fahren geht, und damit wäre das Ding gedreht. Tut man das hingegen nicht, wird das nicht mehr lange funktionieren, weil die jüngere Generation ganz einfach nicht mehr mitmacht. Das Argument, dass Strukturen zu eingefahren und nicht zu verändern sind, zählt nicht mehr. Denn bei Corona hat man gesehen, dass quasi die ganze Welt innerhalb weniger Tage heruntergefahren werden kann … Wenn es wirklich notwendig ist!“
| DIE LÖSUNGSVORSCHLÄGE |
•Mehr Grundvertrauen in die neue Generation, die Generation C(orona).
•Mehr Bodenhaftung der Spitzensportler – im persönlichen Umgang mit Kindern, aber auch bei den Gehältern und bei der Selbstinszenierung auf Social Media.
•Stopp der Überindividualisierung – Erwachsene, die Kinder bekommen, müssen auch wieder bereit sein, mehr Kompromisse zum Wohl ihrer Kinder einzugehen.
•Die Entlohnung für ein Engagement im Breitensport muss deutlich höher werden.
•Sport als Medizin ansehen und etablieren – Sport ist die zentralste Lösung in körperlichen und psychischen Gesundheitsfragen.
•Revolution des Bildungssystems – tägliche Sportstunde.
•Der Skisport muss vom ökologischen Strafkind zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit werden. Nicht eins zu eins, sondern deutlich mehr als eins zu eins muss der Natur zurückgegeben werden.
•Sportbildung und Zukunftsbildung als verpflichtende Schulfächer.