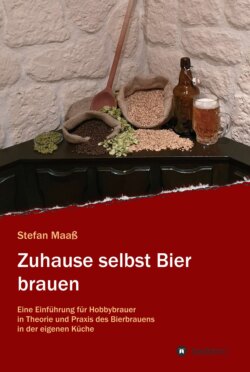Читать книгу Zuhause selbst Bier brauen - Stefan Maaß - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Einführung
1.1 Was ist Bier?
Bier ist ein „aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser gegorenes, kohlensäurehaltiges, würziges, leicht alkoholisches Getränk“. Sagt der Duden. Im Unterschied zum Wein wird beim Bier also Getreideextrakt vergoren, und kein Fruchtsaft.
Bier ist vergorener Getreideextrakt. Wein dagegen ist vergorener Fruchtsaft.
Damit ist aber noch lange nicht alles gesagt. Es gibt wohl kaum ein Getränk, das eine vergleichbar durstlöschende Wirkung hat, die schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Damit ist Bier das wohl älteste Volksgetränk der Welt.
Zudem enthält der „Gerstensaft“ neben Alkohol auch eine Vielzahl an Mineralstoffen wie z.B. Kalium, Calcium, Magnesium, Chloride oder Silizium, die allesamt vom Körper in gewissen Mengen benötigt werden und denen zum Teil auch gesundheitsfördernde Wirkungen zugesprochen werden.
Bier enthält u.a. auch Vitamine, Folsäure, Proteine und Aminosäuren. Und aufgrund seiner polyphenolischen Antioxidantien schützt es wahrscheinlich sogar vor Arteriosklerose. Vermutlich hat es auch noch eine Vielzahl weiterer positiver Gesundheitseffekt, auch wenn die Studien hier zum Teil widersprüchlich sind.
Bier enthält weniger Kalorien als viele andere Getränke.
Der Brennwert typischer Biersorten ist weniger hoch als häufig vermutet wird: mit ca. 230 kcal enthält eine Flasche Weißbier (0,5 Liter) deutlich weniger als die gleiche Menge Rotwein (ca. 330 kcal).
Nicht zu verharmlosen sind aber auch die Risiken, die sich aus übermäßigem Konsum des blonden Getränkes ergeben können. Jedoch ist es hier wie so oft: „die Dosis macht das Gift“, wie Paracelsus schon vor vielen Jahren erkannt hat.
Die Herkunft des Wortes „Bier“ ist übrigens nicht eindeutig geklärt, was auch daran liegen mag, dass die Entstehungsgeschichte schon so viele tausend Jahre zurück liegt. Bier ist schließlich keine Erfindung der Neuzeit!
1.2 Geschichte des Bieres und des Bierbrauens
Bier gab es schon im Altertum. Aber nicht so, wie wir es heute kennen.
Bier als alkoholisches Getränk ist der Menschheit schon seit Jahrtausenden bekannt. Man nimmt heute an, dass seine Entdeckung zufällig erfolgte, indem man feststellte, dass Getreideerzeugnisse unter bestimmten Bedingungen nach einigen Tagen zu gären begannen. Meist handelte es sich dabei um eingeweichtes Fladenbrot. Bier aus Malz statt aus Brot wurde erst deutlich später gebraut.
Mit dem Bier, so wie wir es heute kennen und schätzen, hatten die ersten „Erzeugnisse“ freilich noch wenig zu tun: gebraut wurde mit praktisch allen verfügbaren Getreidesorten. Auch die heute selbstverständliche Hopfennote war damals noch gänzlich unbekannt.
Statt Hopfen kamen früher Gewürze und Kräuter ins Bier.
Der Hopfen wurde nämlich erst viel später, in einer mittelalterlichen Klosterbrauerei, erstmals zum Brauen eingesetzt. Stattdessen kamen allerlei Gewürze und Kräutermischungen (sog. „Grut“ oder „Gruit“), zum Teil mit psychotroper Wirkung, zum Einsatz. Ob es sich der heutige Biertrinker nun vorstellen mag oder nicht: von Datteln, über Bohnen, bis hin zu Kümmel, Koriander, Orangenschalen und Zimt kam in der langen Geschichte des Bierbrauens praktisch alles ins Bier, was greifbar war. Selbst vor giftigen Pilzen schreckte mancher „Bierbrauer“ nicht zurück.
Die Bier-Vielfalt war daher schon im Altertum groß: so kannte man bereits im alten Babylon über 20 verschiedene Biersorten aus Gerste und Emmer! Und auch im alten Ägypten war Bier schon ein Volksgetränk, das von alten Schichten bis hin zu den Arbeitern im Pyramidenbau konsumiert wurde. Lediglich die Römer waren weniger begeistert: sie tranken lieber Wein.
Übrigens war das Bierbrauen früher wie das Brotbacken auch Frauensache!
Mittelalterliche Bierbrauer, um 1568.
Das änderte sich etwas im frühen Mittelalter, als die Mönche in den Klöstern mit dem Bierbrauen anfingen. Sie besserten sich an den damals noch sehr zahlreichen Fastentagen ihre Nahrung mit etwas „flüssigem Brot“ auf. Und in der Bevölkerung war das Biertrinken damals so üblich, dass man es sogar schon Kleinkindern zu trinken gab. Es galt als nahrhaft, und das Kochen während des Brauprozesses sorgte für weitgehende Keimfreiheit, wovon das damalige Trinkwasser weit entfernt gewesen sein dürfte.
Das mittelalterliche Bier besaß nur wenig Kohlensäure, seine Haltbarkeit war gering. Gebraut wurde ähnlich wie schon im Altertum mit allen verfügbaren Getreidesorten. Sogar Kartoffelbier gab es!
Die Erfindung der Kältemaschine ermöglichte das ganzjährige Bierbrauen.
Der hohe Bierkonsum führte zu einer zunehmenden Regulierung. Nach der Einführung von Braurechten kam schließlich im Spätmittelalter auch die Biersteuer.
Vor der Erfindung der Kältemaschine durch Carl von Linde war das Brauen im Sommer übrigens problematisch, da die für die Herstellung untergäriger Biersorten erforderlichen niedrigen Temperaturen nicht gegeben waren. Bier wurde daher früher grundsätzlich obergärig gebraut. Die Kältemaschine machte es dann möglich, auch im Sommer untergäriges Bier zu brauen.
Früher wurde das eigene Bier häufig selbst gebraut.
Es verwundert nicht, dass ein solches Massengetränk früher auch häufig selbst hergestellt wurde. Das Bierbrauen im eigenen Haushalt war in Deutschland lange Tradition und wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr und mehr eingeschränkt, bis hin zum Verbot, Rohstoffe und Anleitungen zum Bierbrauen anzubieten. Damit wurde das Selbstbrauen faktisch unterbunden.
Erst seit Mitte der 1980er Jahre ist das Hobbybrauen wieder erlaubt. Und seit 2004 brauchen Sie noch nicht einmal mehr einen Braumeistertitel, um Bier in großen Mengen herstellen und verkaufen zu dürfen.
Das Reinheitsgebot von 1516 sollte die Bierqualität erhöhen, aber auch wertvolles Getreide für die Lebensmittelherstellung reservieren.
1.3 Das Reinheitsgebot
Der zunehmende Bierkonsum führte in Verbindung mit einigen Missernten zu einer bedrohlichen Verknappung von Getreide, das an sich auch zur Herstellung von Brot hätte verwendet werden können. Es kam hinzu, dass durchaus nicht nur unbedenkliche Kräuter zur Bierherstellung eingesetzt wurden. Und so sah man sich schließlich dazu gezwungen, erste Verordnungen zu erlassen.
Nur Wasser, Hopfen und Gerste solle verwendet werden! Die Hefe und ihre Bedeutung für das Bier waren damals noch unbekannt, daher fehlte sie in den damaligen Vorschriften. Und der Weizen solle genau wie der Roggen ausschließlich den Bäckern für die Brotherstellung vorbehalten bleiben. Mit Gerste lässt sich nämlich nicht sehr gut backen, außerdem ist die Pflanze weniger anspruchsvoll als z.B. Weizen, was ihren Abbau anbelangt.
Das Reinheitsgebot verbietet aber auch in Deutschland die Herstellung interessanter Biervariationen!
Aus Sicht der deutschen Verbraucher und Brauereien sorgt das „deutsche Reinheitsgebot von 1516“, das eigentlich eine nur für Bayern gültige Verordnung war, und in dem das Wort „Reinheit“ interessanterweise gar nicht vorkommt, für besonders reines, qualitativ hochwertiges Bier. Ganz anders sieht man das im Ausland, wo man das Reinheitsgebot als Innovationsbremse wahrnimmt.
Ganz unrecht haben sie damit nicht, denn statt Sortenvielfalt gibt es in hiesigen Getränkemärkten vor allem Markenvielfalt. Es ist auch kaum einzusehen, warum Bier, das doch als „flüssiges Brot“ gilt, nicht ebenso abwechslungsreich sein darf, wie das Brot des örtlichen Bäckers, der wie selbstverständlich mit allerlei Zutaten experimentieren darf, solange sie nicht gesundheitsschädlich sind!
1.4 Einteilung der Biere
Da es sehr viele verschiedene Biere gibt, macht es Sinn, die einzelnen Sorten in unterschiedliche Kategorien einzuteilen.
Einteilung nach dem Stammwürzegehalt.
Die „deutsche Bierverordnung (BierV)“ definiert in §3 vier verschiedene Biertypen, die sich durch den Stammwürzegehalt unterscheiden:
■ Biere mit niedrigem Stammwürzegehalt (unter 7%)
■ Schankbiere (Stammwürzegehalt zwischen 7,0 und 10,9%)
■ Vollbiere (Stammwürzegehalt zwischen 11,0 und 15,9%)
■ Starkbiere/Bockbiere (Stammwürzegehalt mindestens 16%)
Diese Einteilung ist auch maßgeblich für die Bemessung der Biersteuer. Die Stammwürze gibt übrigens an, wieviel aus dem Malz gelöster Extrakt vor Einsetzen der Gärung in der Bierwürze vorhanden ist. Je höher die Stammwürze, umso mehr Alkohol wird tendenziell im fertigen Bier vorhanden sein.
Einteilung nach der Hefeart.
Je nach verwendeter Hefeart (obergärig oder untergärig) werden Biere auch in ober- oder untergärige Biere unterteilt. Untergärige Biere sind z.B. das Pils, oder das Märzen. Ein typisches obergäriges Bier ist dagegen das Weizenbier.
Weitere Unterteilungen.
Auch nach dem Brauort können verschiedene Biergattungen unterschieden werden. Überregional bekannt sind besonders der „Münchner“, der „Dortmunder“, der „Wiener“ oder auch der „Pilsener“ Biertyp.
Und selbstverständlich kann man Biersorten auch nach der Farbe oder auch nach der verwendeten Getreidesorte (Gerste/Weizen etc.) unterteilen.
1.5 Bekannte Biersorten
Auch wenige Grundstoffe ermöglichen eine unüberschaubare Variantenvielfalt!
Je nach verwendeten Malz-, Hopfen- und Hefearten ergeben sich völlig unterschiedliche Biersorten, die sich in Farbe, Geruch und Geschmack deutlich voneinander unterscheiden.
Wir wollen uns die Geläufigsten mal näher ansehen. Es sei aber darauf hingewiesen, dass alle angegebenen Zahlenwerte für Stammwürze und Alkoholgehalt als Durchschnittswerte zu verstehen sind. Abweichungen sind in Einzelfällen durchaus möglich.
Es kommt hinzu, dass sich manche Biersorten im Laufe der Jahrzehnte auch weiterentwickeln. Was ein bestimmtes Bier vor hundert Jahren ausmachte, ist nicht zwingend identisch mit dem, wie wir die gleiche Sorte heute kennen.
1.5.1 Deutsche Biersorten
Die deutschen Biere sind weltweit für ihre hohe Qualität bekannt. Und obwohl das Reinheitsgebot die Vielfalt einschränkt, bieten die hiesigen Brauereien tausende verschiedene, sehr gute Biere an.
Hopfen und Malz – Gott erhalt’s!
Altbier
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | 11,5% - 12% |
| Alkohol: | 4,8% - 5% |
Das Altbier wird vor allem am Niederrhein und in der Region um Düsseldorf konsumiert. Es ist von dunkler Farbe, schmeckt etwas bitter und weist eine deutliche Hopfennote auf. Es wird häufig aus kurzen 0,2-Liter-Gläsern oder Altbierpokalen getrunken.
Altbier: dunkel, etwas bitter und deutlich gehopft.
Der Name „Alt“ ist übrigens ein Hinweis auf die „alte Art“ Bier zu brauen, also die obergärige Brauweise. Dennoch wird es traditionell kühl vergoren, was dazu führt, dass die Hefe deutlich weniger Stoffwechselnebenprodukte ausscheidet. Das „Alt“ schmeckt daher auch besonders sauber, seine „Drinkability“ ist ausgezeichnet.
Neben Gerstenmalz wird häufig auch ein geringer Anteil (bis zu 10%) Weizenmalz eingesetzt, besonders bei der westfälischen Altbier-Variante.
Im angelsächsischen Sprachraum wird das „Alt“ oft als „German Brown Ale“ bezeichnet.
Bockbier
| Hefetyp: | unter- oder obergärig |
| Stammwürze: | 16% - 17%, als Doppelbock mindestens 18%, als Eisbock bis zu 25% |
| Alkohol: | mindestens 6,5%, Doppelbock: 9% - 10%, Eisbock: über 10% |
Bockbier ist ein meistens mehr oder weniger dunkles, oft auch bernsteinfarbenes Starkbier, das heutzutage für gewöhnlich untergärig gebraut wird. Helle Bockbiersorten, z.B. das Maibock, sind eher selten. Die obergärige Variante wird als Weizenbock bezeichnet.
Bockbier: meist dunkles Starkbier mit hohem Alkoholgehalt.
Es wird häufig als „Festbier“ zu besonderen saisonalen Anlässen gebraut. Doppelbockbiere enden traditionell auf „-ator“.
Das „Eisbock“ wird nach der Gärung eingefroren. Nach der Bildung von Eiskristallen wird der nichtgefrorene Teil abgetrennt, wodurch sich der Alkoholgehalt erhöht, da der Alkohol nicht einfriert.
Der typische Bockbier-Geschmack ist sehr malzig, seine Hopfenbittere bleibt dezent im Hintergrund. Das Eisbock zeichnet sich durch besonders intensive Malzaromen aus.
Erfunden wurde das Bockbier im niedersächsischen Einbeck, was auch die Bezeichnung erklärt. Durch seinen hohen Alkoholgehalt war es länger haltbar als andere Biere und damit auch für den Export geeignet. Die Bayern allerdings waren von dem kräftigen Malzgeschmack so begeistert, dass sie irgendwann begannen, mithilfe eines Einbecker Braumeisters ihr eigenes Bock zu brauen.
Ein gelungenes Bockbier zu brauen ist nicht ganz einfach, da durch die hohe Stammwürze während der Gärung und Lagerung besonders viele sogenannte „Bukettstoffe“ gebildet werden, die sich bei Braufehlern schnell ungünstig auf den Geschmack auswirken.
Dunkles (Export dunkel, Lager dunkel)
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | 10% - 14%, als Export ca. 12% |
| Alkohol: | 4,6% - 5,6% |
Dunkles Bier ist vor allem in Bayern verbreitet. Es ist nur leicht gehopft und daher im Geschmack angenehm vollmundig und malzaromatisch, weshalb es auch durchaus gerne von Frauen getrunken wird. Brenzlige Röstaromen gehören nicht in ein „Dunkles“. Daher werden heute oft entspelzte Farbmalze, die weniger dieser Nebenaromen enthalten, zum Einfärben verwendet.
Dunkles: malzaromatisch und leicht süß, auch bei Frauen beliebt.
Die dunklen Malzsorten kommen auch gut mit dem harten Wasser rund um München zurecht, was wesentlich zum Erfolg dieser Biersorte in dieser Region beitrug.
Als „Lagerbier“ wurden früher übrigens ganz pauschal alle untergärigen Vollbiere bezeichnet. Heute versteht man in Deutschland unter einem „Lager“ untergäriges Bier mit maximal 12% Stammwürze, das kein Pils ist.
Das „Exportbier“ war in Deutschland bis in die 70er-Jahre hinein das Bier mit dem höchsten Marktanteil, es wurde also bei weitem nicht nur exportiert.
Helles (Export hell, Lager hell)
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | 10% - 14%, als Export ca. 12% |
| Alkohol: | 4,6% - 5,6% |
Das „Helle“ ist dem „Dunklen“ von seinem Charakter her sehr ähnlich, wenn man von seiner strohgelben Farbe einmal absieht. Es schmeckt wie das Dunkle auch etwas süß und ist vor allem in süddeutschen Biergärten sehr beliebt. Es wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts von der Spaten-Brauerei in München gebraut, um dem immer beliebter werdenden „Pilsner“ etwas entgegensetzen zu können.
Das Helle: weit verbreitet in Biergärten.
Die Hopfennote ist kaum wahrnehmbar, sein Malzkörper ist ausgeprägter als bei den norddeutschen hellen Biersorten. „Helles Export“ ist etwas bitterer als „Helles“.
Kellerbier (Zwickel)
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | 11% - 14% |
| Alkohol: | 4,5% - 5,5% |
Kellerbier ist ein hefetrübes, naturbelassenes Bier und wird traditionell direkt aus dem Fass im Lagerkeller des Brauhauses ins Glas gefüllt. Es ist daher ungefiltert und enthält auch recht wenig Kohlensäure, da während der Nachgärung nur wenig Gegendruck aufgebaut wird. Man bezeichnet es daher auch als „ungespundetes Bier“.
Kellerbier: naturtrüb, frisch, und voller Vitamine.
Kellerbier gilt als sehr gesund, da es noch viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält, die sonst bei der Filtration verloren gehen. Besonders im Frankenland ist es weit verbreitet.
Zwickelbier: enthält im Vergleich zum Kellerbier etwas mehr Kohlensäure.
Der „Zwickel“ ist ein Holzzapfen, der früher in das Spundloch des Fasses eingeschlagen wurde, um Proben entnehmen zu können. Der Braumeister zapfte so von Zeit zu Zeit etwas „Zwickelbier“, um den Reifegrad zu beurteilen.
„Zwickelbier“ schmeckt im Unterschied zum „Kellerbier“ erfrischender, da es mehr Kohlensäure enthält.
Kölsch
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | 11,2% - 11,5% |
| Alkohol: | 4,6% - 5,1% |
Strohblond, süffig, hopfenbetont, aber dennoch angenehm mild, ist das Kölsch weit über die Domstadt Köln hinaus bekannt und geschätzt. Die „Kölsch-Konvention“ von 1986 erlaubt das Brauen von Kölsch nur in Köln und der näheren Umgebung. Den Hobbybrauer, der sein Bier für den Eigenbedarf braut, betrifft diese Beschränkung natürlich nicht!
Kölsch: eine süffige Kölner Spezialität.
Kölsch wird gerne aus 0,2-Liter-Kölschstangen getrunken. Beliebt für private Feiern sind die „Pittermännchen“, handliche Fässer mit i.d.R. 10-Liter Bier.
Wie das Altbier wird auch das Kölsch zur geschmacklichen Abrundung und zur Stabilisierung der Schaumkrone meistens mit etwas Weizenmalz gebraut.
Märzen
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | mindestens 13%, als Oktoberfestbier mindestens 13,5% |
| Alkohol: | durchschnittlich 5,6% |
Vor Erfindung der Kältemaschine war es nur in der kalten Jahreszeit möglich, untergäriges Bier zu brauen. Um trotzdem im Sommer Bier trinken zu können, braute man im März ein stärkeres, und daher haltbareres Bier, das „Märzen“. Auf dem Oktoberfest wurden traditionell die letzten Reste davon als Oktoberfestbier ausgeschenkt.
Märzen: hell oder dunkel, aber immer malzbetont und angenehm vollmundig.
Das Märzen kann als helles oder dunkles Bier gebraut werden, wobei das helle Märzen etwas dunkler ist als die üblichen hellen Biere.
Das Märzen hat einen angenehm vollmundigen, malzigen Geschmack und wird meistens nur leicht gehopft.
In Österreich versteht man übrigens unter einem Märzen abweichend von obiger Beschreibung ein helles Lagerbier, es hat also weniger Alkohol als ein deutsches Märzen und schmeckt auch weniger malzig.
Pils
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | durchschnittlich 11,6% |
| Alkohol: | ca. 4,8% |
Das Bier nach Pilsener Art ist heute der unangefochtene Marktführer in Deutschland, von einigen Regionen im Süden vielleicht abgesehen. Kaum bekannt ist dagegen, dass es von einem bayrischen Braumeister erfunden wurde, der es in der böhmischen Stadt Pilsen erstmals braute. Er leistete damals sozusagen Entwicklungshilfe, da die Qualität der damaligen Biere aus Pilsener Brauereien miserabel gewesen sein soll. Am Martinstag 1842 wurde es dort erstmals ausgeschenkt.
Das Pils: heute in Deutschland der unangefochtene Marktführer.
Das strohblonde Pils schmeckt erfrischend herb, ist stark hopfenbetont, trocken im Abgang und zeichnet sich durch eine markante, sahnige Schaumkrone aus. Pilsbiere aus norddeutschen Brauereien sind oft etwas bitterer als solche aus süddeutschen Produktionsstätten. Pils nach böhmischer Art („Pilsner Urquell“) ist etwas dunkler.
Rauchbier
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | 11% - 14% |
| Alkohol: | 4,5% - 5,5% |
Das Rauchbier ist eine Bamberger Spezialität, die mit einem teilweisen Zusatz von Rauchmalz hergestellt wird. Rauchmalz wurde früher durch Darren von Gerstenmalz über einem mit Buchenholz befeuerten Rauchofen hergestellt und erhielt dadurch sein typisches Raucharoma. Heute wird dagegen kalter Rauch durch das Malz geleitet, was den Vorteil hat, dass weniger gesundheitsschädliche Nitrosamine gebildet werden.
Rauchbier: eine geschmacklich an Schinken erinnernde Bamberger Spezialität.
Das Rauchbier schmeckt etwas nach Speck und Schinken, was in einem Bier durchaus ungewohnt ist. Sollten Sie selber mal ein Rauchbier brauen wollen, empfehle ich Ihnen, den Anteil an Rauchmalz nicht zu hoch zu wählen (maximal 30%), damit die typische Geschmacksnote nicht zu intensiv wird.
Die Hopfenbittere fällt je nach Sorte stark unterschiedlich aus. Aromahopfen ist in diesem Bier wenig sinnvoll, da sich das feine Aroma gegenüber dem starken Rauchgeschmack nicht durchsetzen könnte.
Roggenbier
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | mindestens 11% |
| Alkohol: | ca. 5% |
Roggenbier war bis zum 15. Jahrhundert weit verbreitet. Danach wurde seine Verwendung für Brauzwecke verboten, da aufgrund von Missernten Lebensmittelknappheit herrschte und er sich im Gegensatz zur Gerste auch zum Backen eignete. Er war daher schlicht zu kostbar, um ihn zum Bierbrauen zu verschwenden.
Roggenbier: verwandt mit dem Weizenbier, aber heute nur noch selten anzutreffen.
Roggenbier ist normalerweise dunkel und dem Weizenbier nicht unähnlich. Meistens wird es auch mit Weißbierhefen vergoren. Der Anteil an Roggenmalz in der Schüttung schwankt je nach Brauerei zwischen 25 und 60%. Sein Geschmack ist vollmundig und etwas „brotig“, auch eine leicht säuerliche Note ist nicht untypisch. Heute werden Roggenbiere nur noch selten angeboten.
Schwarzbier
| Hefetyp: | untergärig |
| Stammwürze: | 11% - 13% |
| Alkohol: | 4,8% - 5% |
Ursprünglich waren alle Biere mehr oder weniger dunkel. Den Mälzereien ist es nämlich noch gar nicht so lange möglich, helles Malz herzustellen. Von daher handelt es sich beim Schwarzbier um eine sehr traditionsreiche Biersorte.
Schwarzbier: traditionsreich und angenehm vollmundig im Geschmack.
Vollmundig und malzig, oft auch mit einem gewissen Röstaroma, kommt es bei den Konsumenten gut an und findet zunehmend Verbreitung. Die meisten Schwarzbierbrauereien liegen heute in Ostdeutschland. Getrunken wird es oft aus stilechten Schwarzbierpokalen.
Neben dem thüringischen Schwarzbiertyp gibt es auch den fränkischen Typ. Dieser schmeckt meist etwas süßer als die ostdeutsche Version.
Weizenbier (Weißbier)
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | 11% - 14% |
| Alkohol: | 5% - 5,5% |
Das Weizenbier ist so typisch für Bayern wie die Weißwurst oder das Oktoberfest. Mittlerweile ist es aber in ganz Deutschland beliebt.
Das Weizenbier: schon lange nicht mehr nur in Bayern beliebt. Nicht zu verwechseln mit der „Berliner Weiße“.
Seine ausgeprägt fruchtige, zum Teil bananige, gewürznelkenartige Note, die aus der Verwendung speziell gezüchteter Weißbierhefen resultiert, macht es schon zu einem besonderen Bier, das vor allem in seiner kalorienreduzierten Form auch bei Sportlern großen Anklang findet. Es gilt als isotonisch.
Gebraut wird es mit mindestens 50% Weizenmalz. Mehr als 70% sollten es aber nicht sein, da das Weizenkorn keine Spelzen besitzt und es daher bei höheren Anteilen zu Läuterschwierigkeiten im Brauprozess käme.
Weizenbier wird nur sehr schwach gehopft, was den vollmundigen, malzigen Charakter betont. Da es sehr viel Kohlensäure enthält, ist das Einschenken schon fast eine Kunst. Dafür ist es aber auch besonders erfrischend. Je nach Malzsorte kann es von hell bis dunkel praktisch alle vorstellbaren Bierfarben abdecken.
Kristallweizen, früher auch Champagnerweizen genannt, ist im Gegensatz zum Hefeweizen filtriert, also klar wie ein Pils. Beim Hefeweizen findet die Nachgärung oftmals in der Flasche statt, so dass das fertige Bier noch Hefereste enthält.
Das Weißbier sollte nicht mit der „Berliner Weiße“ verwechselt werden. Bei diesem Bier kommen zur Gärung auch Milchsäurebakterien zum Einsatz, die für den leicht säuerlichen Geschmack sorgen. Die „Berliner Weiße“ wird meistens mit Himbeer- oder Waldmeistersirup gemischt.
1.5.2 Ausländische Biersorten
Ausländische Biere, die nicht dem Reinheitsgebot entsprechen, sind deshalb noch lange kein „Chemie-Bier“!
Abseits des Geltungsgebietes des Reinheitsgebotes bieten sich den Brauereien zusätzliche Möglichkeiten, interessante Biere zu brauen. Die Zugabe von unvermälztem Getreide oder das Brauen mit Maisflocken sind in Deutschland leider nicht zulässig, obwohl vollkommen unbedenklich. Es handelt sich dabei also keinesfalls um „Chemie-Biere“, wie von inländischen Brauern gerne behauptet wird. Immerhin ist das sogenannte „Hopfenstopfen“, also die Zugabe von Hopfen in den Gärbehälter, seit 2012 offiziell auch in Deutschland zulässig.
Ein echtes Stout!
Der Verkauf ausländischer Biere, die nicht dem Reinheitsgebot entsprechen, ist übrigens schon seit über 30 Jahren erlaubt. Einem Urteil des europäischen Gerichtshofes sei Dank.
Jeder Bierfreund sollte zumindest die bekanntesten Sorten einmal getestet haben. Und auch der Hausbrauer sei ermuntert, einmal die nicht alltäglichen Biere nachzubrauen.
Ale
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | 11% - 16% |
| Alkohol: | 3% - 10% (je nach Variante: light/heavy/export/strong) |
Als „Ale“ werden grundsätzliche alle obergärigen, englischen Biere bezeichnet. Dementsprechend gibt es verschiedene Varianten, die sich nicht nur im Alkoholgehalt unterscheiden.
Ale: der Oberbegriff für obergärige, englische Biere. Es gibt zahlreiche Varianten.
Das „Pale Ale“ ist ein helles, kupferfarbenes Bier, das zwischen 4,5 und 5% Alkohol enthält. Deutlich stärker ist das „India Pale Ale“ (IPA), das früher für den Export in die indischen Kolonien haltbar gemacht wurde. Es enthält auch sehr viel Hopfen und sollte nach der Ankunft eigentlich verdünnt werden, was aber sicher nicht immer passiert ist.
„American Pale Ale“ wird im Gegensatz zum englischen „Pale Ale“ häufig mit kanadischem oder deutschem Malz gebraut. Auch sein Hopfencharakter ist anders, oft zitrusartig. Generell ist die amerikanische Craft-Beer-Szene sehr experimentierfreudig.
Das „Mild Ale“ war früher ein Starkbier mit bis zu 8% Alkohol, was den Leser überraschen dürfte. Heute hat es nur noch einen geringen Alkoholgehalt (etwa 3%) und ist auch nicht so bitter wie andere Ales. Es schmeckt für gewöhnlich malzbetont.
„Brown Ale“ ist sehr dunkel, von malzigem bis karamellartigem Charakter und enthält etwa 6% Alkohol.
„Bitter Ale“ ist etwas dunkler als „Pale Ale“. Es wird stark gehopft, sein Alkoholgehalt schwankt zwischen 4 und 5,5%.
„Scotch Ale“ ist sehr malzbetont, was aus der Verwendung schottischer Gerstensorten mit ausgeprägt malzigem Charakter resultiert. Es wird normalerweise aus einem „Distelglas“ getrunken.
Porter
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | 13% - 14% |
| Alkohol: | 4,5% - 5% |
Das dunkle und stark gehopfte Porter war früher in England weit verbreitet. Es soll besonders bei den Londoner Hafenarbeitern sehr beliebt gewesen sein. Sein Geschmack ist malzig mit deutlichen Röstaromen und erinnert in seiner klassischen Variante als „London Porter“ sogar an Kaffee und Schokolade. Das Porter wurde später zunehmend von blonden Biersorten verdrängt.
Porter: früher das Bier der Londoner Hafenarbeiter.
Das „Baltic Porter“ war ein Export-Bier speziell für die Ostsee-Länder. Es ist meist etwas stärker als das „London Porter“, was seiner Haltbarkeit zugutekommt. Vor Ort wurde es oft auch untergärig gebraut, was an dem kühlen Klima in diesen Ländern lag.
Das „deutsche Porter“ war ursprünglich die deutsche Kopie des erfolgreichen „London Porter“. Natürlich wird es nach dem Reinheitsgebot gebraut. Geschmacklich kommt es dem Original recht nahe, obwohl es für gewöhnlich eine höhere Stammwürze hat. Es wurde vor allem in der ehemaligen DDR getrunken.
Stout (Irish)
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | ca. 11,5% |
| Alkohol: | 4,1% - 4,4% |
| als Imperial Stout: | 8% - 10% |
„Stout“ ist ein tiefschwarzes, stark gehopftes Bier, das unter Verwendung von gerösteter, unvermälzter Gerste und karamellisiertem Zucker gebraut wird.
Stout: sehr malziges Bier mit deutlichen Röstaromen.
Bekannteste Stout-Brauerei ist Guinness. Das „Stout“ ging aus dem „Porter“ hervor, es sollte mehr Körper enthalten als dieses. Es schmeckt etwas „angebrannt“ und sehr malzig, sein Schaum ist besonders cremig und stabil.
„Imperial Stout“, ursprünglich für den Export gebraut, enthält deutlich mehr Alkohol.
Trappistenbier (Dubbel, Tripel)
| Hefetyp: | obergärig |
| Stammwürze: | 12,5% - 25% |
| Alkohol: | 4% - 12% |
Dieses Bier der belgischen Trappistenmönche enthält meistens besonders viel Alkohol, was durch die Zugabe von reichlich Zucker erreicht wird. Der Hopfen stammt oft aus der Region der Klosterbrauerei oder sogar aus dem eigenen Garten und auch die Hefe wird gerne selbst gezüchtet. Man nennt sie dann auch „Trappistenhefe“.
Trappistenbier: bekannt für seinen meist hohen Alkoholgehalt.
Das Geschmacksprofil ist malzbetont und äußerst komplex. Ansonsten ist es kaum möglich, typische Eigenschaften eines Trappistenbieres zu nennen, da sich die unterschiedlichen Varianten in Farbe, Bittere und Alkoholgehalt drastisch unterscheiden können. Meistens ist ein Trappistenbier aber eher dunkel und leicht rötlich, ist eher mild gehopft und enthält recht viel Alkohol.
Als „Dubbel“ liegt der Alkoholgehalt durchschnittlich bei etwa 7,5%. Die „Tripel“-Variante erreicht noch höhere Werte, teilweise bis zu 12%. Tripel-Trappistenbiere werden mit hellem Malz gebraut und haben daher einen hellen, goldfarbenen Ton.