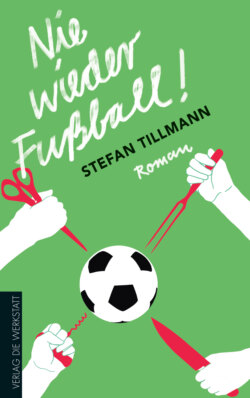Читать книгу Nie wieder Fußball! - Stefan Tillmann - Страница 9
ОглавлениеMannschaftsvorstellung
Der Schritt ins Lot Jonn zwei Wochen später war einer der schwersten meines Lebens. Ich fühlte mich wie ein Spieler auf dem Weg zu einem großen Spiel, aber ich wollte so nicht mehr denken. Schließlich ging es jetzt um alles. Das Lot Jonn war jedenfalls die perfekte Kneipe für einen Neuanfang, eine Jedermann-Kneipe im Stadtteil Bilk. „Mein Name ist Hübner“, sagte ich zur jungen Frau, die hinter der Theke Gläser abspülte. „Ich habe reserviert.“
Es war Samstag, das Pokalwochenende vor dem Ligastart, kurz vor halb vier, gleich würde es losgehen, gleich würden meine neuen Freunde kommen und vielleicht ein neues Leben starten. Ich hatte endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Mit der E-Mail-Adresse nie-wieder-Mehm@Scholl.de hatte ich eine Facebook-Gruppe gegründet und diverse Fußballforen angesteuert. Ich träumte von einer Bewegung, sah mich als großen, wenn auch nicht unbedingt charismatischen Leader. Wir würden vielleicht nicht gleich die Welt verändern, aber zumindest den Fußball. Und ich wäre endlich vorne dabei. So war der Plan.
In der Realität bekam ich in einer Woche acht brauchbare Antworten aus Düsseldorf und Umgebung, darunter zwei Frauen. Die meisten Interessenten waren Zugezogene. Die gebürtigen Düsseldorfer waren offenbar alle der Fortuna hörig und dachten gar nicht daran, aufzuhören. Vier Leute wollten das ganze Ding quer über Deutschland als Online-Projekt machen. „Aufziehen“ hatte einer es genannt. Aber denen antwortete ich nicht mehr. Auf so Internetprojektfritzen mit Anzügen und Turnschuhen, die jede Baustelle ihres Lebens und jeden Zahnarztbesuch zu einem Projekt erklärten, hatte ich keinen Bock. Nein, das hier war zu wichtig, wenn man so will: mein persönlicher Gang an die Börse.
Darüber hinaus gab es einen, der nur noch Champions League gucken wollte, dem antwortete ich erst gar nicht mehr. Mit solchen halbherzigen Menschen wollte ich keinen Kontakt. Dann lieber dabeibleiben, dachte ich, aber das war für mich auch längst keine Option mehr.
Zudem wollte ich, dass die Leute Fans unterschiedlicher Vereine waren. Sonst endete das nur im Aufwärmen alter Geschichten von irgendwelchen Auswärtsfahrten. Aber dieser Mythos musste gebrochen und Fußball verteufelt werden.
Den Interessenten hatte ich einen Fragebogen geschickt. Alter, Verein, erstes Spiel, schönstes Erlebnis, schlimmster Moment – und ganz wichtig: Grund für den Ausstieg. All das war vielleicht etwas pingelig, aber ich hatte keine Lust, dass irgendwelche Spaßvögel den Plan durchkreuzten. Meinen Plan. Letztlich sagten drei zu. Aber jede Bewegung fängt mal klein an.
Die drei Typen, die ich erwartete, kamen bis auf einen ursprünglich nicht aus Düsseldorf. Versprengte Seelen, die es wie mich irgendwie an den Rhein verschlagen hatte und deren vermutlich einzige Gemeinsamkeit die unerklärliche Liebe zu einer populären Ballsportart war. Aber irgendwie passte das. Denn je mobiler die Menschen in den vergangenen Jahren geworden waren, je häufiger sie umzogen, den Jobs oder ihren Träumen hinterher, desto wichtiger wurde die Heimat. Und dieser Heimatkram war vielleicht der beste Ansatz, wie man die Liebe zu einem Fußballverein erklären konnte. Andere Hobbys wie Vögelbeobachtung unterliegen zumindest noch einem gesunden Menschenverstand. Beim Fußball geht es dagegen schlicht darum, Menschen auf dem Feld anzubrüllen, damit sie in 90 Minuten die eigenen Unzulänglichkeiten ausbügeln und gewissermaßen auch den Ruf der Heimat verteidigen, wenn das eigene kleine Wirken schon nicht dafür ausreicht. Vermutlich hat der Fußball als Ventil für männliche Allmachtfantasien mehr für den Weltfrieden getan als diese ganzen Blauhelmheinis.
Die Kellnerin im Lot Jonn hatte dunkelbraune Locken, blaue Augen, eine Mischung aus Fräulein Würkl und der Hippie-Tusse aus dem Abteil. Mir war es doch etwas unangenehm, am helllichten Tag alleine in einer leeren Kneipe an einem Tisch zu sitzen, den ich blöderweise auch noch reserviert hatte. Dass gleich drei wildfremde Männer auftauchen würden, machte die Sache auch nicht unbedingt besser. Ich wusste nicht, was besser ankäme: ein junger Kerl, der alleine in der Kneipe rumsaß, oder vier Männer, die – seien wir ehrlich – nicht gelernt hatten, mit ihrer Zeit etwas Vernünftiges anzufangen.
Kurz bevor die Jungs kamen, zog mein Fußballleben an mir vorbei. Das erste Spiel: gegen Stuttgart, im Winter, verloren, Männer, die in meinen Nacken brüllten. Später war ich jedes Wochenende unterwegs, immer auf der Suche nach dem perfekten Spiel, dem perfekten Tag. Der Geruch der Tribüne, den wir besser kannten als den des Rasens. Heimat, dachte ich manchmal, ist nicht unbedingt ein Ort, Heimat ist aber auch nicht nur ein Gefühl, wie der olle Grönemeyer einem glauben machen wollte. Heimat ist oft einfach ein Geruch. Und in meinem Fall war es der Geruch der Tribüne.
Früher hatte jedes Stadion seinen eigenen Geruch. Mit meinem alten Freund Holger wettete ich einmal, ich würde jedes Stadion am Geruch erkennen. Holger reichte die Wette schließlich bei Wetten, dass..? ein. Aber von denen hat er nie etwas gehört. Und in der Zwischenzeit waren aus Stadien Multifunktionsarenen geworden, und die rochen alle gleich: nach Plastikbechern und alkoholfreiem Bier.
Das Nürnberger Stadion war noch eines der letzten mit Laufbahn. Und so sahen wir viele Spiele auf Höhe der Hochsprungmatte, die irgendwo im Innenraum liegengeblieben war. Und wenn sich dann noch ein dicker Ordner vor das Sichtfeld stellte, sahen wir oft nicht mehr als die Flankenläufe unserer Helden, die im Nichts endeten. Dass Fußballspieler fünf Tage die Woche trainierten und dennoch nicht ordentlich flanken konnten, war eines der letzten Rätsel, die bei all dem Theoriegewese der Herren Rangnick & Co. immer noch ungelöst war. Vermutlich war genau das der Grund, warum sie irgendwann das System umstellten und nur noch von halben Neunen und kleinen Stürmern redeten. Einfach weil Menschen von Natur aus nicht richtig flanken können, und wenn sie noch so viel trainieren.
Meinen Freund Holger hatte ich das letzte Mal auf seiner Hochzeit gesehen. Die fand am Tag des Pokalendspiels statt, wie eigentlich alle Hochzeiten am Tag eines vermeintlich großen Fußballspiels stattfinden. Holger hatte mit dem Termin so lange gewartet, bis der Club aus dem Pokal geflogen war. Lange musste er da nicht warten. Daher spielten wir an jenem Tag im Mai Fußball auf kleine Tore. Jetzt war Holgers Frau schwanger. Holger arbeitete in einer Ventilatorenfirma in Nürnberg und würde weiter zu jedem Heimspiel gehen. Er wollte warten, bis das Kind ins fußballreife Alter kam, und es dann beidfüßig erziehen. Das war natürlich eine konsequente Form eines Lebensentwurfs und vielleicht die ehrlichste, die es auf diesem Planeten gab. Aber bevor ich Christiane Würkl oder sonst wen heiraten und schwängern würde, um einen kleinen Glubberer auf die Welt zu bringen, wollte ich vorher lieber abbiegen und mich nach Alternativen umschauen.
Die Kneipe lag in einem hohen Eckhaus an einer dicht befahrenen Kreuzung. Sie hatte was von einer Bierhalle, hohe Decken, große Biertische und dunkle Sitzecken. Als ich den Kickertisch sah, biss ich mir auf die Lippen.
Um halb vier öffnete sich der muffige Vorhang vor der Ecktür, und der erste Vogel kam herein: kräftig, Jeans, Jeansjacke, kurze graue Haare, Schnauzer. Das musste Karl sein, der Fortuna-Fan. Typ: Teddybär, treue Seele, so einer, der im Block viele Freunde hat, auch bei Niederlagenserien immer positiv bleibt und zum Trainer steht. 54 Jahre alt. Im Fragebogen hatte er als Grund für den Ausstieg angegeben, „irgendwie Lust auf einen neuen Lebensabschnitt“ zu haben.
Der Mann kam langsam auf meinen Tisch zu: „Bist du Daniel?“ Ich winkte ihn wortlos heran. Der Typ streckte mir seine Hand entgegen, und ich wusste nicht, ob ich sie ganz normal schütteln sollte – oder doch eher sportlich einschlagen wie in der Kurve.
„Hallo, ich bin der Karl“, sagte Karl. „Aber alle nennen mich Pommes. Das war …“
„Ich schlage vor, wir haben hier keine Spitznamen. Ich bin Daniel.“
„Schöne Kneipe hier“, sagte Karl, und ich hörte den rheinischen Akzent. Eine 54 Jahre alte Frohnatur, das konnte ja heiter werden. „Hast du dir den Schritt gut überlegt?“, fragte ich leise und beugte mich vor.
„Ja“, sagte Karl. „Sehr gut.“ Mist, dachte ich. Irgendwie war ich so verbohrt, dass ich schon gehofft hatte, er wäre sich nicht so sicher. Ich wollte unbedingt der Konsequenteste sein, der, der vorweggeht. Aber wer weiß, wer weiß, dachte ich – vielleicht war sich Karl ja doch nicht sicher.
„Was ist denn dein Verein?“, fragte Karl.
„Der Club.“
„Da hätte ich auch keinen Bock mehr.“ Karl grinste.
Ich hätte ihm am liebsten eine reingehauen, aber ich wollte diplomatisch sein, Käpt’n eben, anfangs zumindest. „Es geht nicht um den Club und auch nicht um die Fortuna“, sagte ich.
„Sondern?“
„Irgendwie ist es doch der ganze Fußball, das ganze System, was uns krank macht. Was uns davon abhält, wirklich zu leben.“
„Du bist Student, oder?“, fragte Karl. „Ich meine, System und so.“
„Nee, nicht mehr, ich bin fertig. Zum Glück“, sagte ich und wusste, dass das eine Lüge war. Aber immerhin stand jetzt für mich fest: ein Wackelkandidat.
Nur wenige Minuten später kamen die anderen beiden und schienen weniger anstrengend zu sein. Beide um die 40. Sven, ein alternativer Lockenkopf, Typ: Motzki im Block, einer, der viel leidet und meckert, der aber trotzdem mit dem Herzen dabei ist, und Ralf, Bürstenhaarschnitt, Jeans, T-Shirt, ein echter Kraftprotz, Typ: Sturkopf, einer, der immer kommt, aber wenig redet.
„Ralf, Hertha.“
„Sven, Werder Bremen.“
„Ich bin der Karl, eigentlich Pommes, aber wir sollen ja keine Spitznamen haben. Ach ja, ich bin Fortune.“
Endlich hatten sich alle gesetzt. Auf diesen Moment hatte ich lange gewartet. Ich hatte keine Lust mehr, über die Kneipe zu reden oder über die Anfahrtswege. Die Namen waren klar. Die Vereine. Das Ziel. Es konnte losgehen, unsere Reifeprüfung. Ich guckte rüber zur Theke, die Kellnerin war ums Eck, ein guter Moment. Ich kniff mir unter dem Tisch mit den Händen in die Knie. Dann stand ich auf.
„So, also, ich bin der Daniel. Erst einmal schön, dass ihr da seid. Ich habe das alles hier organisiert. Und ich denke, ich fange mal an. Warum ich hier stehe, warum ihr da sitzt, ist einfach: Ich will den Fußball besiegen. Und ich hoffe, ihr auch.“
Der Anfang war gemacht. Sven und Ralf Männer nickten, nur Karl suchte den Blick von Ralf. Scheiß Wackelkandidat!
„Der Fußball ist in uns, zumindest in mir, seit wir denken können, und ich will ihn nicht mehr. Ich könnte auch sagen, ich will den Teufel besiegen, aber das haben andere schon versucht und geschafft. Den Fußball hat noch keiner totgekriegt. Im Gegenteil: Woche für Woche kommen mehr Pilger hinzu, mehr Talkshows, bei denen frühere Vizeeuropameister palavern, noch mehr Monitoranalysen, die die Laufwege der Co-Trainer untersuchen. Versteht mich nicht falsch: Ich will den Fußball nicht abschaffen. Die Leute sollen hingehen dürfen, meinetwegen auch mein Sohn, der noch nicht lebt, aber diese Details, schlage ich vor, klären wir später. Ich will einfach nicht mehr Fußball gucken, nicht mehr wollen und nicht mehr müssen, nicht im Stadion, nicht im Fernsehen – und schon gar nicht auf der Großbildleinwand.“
Ich hatte den Text am Abend geübt. Erst Stichworte, dann drauflosgeredet. Dann noch mal Notizen und alles zweimal vor dem Küchentisch aufgesagt. Dem Zufall hatte ich viel zu viel überlassen, zu viel Raum gegeben, würde ein Trainer sagen. Zwischendurch war auch mal das Albert-Camus-Zitat in der Rede drin, aber das war zu riskant. Das hatte ich schon kapiert.
Weiter, weiter, weiter: „Jeder Zweite hat mit dem Rauchen aufgehört. Oder tut so. Jeder hat schon mal ein Hobby aufgegeben, ich habe früher gerne Badminton gespielt. Irgendwann bin ich umgezogen, von Nürnberg nach Düsseldorf, und die neue Freundin wollte abends lieber in Ausstellungen gehen, dann bin ich da eben mit. Na ja, nach zwei, drei Wochen war dieser Spuk dann auch vorbei.“
Das mit der neuen Freundin und den Ausstellungen war sehr verkürzt dargestellt. Eigentlich hatte ich mich für eine Praktikantin interessiert, die mich mal auf eine Ausstellung mitnahm. Kunst war eigentlich nicht so mein Ding. Na ja, es lief natürlich nichts, aber immerhin so viel, dass es mittags in der Kantine zu ein paar ungelenken Begegnungen kam.
Sven, der Bremen-Fan, schaute auf den Tisch, kniff die Lippen zusammen und nickte. Mit dem könnte es klappen.
„Aber wer hat je den Fußball besiegt?“, fuhr ich fort. „Von uns hier offenbar keiner. Aber ich will unbedingt. Nur: Alleine schaffe ich es nicht, ich brauche Hilfe, ich brauche euch. Wir brauchen uns. Damit wir die Gespräche mit unseren Arbeitskollegen, Vätern und Söhnen nicht mehr auf den Fußball lenken müssen, weil uns nichts Besseres einfällt, und beim Sex nicht mehr an Alexander Zickler denken, um nicht zu schnell zum Abschluss zu kommen.“
Ich holte Luft. Die emotionale Stelle muss immer am Ende einer Rede liegen, das hatte ich bei den Vorbereitungen gelesen.
„Ich will meine Freude und meinen Zorn, meinen Hass und meine Liebe nicht von Menschen abhängig machen, die ich gar nicht kenne. Auf die ich gar keinen Einfluss habe und die mir total egal wären, wenn sie mit 16 Jahren so häufig in Diskotheken gegangen wären wie jetzt und dann die Fußballerkarriere aufgegeben hätten und einfach Lackierer, Bankangestellte oder Grafikdesigner geworden wären wie jeder andere gottverdammte Mensch auch. Irgendjemand hat mal gesagt, die Jugend sei erst dann vorbei, wenn der Lieblingsspieler jünger ist als man selbst. Ich bin jetzt 27, mein Lieblingsspieler ist 23.“
„Wer?“, fragte Karl.
„Klappe“, rief Sven.
„Der neue Japaner?“, murmelte Ralf, aber ich ignorierte ihn.
„Es ist ein guter Zeitpunkt, um den Schal an den Nagel zu hängen“, sagte ich. „Ich möchte Samstage mit Fahrradtouren verbringen, ja: Fahrradtouren, warum eigentlich nicht, in den Zoo gehen, wie andere Menschen auch. Mit Frauen Spaziergänge machen, einkaufen, abends essen gehen oder ins Kino, dieser ganze Kram halt. Oder einfach auf der Couch rumliegen und sich so fühlen, wie man sich am Wochenende eben fühlt. Und nicht so, wie sich elf Spieler fünf Stunden vorher gefühlt haben.“
„Rumliegen ist besser als nichts tun“, sagte Karl und hob das Glas, aber niemand reagierte.
„Gut“, sagte ich und setzte mich wieder auf meinen Stuhl. Der Anfang vom Ende war gemacht. Die drei Herren schauten neugierig, immerhin. Karl, der Älteste am Tisch, hatte permanent genickt. Daneben hatte Ralf, die Berliner Kante, zur Tür geschaut. Und der Dritte, Sven, starrte immer noch ganz zornig auf den Bierdeckel, während er ihn mit einer Hand zerdrückte.
„Und wie soll das alles ablaufen?“, fragte Karl. „Sollen wir jetzt zusammen Fahrradtouren machen oder was?“ Er lachte kurz auf, Ralf schnaubte, und Sven schaute schräg zur Kellnerin hinüber. Ja, eigentlich hatte ich mir das so gedacht: eine Gruppe, die sich samstags immer um halb vier trifft und versucht, die Zeit anders zu verbringen als im Stadion oder in einer dieser vielen Fußballkneipen. Sich gegenseitig helfen, trösten, reden und bestärken.
„Doch! Zusammen Fahrrad fahren!“, hielt ich dagegen. Aus meiner Umhängetasche holte ich ein weißes Papier. Jeder, der mitmachen wollte, sollte seine Telefonnummer eintragen. „Dann lass ich euch in den nächsten Tagen eine Liste zukommen.“ Sven rollte mit den Augen.
Wer wusste schon, wo diese Selbsthilfegruppe, dieses Projekt, mal hinführen würde? Würde es an diesem Tag schon sterben? Oder am nächsten? Unsere Vereine spielten allesamt erst am nächsten Tag im Pokal. Ich hatte ja gehofft, dass der ganze Laden brechend voll sein würde, dass ich mich auf den Tisch stellen müsste, schreiend, als Kopf der Massenbewegung. Nun waren wir zu viert und sahen so aus, wie eine Selbsthilfegruppe eben aussieht.
Ich schlug eine Vorstellungsrunde vor. Wenn schon Selbsthilfegruppe, dann richtig. Ralf meldete sich als Erster. Ich hatte den Verdacht, dass er Selbsthilfegruppen und Vorstellungsrunden schon aus anderen Zusammenhängen kannte, aber ich hatte ja keine Ahnung.
„Ich bin Ralf. Ralf Schanzer. Ich bin 45 und Hertha-Fan. War Hertha-Fan, oder wie sagt ihr? Ich komme aus Berlin-Reinickendorf und bin vor fünf Jahren nach Düsseldorf gezogen, beruflich, wegen meiner Frau. Jetzt muss Schluss sein mit dem Scheiß …“
„Mit deiner Frau?“, fragte Karl irritiert.
„Nein, verdammt, mit Hertha, sonst komme ich hier nie an“, sagte Ralf. „Meine Samstage verbringe ich in der Bahn zu den Spielen oder in der Sportkneipe. Freunde habe ich hier wenige, ein paar Kollegen vielleicht – ich bin Bürokaufmann bei der Bahn. Deswegen komme ich auch günstig zu den Spielen. Klar, mit unserem Sohn mache ich schon viel. Zoo und so, auf den Spielplatz gehen, ins Grüne fahren, mal an einen See im Umland. Aber ohne Fußball am Samstag ging es bislang einfach nicht. Meine Frau nervt das tierisch, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Aber dafür geht das auch einfach alles schon zu lange …“
„… mit deiner Frau?“, fragte Karl diesmal vorsichtig.
„Nein, ich meine mit Hertha. So leicht ist das ja eben alles nicht. Meine Frau fühlt sich schon sehr wohl in Düsseldorf, wir wohnen drüben in Eller. Jetzt hat mein Sohn selbst mit dem Fußballspielen angefangen – bei Eller 04. Und vor Monaten hat er mich schon gefragt, ob wir zusammen mal zu Fortuna gehen. Ich meine: Fortuna!“
Karl hob ermahnend den Zeigefinger. Hertha und Fortuna hatten zuletzt einiges ausgefochten, aber das gehörte hier nicht her, das musste klar sein.
Natürlich wollte Ralf den Kleinen mit dem Hertha-Virus infizieren. Ehrensache. Nun hatte die neue Zweitligasaison schon begonnen, Ralf hatte sich die ersten beiden Spiele angeguckt, in denen Hertha nur einen Punkt geholt hatte. Und Karl hatte Ralf sofort im Verdacht, dass der nur die harten Zeiten nicht mitmachen wollte. Dabei hatte Ralf schon viel schlimmere erlebt, und mit Hertha würde es wieder aufwärts gehen. Ralf war vielmehr wichtig, dass es mit ihm selbst mal aufwärts ging. In der Sommerpause wurde ihm klar, wohin der ganze Fußballkram führen würde: samstagmorgens zum Spiel des Sohnes, danach Hertha oder Bundesliga. Nur ein Thema. Klar, so war er groß geworden: Hertha, Hertha, Hertha. „Aber bin ich dadurch glücklich geworden?“, fragte er.
Das war uns allen ganz schön peinlich. Da saßen wir, Singles und Familienväter, Arbeiter und Akademiker. Wir hatten die Leidenschaft für die geilste Nebensache der Welt, doch so richtig glücklich waren wir alle nicht. Es war der erste Moment, der uns emotional zusammenschweißte. Und vielleicht war es dieser Moment, in dem Ralf merkte, dass in ihm noch einige Talente schlummerten.
„Abstieg, Aufstieg, Champions League und immer wieder von vorne, Scheißdreck. Und dabei habe ich mir noch viel Ärger eingefangen. Mein Sohn soll es mal besser haben und sich sein Glück selber suchen. Ich meine, ich bin einmal mit ihm ins Rheinstadion gefahren oder wie das Ding hier heißt. Fortuna gegen Union.“
„Warum gibst du denn Geld für ein Spiel gegen Union aus?“, fragte Karl. „Die kannst du doch als Herthaner auch nicht leiden.“
„Eben“, sagte Ralf, „ich kaufte uns zwei Karten für die Plätze hinter der Union-Bank und beschimpfte die Ersatzspieler 90 Minuten lang. Als mein Sohn mir auf der Rückfahrt erzählte, dass es ihm großen Spaß gemacht hätte, mich aber fragte, wie denn das Spiel ausgegangen sei, da kam es mir, dass es das ja nun auch nicht unbedingt gewesen sein kann.“
Ich notierte in Gedanken: okay, Vaterkomplex – aber die Lage war etwas komplizierter.
„Ihr müsst vielleicht wissen: Ich war früher hart drauf. Hooligan, einer aus der ersten Reihe, einer, der nicht fiel. Ein Guter, wie wir sagten. Zwischen 16 und 30 war ich bei denen. Ihr habt ja selbst mitbekommen, was da damals los war“, erzählte Ralf.
Die Therapie lief jetzt anders als gedacht. Sven trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte, wurde immer nervöser, während Ralf redete und redete. Fast jeden Samstag hatte Ralf früher seine Faust in das Gesicht eines Fremden gedroschen und genauso oft eine abgekriegt. Zigmal die Nase gebrochen, Schulter, Oberarm. Alles freiwillig. Immer wieder Polizeigewahrsam, Verhandlungen, Sozialstunden. Irgendwie hatte er das damals geil gefunden. Mit den Jungs in die Bahn, das Warten auf die Gegner, das Gerenne, die Kloppe und die Heldengeschichten auf der Rückfahrt. „Heute hört sich das bescheuert an, aber ich wusste mich nicht anders zu beschäftigen“, meinte er.
Wieder peinlich: Ich war immer fasziniert gewesen von dieser Gewalt. Habe rübergelinst, wenn sich der Mob drüben am Bahnsteig, drüben im Block sammelte. Habe gewartet, bis es knallte. Und ganz ehrlich: Wenn dort unten auf dem Rasen die Jungs wieder einmal verloren, wenn es regnete, die Sachen klitschnass waren und eine lange Heimfahrt drohte, dachte ich manchmal: Wenn ich Hooligan wäre, dann könnte ich zumindest auf eine dritte Halbzeit hoffen, anstatt mit gesenktem Kopf in der Bahn nach Hause zu fahren. Aber dann schaute ich an mir hinunter und dachte, dass das so oder so vermutlich kein kluger Gedanke war.
Viele Jahre ging Ralf mit seinem Vater ins Olympiastadion, Gegentribüne. Stadionheft, Wurst in der Pause und Einzelkritik auf der Rückfahrt – das volle Programm. Ralf erzählte von einem 6:0-Sieg beim OSV Hannover, einem 8:0 gegen Wattenscheid. Dann kam er in die Pubertät, und andere Sachen wurden interessanter. Keine Mädels, klar, die gab es auch, aber Orientierung suchte er bei Mario Hauf, der wohnte in derselben Straße in Reinickendorf. Der war drei Jahre älter, ging auf dieselbe Realschule und grüßte immer mit „Na, Kleiner!“.
Der Tisch war jetzt ruhig. Sven verdrehte die Augen, schaute mich direkt an. Hatte er meine Faszination gespürt? Dass unser Linker Gewalt ablehnte, war ja klar. Aber dass er so böse gucken konnte, irritierte mich von Beginn an.
Ralf machte weiter: „Irgendwann war ich drin und dachte gar nicht daran aufzuhören. Vielmehr ging’s für mich ja erst los. Du fängst immer klein an, auch bei den Hools, vor allem da. Du musst ganz schön was einstecken und vor allem verteilen, bis sie dich akzeptieren. Es dauerte ein paar Saisons, bis ich vorne dabei war, bis die ersten Matches kamen, bis die ersten Jungen nachrückten, die ich piesacken konnte. Ich war voll drin und voll beschäftigt. Die ganze Woche war doch reine Scheiße. Der Blick ging immer nur in Richtung Wochenende.“
„Seid ihr Herthaner nicht alle verdammte Nazis?“ Sven reichte es jetzt.
„Klar haben wir viele Rechte, aber ich finde, Politik hat auf dem Platz nix verloren“, entgegnete Ralf. „Das hat für mich nie ’ne Rolle gespielt.“
„Scheißdreck“, sagte Sven, der Bremer. Ein Hertha-Hooligan, ein linker Bremer und eine Düsseldorfer Laberbacke, das könnte noch witzig werden. „Und jetzt haste kein’ Bock mehr auf die Assis“, blaffte Sven. „Kein Wunder! Ich erinnere mich noch: Ihr Hertha-Frösche habt doch regelmäßig auf Auswärtsfahrten die Interzonenzüge abgefackelt.“
„Mal ganz, ganz langsam, Alter. Die Zeiten sind vorbei. Ich möchte einfach meine Ruhe haben“, sagte er. „Ich habe mich jahrelang im Kreis bewegt, und seit ich in Düsseldorf wohne, ist eben nur der Radius etwas größer geworden. Ich will raus und was Neues erleben. Ich habe genug Ärger gehabt wegen der Bullen, ich kann mir nicht mehr viel erlauben, dann buchten die mich ein. Wisst ihr, ich habe jetzt eine Verantwortung. Auch wegen meinem Sohn.“
Wegen meines Sohnes, dachte ich, aber ich hielt lieber die Klappe. Das mit dem System war auch schon nicht so gut angekommen. Ich wollte mich auf keinen Fall als akademischer Kotzbrocken aufspielen. War ja so schon nicht einfach: Banker in Düsseldorf, das klang entweder langweilig oder arrogant. Langweilig war mir auf jeden Fall lieber.
Karl dagegen schien unbesorgt. „Also, ich kann mit einem Alt-Hool leben“, sagte er und hob sein Glas, „besser als Kölsch-Hool.“ Er wartete auf einen Lacher, doch der kam nicht, und er nippte schnell an seinem Bier.
Sven fuhr eher so die Antikommerzialisierungsschiene. Beim Fußball ging es ihm inzwischen um zu viel Geld, echten Sport witterte er eher auf Ascheplätzen im Flutlicht im Schatten stillgelegter Zechen im Ruhrgebiet oder auf irgendwelchen Nebenplätzen des Weserstadions.
„Hör mir auf mit Nebenplatz 11“, rief Karl dazwischen.
Fortuna Düsseldorf hatte es auf ihrem Weg durch die Ligen auch mehrmals auf einen Nebenplatz des Weserstadions verschlagen. Die Bilanz dort: In sieben Spielen verlor die Fortuna fünfmal 0:2, holte insgesamt nur einen Punkt und machte gerade mal zwei Tore. Klar, dass das bei Karl Spuren hinterlassen hatte. Aber so sehr ich mitfühlte, so sehr musste ich aufpassen: „Nebenplatz 11“, das klang schon wieder sehr nach einer Veteranengeschichte, das gehörte hier nicht her. Wir hatten etwas zu erledigen. Wir mussten arbeiten.
Sven redete unbeirrt weiter. „Ich weiß, dass sich das bescheuert anhört. Und dieser ganze Fußballhype mit Champions League und Länderspielen geht mir ohnehin auf die Eier. Ich meine: Die Menschen, die Fußball nur aus den Zusammenfassungen der Sportschau und den Live-Übertragungen kennen, die haben doch keine Ahnung, was es bedeutet, Woche für Woche ins Stadion zu gehen. Mal ehrlich, wenn man die meisten Bundesligaspiele in voller Länge sieht, fragt man sich doch, wie so etwas Volkssport werden konnte. Und es reicht ja nicht, dass jeder Fahrlehrer sein Fähnchen raushängt und jeder Bäcker Kuchen in Vereins- oder Landesfarben backt. Nein, sie müssen ja alle auch noch bei den Radiostationen anrufen und das haarklein erzählen. Ich sag’s euch: Ich bin an einem Länderspieltag mal von Bremen nach Düsseldorf gefahren und habe Radio gehört. Das war die Hölle.“
„Schlimmer als Platz 11 wird es nicht gewesen sein“, sagte Karl ganz leise.
Sven erzählte seine Geschichte. Er kam aus Bremen und hatte viel erlebt, keine Frage. Die 14 Jahre mit Rehhagel, Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger der Pokalsieger ’92.
„Mit unserem Klaus Allofs“, sagte Karl.
Sven verdrehte die Augen.
So wankelmütig Werder auch war in all den Jahren danach, Fußball war immer Svens Konstante gewesen. Sven redete sich warm. Er erzählte von den Fahrten mit dem Vater ins Weserstadion, den ersten Spielen auf den Stehrängen, von Kutzop und dem eckigen Pfosten.
„Langweilig war das nie“, sagte Sven, „das könnt ihr euch vorstellen.“ Jahrelang musste er nicht viel machen – die Gefühle brachte Werder. Er hatte sich immer mehr reingesteigert. „Viele Saisons bin ich alleine ins Stadion gefahren, um alleine meine Wut oder meinen Jubel ausleben zu können“, sagte Sven.
Mit seiner Fußballleidenschaft war er immer der Außenseiter gewesen, seine linken Freunde fanden das früher alles viel zu prollig, erst später änderte sich das. Sie hätten’s einfach nicht gerafft, wie man sich stundenlang neben ein paar Asoziale um einen Rasen stellen konnte, um andere Asoziale anzubrüllen. Svens Frauen verstanden das noch weniger.
„Weiber kommen und gehen, Werder bleibt“, sagte Sven. „So erfolgreich Werder auch war, aus Leidenschaft wurde Fanatismus, aus Fanatismus Verbitterung. Aber: Ich habe mit meiner Verbitterung ganz gut gelebt.“
Sein Lehramtsstudium hatte er abgebrochen, über zehn Jahre sortierte er Päckchen in der Poststelle am Bremer Bahnhofsplatz. Ihm war die ganze Zeit klar gewesen, dass das kein Zustand war. Andererseits waren das ziemlich klare Verhältnisse, und was sollte er auch sonst machen? Immerhin hatte er seit drei Jahren eine Freundin. Sabine hatte er auf dem Geburtstag seines jüngeren Bruders kennengelernt. Eine promovierte Soziologin.
„Promovierte Soziologin“, sagte Karl leise zu sich.
Vor einem halben Jahr hatte sie beim Abendessen den Löffel neben den Teller gelegt. „Ich habe ein Angebot aus Düsseldorf“, hatte sie gesagt. Fortuna, hatte Sven gedacht, um Himmels willen Fortuna.
Die Gruppe lachte, auch Karl. Sven musste schmunzeln.
„Jetzt bin ich hier und will ein neues Leben anfangen. Ich konnte ja schlecht sagen: Mein Job bei der Post ist so super, wir müssen in Bremen bleiben. Außerdem machen das moderne Männer doch so, oder? Ich will jedenfalls keine emotionale Marionette mehr sein. Das ist wie bei dir, Ralf, ich will jetzt nicht immer am Wochenende nach Bremen fahren. Ich arbeite jetzt unter der Woche wieder bei der Post, hier am Bahnhof, da will ich am Wochenende meine Ruhe. Und mir nicht die Laune und die Freizeit in einer Fußballkneipe verderben. Sabine ist echt ’ne tolle Frau, versteht ihr? Mit der will ich auch mal was unternehmen. Was erleben!“
„Und deswegen triffst du dich am Samstagnachmittag mit drei fremden Männern. Da wird sich deine Freundin freuen“, sagte Karl laut. Doch keiner lachte.
„Sabine kennt mich“, antwortete Sven sehr ruhig. „Die weiß, wie schwer das für mich ist. Ich habe ja die letzten Jahre fast nichts anderes gemacht außer Fußball. Ich meine, mal ehrlich, was denn auch?“
Ich nickte betreten. Sven und ich saßen im selben Boot, sollte er auch noch so rumzicken. Auch Ralf war sicher. Nur Karl blieb ein Wackelkandidat.
Zum Schluss erzählte Karl seine Geschichte, für mich war das seine letzte Chance. Er kam mir vor wie die rheinische Ausgabe von Waldemar Hartmann. Aber ich hatte nichts gegen einen Gute-Laune-Onkel, an die Spezies hatte ich mich in Düsseldorf gewöhnt. Doch er sollte es auch ernst meinen und das Projekt nicht als lustigen Freizeitvertreib sehen. Das war es nämlich ganz sicher nicht.
„Jut, ich bin also Karl und nicht Pommes. 54 Jahre alt, geboren in Langenfeld, zwischen Leverkusen und Düsseldorf. Seit ich 17 bin, arbeite ich in Düsseldorf. Ich wohne in Holthausen, könnt auch sagen: Ich bin Holthausener. Und Gasund Wasserinstallateur. Ja, ja, Gas-Wasser-Scheiße, schon klar.“
Karl hatte zwei Kinder und eine Enkeltochter. Der Fanklub schenkte ihm sofort ein Fortuna-Trikot, auf dem hinten „Opa“ geflockt war. Die Tochter war damals 25 und wohnte mit dem Kind in Düsseldorf ein paar Straßen entfernt. Der Sohn war 20 und zum Studium nach München gezogen. „Maschinenbau“, sagte Karl stolz. „Mein Sohnemann geht da auf so ’ne Elite-Uni und ist das ganze Wochenende nur am Lernen.“
„Sei froh, dass er nicht zu den Scheiß-Bayern geht“, sagte Sven sehr ernst. Wir nickten alle.
Ich blieb skeptisch. Lief doch alles bei ihm, er hätte doch schön weiter zum Fußball gehen können. Aber dann erzählte Karl, dass der Fußball auch ihn fertigmachte. Er hatte von allen am meisten erlebt. Nicht nur wegen seines Alters. Die Gruppe wurde ganz leise, als er erzählte: Aufstieg, Pokalsiege, ’79, damals gegen Hertha 1:0 nach Verlängerung, ’80 gegen Köln, Europapokalfinale gegen Barcelona in Basel: 3:4 nach Verlängerung. Abstieg der Fortuna ’86 nach 16 Jahren Bundesliga. Seitdem hatte die Fortuna einen unvergleichlichen Ritt durch die Ligen hingelegt, war zweimal ganz unten und stand immer wieder auf. Karl war so etwas wie der Boris Becker der Fußballfans: Jeder kannte ihn, aber die großen Erfolge lagen lange zurück.
Nun war die Fortuna wieder einmal in der Bundesliga, doch Karl durfte und wollte das alles nicht mehr. Sein Arzt hatte ihm sogar abgeraten: das Herz, die Aufregung. Nicht noch mal hoffen, scheitern, nicht noch mal Bundesliga, nicht noch mehr reinsteigern. Die Sache mit der Fortuna war Karl in den vergangenen Jahren viel zu ernst geworden. Auch wenn sie im Fanklub „Red Religion“ fröhlich schunkelten, für ihn war das schon lange kein Spiel mehr, vielleicht tatsächlich eher so etwas wie ein Glaube.
Er erzählte uns, wie er unter der Woche von Kunde zu Kunde eilte, um sich unter irgendwelche Waschbecken zu legen, und wie er leise im Kopf die mögliche Aufstellung runterratterte. Mit den Kollegen hatte er ein Tippspiel, und natürlich war das Gelächter groß, wenn er montags seinen Kollegen Helmut traf, den Gladbacher, und die Fortuna verloren hatte. Aber witzig fand das Karl schon lange nicht mehr.
„Das Schlimme ist doch: Du kommst da nicht mehr so leicht raus. Je öfter du da hingehst, je mehr du mitmachst, dich auskennst, desto häufiger denkst du daran. Es ist eine verdammte Sucht.“ Jetzt, wo sein Sohn in München studierte, wäre ein guter Zeitpunkt, mit alldem aufzuhören. Es ärgerte Karl selbst, dass sie am Telefon fast immer nur über die Fortuna redeten.
„Ich meine, das mit dem Studium kapier ich ja auch nicht: Seminar, Vorlesung, Tutordingsda. Axel, Lumpi, das ist doch unsere Sprache.“ In der Sommerpause hatte er gemerkt, dass es auch anders geht. Er hatte seine Tochter mit der Enkelin getroffen, sie waren spazieren gegangen, auf den Spielplatz. Und als der Sohn aus München für eine Woche da war, waren sie alle zusammen im Zoo gewesen.
Karls Frau war vor langer Zeit abgehauen, als sich Fortuna wieder mal auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit befand. Eine Affäre mit einem Arbeitskollegen. „Jeden Samstag“, sagte er nur leise. Wir nickten alle. Als Karl die Betrügereien herausbekam, flippte er aus, dann zog sie aus, und Karl biss sich noch stärker in die Fußballleidenschaft hinein. Nun wollte er etwas Neues. Seinen Sohn hatte er gelöchert, er wollte alles über dessen Studium wissen und auch über München. Bislang kannte Karl nur die Strecke mit der U3 zum Olympiastadion, Fortuna hatte dort das letzte Mal 0:5 verloren. In der Arena war er noch nie gewesen. Und das wollte er sich auch nicht mehr antun.
„Ich will es auf jeden Fall mal versuchen“, sagte Karl. „Wenn’s gut läuft, habe ich mein halbes Leben noch vor mir. Das will ich nicht mehr in Kneipen, Stadien und Straßenbahnen verbringen.“ Irgendwann habe man eben alles gesehen und erlebt. „Das 2:0 in Chemnitz durch zwei Glavas-Tore ’95, die zwei Pokalsiege ’79, ’80, das werde ich nie vergessen. Jetzt der Aufstieg gegen Berlin …“
Ralf guckte auf den Tisch.
Karl würde von allen am meisten aufgeben müssen – und dafür zollten wir ihm Respekt. Fanklub-Treffen, Freunde, Gespräche mit dem Sohn. Er hätte es sich leichter machen und einfach in eine Fußballkneipe gehen können, so wie Tausende andere auch. Aber er konnte das Gequatsche dort nicht ertragen – das vom Kommentator und das von den Leuten.
Karl hatte mich überzeugt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bei 400.000 Menschen, die jede Woche alleine in der Bundesliga ins Stadion gingen, waren wir vier zwar noch lange keine Sensation – und keineswegs die Massenbewegung, die ich im Sinn hatte. Aber die Saison hatte ja auch noch gar nicht angefangen.