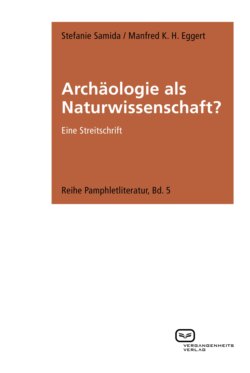Читать книгу Archäologie als Naturwissenschaft? - Stefanie Samida - Страница 6
Archäologie – Was ist das?
ОглавлениеIn weiten Kreisen unserer Gesellschaft, der gern zitierten ‚Öffentlichkeit‘, erfreut sich die Archäologie einer großen Beliebtheit. Ausgrabungen faszinieren – denn mit dem Ausgraben wird meist die Auffindung von kostbaren oder zumindest sensationellen Objekten verbunden. Archäologinnen und Archäologen gelingt es offenkundig immer wieder, an unscheinbaren Orten, dort, wo niemand unter der Erde auch nur das Geringste von Interesse vermutet hätte, ungewöhnliche Dinge einer meist fernen Vergangenheit aufzuspüren und freizulegen – Dinge, die auch jenseits der Fachwelt große Aufmerksamkeit erregen.3 Nur wenige Wissenschaften können sich einer derart breiten Aufmerksamkeit erfreuen.
Der international renommierte amerikanische Archäologe Lewis R. Binford (1931–2011) hat einmal einen älteren Herrn bemüht, der ihm in einem Bus gegenübersaß, um das populäre Bild von Archäologie zu charakterisieren. Kaum hatte Binford ihm auf eine entsprechende Frage seinen Beruf genannt, geriet sein Gegenüber ins Schwärmen: „Das muss wunderbar sein. Da brauchen Sie nur Glück, und schon sind Sie ein gemachter Mann!“4 Atemberaubende Schätze sowie höchst befremdliche Sitten und Gebräuche unbekannter Kulturen, nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in vertrauter Umgebung, heutzutage mit allen technischen Mitteln des Computerzeitalters aufgespürt, ausgegraben und analysiert – das ist ein verbreitetes Klischee. Aber was ist Binfords älterer Herr gegen Lara Croft aus der Computerspielserie und dem Kinofilm Tomb Raider oder gegen den in Filmen gefeierten Indiana Jones? Gar nichts, mag man getrost antworten. Denn auch bei Lara Croft und Indiana Jones geht es nicht zuletzt sehr wesentlich um Archäologie oder – was dafür herhalten muss.
Doch auch die Archäologie selbst trägt einen beträchtlichen Teil Schuld daran, dass sie mit Klischees überfrachtet ist. Schließlich werden die Ergebnisse von Ausgrabungen nach Jahren intensiver Forschung in großen Ausstellungen der Öffentlichkeit in medientechnischer Perfektion präsentiert. Viele, zu viele dieser Ausstellungen suchen das Spektakuläre, denn da sie teuer sind, spielen kommerzielle Gesichtspunkte von vornherein eine wichtige Rolle. Und spektakuläre Ausstellungen ziehen nun einmal entschieden mehr Besucher an als solche, bei denen weder Gold noch Schädelkult, weder Mumien noch Kannibalismus oder in Grubenringen gefundene klein gehackte Knochen von vielen hundert Menschen im Mittelpunkt stehen. „Die Welt der Kelten: Zentren der Macht – Kostbarkeiten der Kunst“, so lautete das Thema der jüngsten Landesausstellung in Baden-Württemberg (2012/13), und auch in diesem Titel stecken – so wenig sensationell er sich verglichen mit anderen Titeln archäologischer Ausstellungen gibt – doch alle entscheidenden Ingredienzen für einen Publikumserfolg: ein in Mitteleuropa und nicht zuletzt im südwestlichen und südlichen Deutschland in der populären Imagination sehr bekanntes ‚Volk‘ – dessen Welt, Machtzentren und natürlich dessen kostbare Kunst. Die Ausstellung wurde sechs Monate gezeigt und von 185 000 Besuchern gesehen; man darf daher zweifellos sagen, dass sie „mit vollem Erfolg“ zu Ende ging.5
Das Problem so mancher Ausstellungen liegt natürlich nicht darin, dass sie gezeigt werden – im Gegenteil. Es liegt vielmehr in der Tatsache, dass die Präsentation allzu häufig auf das Kostbare, Exotische sowie vor allem das den Werten unserer Kultur Entgegengesetzte, oft Grauenhafte und Abstoßende, auf jeden Fall aber auf das Unverständliche ausgerichtet erscheint. Nicht selten ist aber auch eine gegenläufige Tendenz leitend: So stellt man etwa die uns ja tatsächlich alles in allem völlig fremde ur- und frühgeschichtliche Welt nicht etwa kritisch und mehrdimensional dar, sondern präsentiert sie ahistorisch nach den Vorstellungen der Gegenwart. Überdies wird die Archäologie als Wissenschaft in den meisten Ausstellungen auf ihre uneingeschränkte Teilhabe an der Welt des High-Tech reduziert, und dabei bleibt nicht nur ihr historisch-kulturwissenschaftliches Anliegen, sondern auch ihr vergleichend-analogisches Verfahren der Erkenntnisgewinnung unterbelichtet.
Halten wir fest: In der öffentlichen Wahrnehmung wird Archäologie in erster Linie mit Ausgrabungen gleichgesetzt. Die nächste Ebene des gängigen Klischees von Archäologie wird dann allzu häufig in oft vielversprechenden und intensiv beworbenen Ausstellungen bedient, in denen die Ergebnisse der Ausgrabungen einem interessierten Publikum dargeboten werden.
Das Ausgrabungswesen gehört in vielen europäischen Ländern in den Bereich der staatlichen oder kommunalen Archäologischen Denkmalpflege – bisweilen auch ‚Bodendenkmalpflege‘ genannt. Unabhängig von der jeweiligen Zuständigkeit – es gibt zudem von Universitätsinstituten und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen betriebene Forschungsgrabungen – wird das Ausgrabungswesen in der modernen Archäologie oft mit dem Begriff ‚Feldarchäologie‘ belegt. An der Wiege der Feldarchäologie steht nicht etwa Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), der ‚Ahnherr‘ der ursprünglich auf die antike Kunst ausgerichteten ‚Klassischen‘ Archäologie, sondern Heinrich Schliemann (1822– 1890). Schliemann, schwerreicher Kaufmann und archäologischer Autodidakt, hat nicht nur in Troia, sondern auch in Tiryns, Mykene, Orchomenos und Ithaka ausgegraben; er umschrieb seine Tätigkeit als „Forschung mit Spitzhacke und Spaten“.6 Daher überrascht es nicht, dass jenes bis heute populäre Wort von der Archäologie als ‚Wissenschaft des Spatens‘ ebenfalls auf ihn zurückgeht. Somit steht Schliemann an der Schwelle jener gerade angesprochenen immer noch weitverbreiteten Vorstellung, die Archäologie mit Ausgrabungen gleichsetzt. Er hat vor allem mit dem von ihm zitierten Spaten ein gewissermaßen ‚handfestes‘ Symbol der Archäologie geschaffen, das bis heute fortlebt. Spitzhacke und Spaten entsprachen damals durchaus dem Stand der Ausgrabungstechnik, während man heutzutage eher an Maurerkellen, Stukkateureisen, Pinzetten und Pinsel denken würde. Aber es geht um die Werkzeugmetaphorik als solche: Sie führt unterschwellig zur Reduktion einer Wissenschaft auf den wesentlich technischen Vorgang der Quellengewinnung. Wie abwegig der Schliemann’sche Begriff von der ‚Spatenwissenschaft‘ besonders angesichts der seit mehr als einhundert Jahren vollzogenen universitären Etablierung der ‚ausgrabenden‘ Archäologien ist, macht man sich am besten an Beispielen klar: Niemand käme auf die Idee, von einer ‚Wissenschaft des Mikroskops‘ oder einer ‚Wissenschaft des Skalpells‘ zu sprechen. Das auch heute noch scheinbar so handfeste und simple Ausgraben ist in der Praxis eine durchaus diffizile Aufgabe, deren erfolgreiche Durchführung großer Erfahrung und beträchtlicher Beobachtungsgabe bedarf.7 Die Institute für Archäologie an den Universitäten bieten regelmäßig Praktika an, in denen die Studierenden in die Feldarchäologie eingeführt werden. Außerdem gibt es Lehrbücher, die sich speziell der Ausgrabungstechnik und der Ausgrabungsmethodik widmen.8
Bisher haben wir so getan, als gäbe es ‚die‘ oder eine einzige Archäologie. Es wird höchste Zeit, diesen Eindruck zu korrigieren. Tatsächlich bestehen an deutschen Universitäten insgesamt sieben archäologische Einzelfächer, und dabei ist die Ägyptologie noch nicht mitgezählt: Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Vorderasiatische Archäologie, Biblische Archäologie, Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie, Christliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters.9 Unsere Ausführungen betreffen zwar jedes einzelne dieser forschungsgeschichtlich und institutionell selbständigen Fächer, aber eben doch in unterschiedlichem Maße. Denn im Zentrum unseres Interesses steht die Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie.
Die Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie oder Ur- und Frühgeschichtswissenschaft erforscht vor allem die nicht durch Schriftzeugnisse bezeugte Vergangenheit des Menschen seit den Australopithecinen Afrikas vor 4 Millionen Jahren. Auf die Urgeschichte folgt die Frühgeschichte, die nach konventionellem Verständnis mit den ersten schriftlichen Quellen einsetzt. Diese zunächst wenigen Schriftzeugnisse vermögen das aus den materiellen Hinterlassenschaften gewonnene Bild der Vergangenheit jedoch bestenfalls schlaglichtartig zu erhellen beziehungsweise zu ergänzen. Der Zuständigkeitsbereich der Ur- und Frühgeschichtsforschung endet, wenn die schriftliche Überlieferung zunehmend reicher zu fließen beginnt. Diese Zeit ist je nach Kontinent, Land und Region unterschiedlich anzusetzen. In Mitteleuropa beginnt sie mit der Herrschaft der Karolinger in der Mitte des 8. Jahrhunderts, im Inneren Kongobecken Zentralafrikas hingegen erst kurz vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Alles, was vor dieser Zeit über den Menschen Auskunft zu geben vermag, sind zum einen dingliche Quellen, also Sachgut, und zum anderen Fundzusammenhänge. Auch sie haben sich materiell niedergeschlagen und sind in dieser oder jener Form erhalten geblieben. In der Archäologie spricht man statt von Sachgut meist von ‚Funden‘, während Fundzusammenhänge im Sinne von Fundkontexten oder Fundsituationen in der Regel mit dem Fachausdruck ‚Befunde‘ belegt werden.10
Jenseits aller forschungsgeschichtlichen Unterschiede und ihrem nach Zeit und Raum bestimmten Forschungsgegenstand weisen die archäologischen Einzelfächer einen gemeinsamen Bezugspunkt auf: Sie sind ausnahmslos historisch orientiert, empfinden sich traditionell als Geisteswissenschaften und verstehen sich heutzutage zunehmend als historisch ausgerichtete Kulturwissenschaften.11 Jedenfalls suchen sie ihren ‚disziplinären Ort‘ nicht in den Naturwissenschaften. So fühlen sich die Biblische und die Christliche Archäologie eng mit der Theologie verbunden – eine Tatsache, die sowohl historische als auch inhaltliche Gründe hat.
Allerdings könnten einem Zweifel kommen, wie es in dieser Hinsicht mit der Erforschung des Altpaläolithikums steht, also jenes Teils der Urgeschichte, der von etwa 800.000 bis 300.000 vor Heute datiert. Hier, wie überhaupt im Zusammenhang mit dem Paläolithikum – also der Altsteinzeit, die sich vom Altpaläolithikum über das anschließende Mittel-, Jung- und Endpaläolithikum bis etwa 12.000 vor Heute erstreckt – kooperiert die Urgeschichtliche oder Prähistorische Archäologie in einem hohen Maße mit Naturwissenschaften wie der Geologie, Geomorphologie und Physischen Anthropologie. Aber das ändert nichts daran, dass im Mittelpunkt des archäologischen Interesses hier ebenfalls der Mensch im Sinne des Homo sapiens und seiner Vorformen steht. Die Archäologie wird durch die Dimension des Kulturellen konstituiert – mit Arnold Gehlen ist der Mensch von Natur aus ein Kulturwesen; daraus folgt, dass diese Dimension mit zunehmendem Zurückschreiten in der Stammesgeschichte des Menschen gegenüber dem Nichtkulturellen in den Hintergrund tritt.
Wenn somit selbst im Bereich der Erforschung der Älteren Altsteinzeit die Archäologie wesentlich ein historisch-kulturwissenschaftliches Fach bleibt, besagt das allerdings nichts über die Rolle der Naturwissenschaften in der Archäologie beziehungsweise in den archäologischen Einzelfächern.